
CARL SCHURZ
Abb.: Carl Schurz als Bonner Student. Foto/Repro: Simon Rick, Euenheim; Fotoarchiv: Kreismedienzentrum Euskirchen
Frieden und Versöhnung in Freiheit, so Carl Schurz, sind die übergeordneten Ziele der Demokratie, innergesellschaftlich wie international. Aber um diese Ziele zu erreichen, müssen Widerstände gegebenenfalls auch gewaltsam überwunden werden. Die Demokratie braucht eine „Armee der Freiheit“, sie muss erkämpft werden und „wehrhaft“ bleiben, denn sie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern die stets bedrohte Ausnahme. Deren Schutz ist für Carl Schurz das Fundament jedes politischen demokratischen Realismus. Dieser Überzeugung folgte er sowohl während der 48/49er-Revolution als auch im amerikanischen Exil, wo er sich vom Revolutionär zum Staatsmann wandelte. Als General der Nordstaaten kämpfte er gegen die Sklaverei und für die Rechte der indigenen Bevölkerung. Er war Mitbegründer der Republikanischen Partei und stieg am Ende gar zum Innenminister der USA auf.
Am 02. März wird Carl Schurz in Liblar, einem Ort in der preußischen Rheinprovinz nahe Köln, als Sohn des Landschullehrers Christian Schurz und seiner Ehefrau Marianne geboren.
Der Vater gibt sein Schulmeisteramt auf, weil er die sechsköpfige Familie – Carl hat drei jüngere Geschwister – damit nicht hinreichend versorgen kann, und eröffnet eine kleine Eisenwarenhandlung. Die finanziellen Probleme werden dadurch nicht geringer, so dass Carl seine Schullaufbahn unterbrechen, muss, um als Ältester in der Familie auszuhelfen.
Gleichwohl schafft es Carl Schurz im Juli 1847, als „Externer“ das Abitur zu bestehen, und beginnt noch im selben Jahr ein Studium der Geschichte an der Universität Bonn. Hier befreundet er sich mit dem radikal „Demokratie-bewegten“ Kunst- und Kulturhistoriker Professor Gottfried Kinkel.
Schurz schließt sich der Bonner Burschenschaft „Frankonia“ an, wird deren Sprecher sowie am 1. Dezember Präsident des neu gegründeten demokratischen Studentenvereins in Bonn.
Im Mai 1849 nimmt Schurz, gemeinsam mit Kinkel, an dem Versuch teil, im nahen Siegburg das Zeughaus zu stürmen, um Aufständische mit Waffen zu unterstützen. Das Unternehmen scheitert, und Schurz flieht nach Baden, wo er als Adjutant von Fritz Anneke am Badischen Aufstand teilnimmt. Als auch dies scheitert, gelingt ihm auf abenteuerliche Weise die Flucht aus der von Preußen eingeschlossenen Festung Rastatt. Er entkommt in die Schweiz.
Gottfried Kinkel hingegen war gefangengenommen worden. Im August 1850 reist Schurz deshalb unter einem Tarnnamen und mit falschem Pass nach Deutschland ein und befreit seinen ehemaligen Professor Anfang November in einer tollkühnen Aktion aus dem Zuchthaus Spandau. Über Rostock und Warnemünde gelingt ihnen per Schiff die Flucht nach Schottland.
Aber die „Reaktion“ in Europa wird immer massiver. Also schifft sich Carl Schurz im Herbst 1852 nach New York ein, dorthin, wo die Demokratie verwirklicht scheint. Auch hier bleibt er politisch aktiv und wird zu einem einflussreichen Führer der aufstrebenden Republikanischen Partei.
Nach seinem Wahlsieg ernennt ihn der neue Präsident Abraham Lincoln zum Botschafter in Spanien. Schon bald darauf, im Januar 1862, kehrt Schurz jedoch in die USA zurück, um während des amerikanischen Bürgerkrieges in die Unionsarmee einzutreten, und steigt in kurzer Zeit zum Generalmajor und Divisionskommandeur auf.
Carl Schurz wird in den Senat der Vereinigten Staat gewählt, in dem er (bis 1875) den Bundesstaat Missouri vertritt. Hier macht er sich vor allem als Korruptionsbekämpfer einen Namen.
Der gerade ernannte US-Präsident Rutherford B. Hayes beruft Schurz als Innenminister in sein Kabinett (bis 1881). Hier macht er sich vor allem um einen Wandel der Indianerpolitik verdient, indem er die bislang militärisch dominierte Verwaltung einer zivilen Reform unterzieht.
Gemeinsam mit Persönlichkeiten wie Mark Twain oder William James gründet Schurz die „American Anti-Imperialist-League“, die sich gegen die zunehmend imperialistische Orientierung der US-amerikanischen Außenpolitik unter Präsident Theodore Roosevelt wendet.
Am 14. Mai 1906 stirbt Carl Schurz in New York, wo er auch beerdigt wird. In „Harper’s Weekly“ erscheint ein Nachruf von Mark Twain.
Uwe Timm
In Berlin gibt es neun Bismarck-Denkmäler – an Carl Schurz erinnert keins. Wie wäre die deutsche Geschichte verlaufen, wenn es umgekehrt wäre? Wenn Carl Schurz Kanzler des Deutschen Reichs geworden wäre, wenn es keine Einigung Deutschlands durch Kriege gegeben hätte, und, daraus folgend, kein Primat des Militärs und des Adels, sondern eine demokratisch-bürgerliche Verfassung mit einer konstitutionellen Monarchie? Wenn die revolutionäre Bewegung von 1848 ihr Ziel eines demokratischen Deutschlands erreicht hätte?
Man kann sagen, die Zeit war dafür nicht reif. Aber einige ihrer Protagonisten waren es, zu ihnen, den revolutionären Demokraten, gehörte Carl Schurz. Sein Denkmal steht heute in New York, imposant und ästhetisch weit beeindruckender als die Statue vom uniformierten Bismarck, der mit Pickelhaube an der Siegessäule wacht. Der New Yorker Schurz am Morningside Drive trägt Anzug und Mantel und hält als Senator und Innenminister der Vereinigten Staaten ganz zivil einen Hut in der Hand. Und das, obwohl Schurz im amerikanischen Bürgerkrieg General der Unionsarmee gewesen ist und in Schlachten wie Bull Run, Gettysburg und Chattanooga eine Freiwilligen-Division gegen die Sklavenhalter-Gesellschaft der Südstaaten geführt hat. Weiterlesen
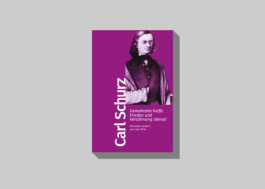
Carl Schurz
Demokratie heißt: Frieden und Versöhnung überall
Erschienen am 10.10.2024
Taschenbuch mit Klappen, 176 Seiten
€ (D) 14,– / € (A) 14,40
ISBN 978-3-462-50015-8
Am Anfang eines abenteuerlichen Lebens steht der Student, der aus bürgerlichen, aber prekären Verhältnissen kommt; der Vater, ein Ladenbesitzer, musste nach einem Konkurs ins Schuldgefängnis. Der junge Carl Schurz erreicht auf Umwegen die Hochschulreife, studiert in Bonn, interessiert sich für die Französische Revolution und will ihre Leitbegriffe – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – auch in Deutschland heimisch machen. Er schreibt und agitiert, fordert die Pressefreiheit, das allgemeine Wahlrecht (noch sind die Frauen wie selbstverständlich davon ausgenommen), und er strebt die Einheit des in Fürstentümer und Hansestädte zersplitterten Deutschlands an. Ein langhaariger, schlaksiger junger Mann, der sich, beeinflusst durch seinen Professor und späteren Freund Gottfried Kinkel, an der Bonner Universität radikalisiert, der in einem lebendigen Deutsch Artikel und Aufrufe schreibt, der aufrüttelnd in der Öffentlichkeit reden kann, dem es gelingt, für ein paar Tage Bonn in republikanische Selbstverwaltung zu bringen, der einen bewaffneten Marsch nach Siegburg unternimmt, mit dem Ziel, das dortige Zeughaus zu stürmen und die darin gelagerten Waffen zu erbeuten. Preußische Husaren zersprengen den Aufmarsch der Revolutionäre.
Carl Schurz geht 1849 nach Baden, wo sich die Aufständischen versammeln, entschlossen, die in der Frankfurt Paulskirche beschlossene Reichsverfassung gegen die preußische Intervention durchzusetzen. Er kämpft als Oberleutnant in der Pfälzischen Volkswehr, die mit anderen Aufständischen in der Festung Raststatt von den Preußischen Truppen eingeschlossen wird. Nach dreiwöchiger Belagerung kapituliert die Festung. Neunzehn Aufständische werden sofort erschossen. Carl Schurz gelingt es mit einem Kameraden, durch einen Abwasserkanal zu entkommen, und kann sich nach Frankreich und von dort in die Schweiz durchschlagen.
All das ist nicht dem Hunger nach Abenteuer geschuldet, sondern entspringt dem entschlossenen Ernst seiner freiheitlichen Gesinnung, zu der das Ideal der Brüderlichkeit, also die Solidarität gehört. Sein Freund, Gottfried Kinkel, wird in Raststatt gefangengenommen und zu lebenslanger Festungshaft verurteilt. Auf Befehl des Kartätschenprinzen Wilhelm, dem späteren Kaiser Wilhelm I., wird dieses Urteil in eine unehrenhafte Zuchthausstrafe umgewandelt. Mit einer staunenswerten Sorgfalt und Energie plant Schurz die Befreiung des Freundes aus dem Zuchthaus in Spandau, reist unter falschen Namen durch Deutschland, sammelt Geld ein, besticht einen Gefängniswärter, legt den Fluchtweg aus Preußen fest, und steckt sich am Abend, die Wärter feiern in einem nahen Gasthof, ein Jagdmesser in den Gürtel und ein Paar Pistolen in die Tasche. Schurz beschreibt in seinen Lebenserinnerungen, wie sich Kinkel über das Zuchthausdach abseilt, Ziegel fallen krachend auf die nächtliche Straße, wo die Kutsche wartet und Kinkel und Schurz nach Rostock bringen wird. Von dort segeln die Freunde nach England: Das Leben im Exil beginnt. Schurz schreibt Artikel, hält Kontakt zu anderen Revolutionären, darunter, im Streit, mit Karl Marx. Im Jahr 1852 heiratet er in London Margarethe Meyer, eine politisch denkende und handelnde Frau. Viele der 48-Revolutionäre waren, das ist kennzeichnend, mit selbstständigen, sozial engagierten Frauen verbunden. Im selben Jahr wandert Schurz in die USA aus, wo Margarethe später die Kindergarten-Bewegung gründen wird.
Musste die Revolution von 1848 scheitern? Carl Schurz sieht die Gründe in der Zerstrittenheit der in der Frankfurter Paulskirche versammelten Abgeordneten. Schurz betont deren beste Absichten und das hohe Niveau der Diskussionen, kritisiert aber, wie sie sich in langen Debatten über Nebensächlichkeiten verloren und in Eigensinn und Eitelkeiten verharrten.
Tatsächlich gab es objektive Gründe, die in den divergierenden Positionen der konservativen, liberalen, demokratischen und republikanischen Abgeordneten lagen, die zudem noch verschiedene regionale Interessen vertraten. Darüber hinaus spielten die konfessionellen Unterschiede zwischen dem überwiegend evangelischen Norden und dem katholischen Süden eine Rolle. Wahrscheinlich trifft zu, was der Historikers Heinrich August Winkler vermutet, zugleich die Einheit und Freiheit in Deutschland herzustellen, war historisch eine Überforderung der deutschen Liberalen.
1868 treffen der inzwischen bekannte amerikanische Staatsbürger Carl Schurz und Otto von Bismarck in Berlin zusammen. Schurz hat diese Situation in seinen Lebenserinnerungen, wie auch das erste Treffen mit Lincoln, beschrieben. Zwei Welten, zwei Gegensätze, auch im Äußeren, hier der Monarchist in der preußischen, wenn auch aufgeknöpften Generalsuniform, und dort der schlichte, in einen zerknitterten Mantel gekleidete Abraham Lincoln im Dritter-Klasse-Zugabteil. Man würde sich wünschen, dass solche Beschreibungen in den Unterricht der Schulen aufgenommen würden, als verdichtete mentalitätsgeschichtliche Situationen, aber auch wegen des vorbildlichen Stils, in dem sie erzählt werden. Carl Schurz schreibt ein verbales, wortgenaues, syntaktisch bewegliches Deutsch, das von dem grimmigen Sprachkritiker Karl Kraus hoch gelobt und zitiert wurde.
1865 nimmt Carl Schurz seinen Abschied aus dem aktiven Dienst in der US-Armee, gründet eine Zeitung und engagiert sich in der Republikanischen Partei. Er wird 1869 Senator von Missouri und 1877, unter dem Präsidenten Rutherford B. Hayes, Innenminister der Vereinigten Staaten. In dieser Funktion entzieht er dem Militär die Zuständigkeit für die indigene Bevölkerung und unterstellt diese der zivilen Verwaltung. Zugleich setzt er sich für deren schulische Bildung ein. Damals wurde er von den Siedlern als „Indianerfreund“ diffamiert, heute wird sein von der europäischen Aufklärung geleitetes Erziehungsprogramm von postkolonialen Kritikern als Zerstörung indigener Kultur –verständlich, aber zuweilen recht unhistorisch – in Frage gestellt.
Dieser unbestechliche Demokrat bekämpft nach seiner Amtszeit die Korruption in der republikanischen Partei und wendet sich später gegen die imperialistische Politik Theodore Roosevelts, die auf Kuba und Asien ausgerichtet ist. Er bleibt, liest man seine Lebenserinnerungen, ein genauer, auch selbstkritischer Beobachter der politischen Entwicklung Amerikas, der beides schreibend zusammenführt: die zeitgeschichtlichen Ereignisse mit deren Ursachen sowie die Besonderheit der jeweiligen handelnden Personen. Ein unangepasster Denker und Handelnder, der seinem Gewissen und der Überzeugung verpflichtet bleibt, dass Frieden und Freiheit allein in einer demokratischen Gesellschaft verwirklicht und gesichert werden können – in der Alten wie in der Neuen Welt.
Carl Schurz stirbt am 14. Mai 1906 in New York. Sein Freund Mark Twain lobt in einem Nachruf die unbefleckte Ehrenhaftigkeit, seinen unangreifbaren Patriotismus, seine hohe Intelligenz, seinen Scharfsinn – und nennt ihn seinen Lotsenbruder.
Im Jahr 2022 hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue, dem Schloss der Hohenzollern, die 1849 die demokratische Bewegung zusammenschießen ließen, ein Denkmal für Carl Schurz aufstellen lassen. Eine überfällige, demokratische Erweiterung im deutschen Geschichtsbild.
In Mainz angekommen, erfuhr ich von einem Mitglied des dortigen demokratischen Vereins, dass Kinkel bereits durch die Stadt passiert sei, um nach der Pfalz zu gehen; der Mainzer Volksführer Zitz1, der ein rheinhessisches Korps organisiert habe, um den Pfälzern zu Hilfe zu ziehen, und augenblicklich in Kirchheimbolanden stehe, könne mir wahrscheinlich Näheres sagen. So machte ich mich denn zu Fuß nach Kirchheimbolanden auf den Weg, mein Gepäck in einem Tornister auf dem Rücken tragend. In der kleinen Stadt Kirchheimbolanden fand ich Zitz, einen hochgewachsenen, stattlichen Mann inmitten seiner, wie es schien, wohlausgerüsteten und auch einigermaßen disziplinierten Freischar. Das Lager machte keinen üblen Eindruck. (Zitz wurde wenige Jahre später in New York bekannt als Mitglied der Advokatenfirma Zitz und Kapp.) Nur hatte die Artillerie, die aus drei oder vier kleinen Böllern bestand, wie man sie zum Knallen bei Festlichkeiten gebraucht, etwas Spielzeugartiges. Von Zitz erfuhr ich, dass Kinkel nach Kaiserslautern, der revolutionären Hauptstadt der Pfalz, gegangen sei, um der dort sitzenden provisorischen Regierung seine Dienste anzubieten. So wanderte ich denn weiter nach Kaiserslautern. Dort fand ich auch sogleich Kinkel und Anneke, beide im besten Humor. Sie begrüßten mich herzlich und quartierten mich im Gasthof Zum Schwan ein, wo ich vorläufig, wie Kinkel sagte, mich redlich nähren und einen guten pfälzischen Nachtschlaf genießen sollte; am nächsten Tage werde man mir schon etwas zu tun geben. Weiterlesen
Am anderen Morgen war ich früh auf den Beinen, erfrischt und tatendurstig. Mit besonderer Begierde beobachtete ich, wie ein in Aufstand befindliches Volk sich in der äußeren Erscheinung ausnahm. Ich fand, dass die Gäste im Wirtshaus ruhig frühstückten, wie sonst. Ich hörte sagen, dass der Sohn des Schwanenwirts dieser Tage seine Hochzeit feiern werde und dass große Vorbereitungen im Gange seien. Auf den Straßen ging es allerdings recht lebhaft zu – hier Leute, die ihre gewöhnlichen·Geschäfte zu besorgen schienen, da Trupps von jungen Männern in bürgerlicher Kleidung mit Musketen auf den Schultern, die offenbar zu der in der Bildung begriffenen Volkswehr gehörten; dazwischen Soldaten in der bayerischen Uniform, die zum Volke übergegangen waren – und sogar Polizisten, leibhaftige Gendarmen in ihrer Amtstracht, mit dem Säbel an der Seite und augenscheinlich in der Ausübung der gewöhnlichen Funktionen des Sicherheitsdienstes. Nun waren meinem von Rheinpreußen hergebrachten Gefühl die Begriffe „Gendarm“ und „Freiheit“ unvereinbar, und es kostete den Schwanenwirt einige Mühe, mich verstehen zu machen, dass diese Gendarmen sich auf die Reichsverfassung hatten einschwören lassen, nun der provisorischen Regierung dienten und überhaupt ganz gute Kerle seien. Überhaupt fand ich, obgleich unzweifelhaft die Führer ihre sehr sorgenvollen Stunden hatten, die Bevölkerung im Ganzen in einer in hohem Grad gemütlich-heiteren Stimmung, den Reiz des Augenblicks rückhaltlos genießend, scheinbar ohne sich viel mit dem Gedanken an das zu quälen, was der kommende Tag bringen werde. Das war eine allgemeine Sonntagsnachmittagslaune, ein wahrer Picknickhumor. (…)
Bei dem großen Völkerschacher auf dem Wiener Kongress nach den napoleonischen Kriegen war die Rheinpfalz an das Königreich Bayern gefallen. Aber wie sie geographisch nicht mit Altbayern zusammenhing, so hatte sich dort auch kein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit dem Königreich entwickeln wollen. Ein wirklicher bayerischer Patriotismus wollte in der Pfalz nicht wachsen. Als nun die bayerische Regierung auch altbayerische Beamte in die Pfalz schickte, um die Pfälzer regieren zu helfen, wurden die gegenseitigen Beziehungen noch unfreundlicher. Die „hungrigen Altbayern“, hieß es, würden nach der reichen Pfalz geschickt, um sich füttern zu lassen. Das Verhältnis war demjenigen, das zwischen der preußischen Rheinprovinz und Altpreußen existiert hatte, nicht unähnlich. Die Pfälzer waren daher in beständiger Opposition gegen Altbayern, und diese Opposition würde hingereicht haben, sie in die Reihen der Liberalen zu treiben, wäre nicht das geweckte, lebhafte, aufgeklärte Völkchen von Natur aus zu einer liberalen Denkweise disponiert gewesen. Dass dieser Liberalismus bei den Pfälzern einen entschieden deutschnationalen Charakter trug, versteht sich von selbst. In der Tat hatte sich eine der berühmtesten nationalen Demonstrationen anfangs der dreißiger Jahre, das Hambacher Fest, auf pfälzischem Boden abgespielt, und unter den Führern der nationalen Bewegung gab es immer Pfälzer in vorderster Reihe.
Als nun der König von Bayern die von dem Frankfurter Nationalparlament gemachte Verfassung anzuerkennen verweigerte, brach in der Pfalz sofort die allgemeine Entrüstung in hellen Flammen aus. Es verstand sich bei den Pfälzern von selbst, dass, wenn der König von Bayern nicht deutsch sein wollte, die Pfalz aufhören müsse, bayerisch zu sein. Am 2. Mai wurde in Kaiserslautern eine große Volksversammlung abgehalten, in der alle liberalen Vereine der Pfalz vertreten waren. Diese Versammlung ernannte einen Landesverteidigungsausschuss, welcher den gefassten Beschlüssen gemäß die Regierung der Provinz in die Hände nehmen und für die Organisierung einer bewaffneten Macht sorgen sollte. (…)
Die heillose Verworrenheit, welche die Weigerung des Königs von Preußen, die Reichsverfassung und die Kaiserkrone anzunehmen, über Deutschland gebracht hatte, trat nun krass zutage. Wie schon erwähnt, forderte das Nationalparlament am 4. Mai durch Beschluss „die Regierungen, die gesetzgebenden Körper, die Gemeinden der Einzelstaaten, das gesamte deutsche Volk auf, die Verfassung des deutschen Reichs zur Anerkennung und Geltung zu bringen“. Da nun der König von Bayern die Reichsverfassung anzuerkennen verweigerte, so fühlten die Pfälzer mit vollem Recht, dass sie, indem sie sich gegen die bayerische Regierung erhoben, im Sinne des Beschlusses des Nationalparlamentes handelten – in der Tat, dass sie einem Befehl der höchsten nationalen Autorität in Deutschland zu gehorchen suchten. Der Landesausschuss wandte sich also in durchaus logischer Weise durch die pfälzischen Abgeordneten im Nationalparlament an dieses und an die Provisorische Reichszentralgewalt um Anerkennung und Schutz. Die Reichszentralgewalt, an deren Spitze, wie bekannt, der österreichische Erzherzog Johann stand, schickte darauf einen Reichskommissar nach der Pfalz, um an Ort und Stelle „im Namen der Reichsgewalt alle zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Gesetze in jenem Land erforderlichen Maßregeln zu ergreifen“ und insbesondere Fürsorge zu treffen, dass gewisse vom Landesausschuss gefassten Beschlüsse wieder aufgehoben werden möchten. Der Reichskommissar erklärte auch die betreffenden Beschlüsse für aufgehoben, „bestätigte“ aber den „Landesausschuss für Verteidigung und Durchführung der deutschen Reichsverfassung“ und erklärte denselben für berechtigt, die Volkswehr zu organisieren, zu bewaffnen und auf die Reichsverfassung zu vereidigen und „gegen gewaltsame Angriffe auf die Reichsverfassung in der Pfalz äußerstenfalls selbständig einzuschreiten“. Damit war nun dem Erzherzog-Reichsverweser keineswegs gedient.
Der Erzherzog Johann war ursprünglich dadurch, dass er eine Bürgerliche geheiratet und dass er sich auch durch politisch freisinnige Äußerungen bei dem österreichischen Hof missliebig gemacht, in den Geruch liberaler Gesinnungen gekommen und bei dem großen Publikum populär geworden. Dies hatte ihm im Jahre 1848 die Wahl zum Amt des Reichsverwesers eingetragen. Es war nun nicht unnatürlich, dass ihn darauf der Wunsch und die Hoffnung erfasste, er möge selbst die deutsche Kaiserkrone empfangen. Die Wahl des Königs von Preußen enttäuschte ihn gewaltig, und er machte seinem Unmut dadurch Luft, dass er dem Präsidium des Nationalparlaments sofort seine Abdankung von dem Reichsverweser-Amt ankündigte. Doch ließ er sich überreden, diese Abdankung vorläufig zurückzuhalten, und er tat dies denn auch umso williger, als er von dem österreichischen Hof die dringende Weisung empfing, ein so wichtiges Amt, solange es bestehe, nicht fahrenzulassen, da er darin den dynastischen Interessen Österreichs sehr wichtige Dienste leisten könne. Das dynastische Interesse Österreichs wurde aber damals so verstanden, dass unter keiner Bedingung ein König von Preußen deutscher Kaiser werden und dass überhaupt keine Konstituierung des deutschen Reichs, in der nicht die österreichische Gesamtmacht Platz fände und die Führerrolle spielte, zustande kommen dürfe. Die vom Nationalparlament gemachte Reichsverfassung war also dem österreichischen Hof ein Gräuel, und ihre Einführung musste mit allen Mitteln verhindert werden. Nun mag der Liberalismus des Erzherzogs Johann ursprünglich immer so echt gewesen sein – gewiss ist, dass ihm das monarchistische Interesse im Allgemeinen und das österreichische im Besonderen viel mehr am Herzen lag als die Reichsverfassung und die deutsche Einheit.
Da stellte sich denn folgende wahrhaft groteske Lage der Dinge heraus: Das deutsche Nationalparlament hatte sich in der Provisorischen Zentralgewalt, an deren Spitze der Reichsverweser Erzherzog Johann gestellt worden war, ein exekutives Organ gegeben, um seinem Willen Achtung zu verschaffen und seine Beschlüsse praktisch durchzuführen. Die bei weitem wichtigste seiner Willensäußerungen bestand in der von ihm gemachten deutschen Reichsverfassung und der Wahl des Königs von Preußen als deutscher Kaiser. Der König von Preußen weigerte sich, die Reichsverfassung als zu Recht bestehend anzuerkennen und die auf ihn gefallene Kaiserwahl anzunehmen. Das Nationalparlament forderte darauf nicht nur alle deutschen Regierungen, sondern auch die gesetzgebenden Körper und die Gemeinden der deutschen Einzelstaaten, ja, das ganze deutsche Volk auf, die Reichsverfassung zur Anerkennung und Geltung zu bringen. Das Volk der Pfalz tat genau das, wozu das Nationalparlament das deutsche Volk aufforderte. Es stand für die Reichsverfassung auf gegen den König von Bayern, welcher der Reichsverfassung seine Anerkennung versagte. Ein von der Reichszentralgewalt in die Pfalz geschickter Reichskommissar fühlte sich durch seine Loyalität dem Nationalparlament gegenüber und durch die Logik der Umstände gezwungen, den pfälzischen Landesausschuss für Verteidigung und Durchführung der Reichsverfassung zu bestätigen und zur Zurückweisung gewaltsamer Angriffe auf die Reichsverfassung für berechtigt zu erklären. Und was tat darauf der Reichsverweser, der zu dem Zwecke geschaffen worden und dessen oberste Pflicht darin bestand, den Willen des Nationalparlaments und besonders die Reichsverfassung zur Anerkennung und Geltung zu bringen? Er rief den Reichskommissar sofort zurück und schickte sich an, die Volksbewegung, die in Übereinstimmung mit dem Aufruf des Nationalparlaments zur Verteidigung und Durchführung der Reichsverfassung begonnen worden war, mit Waffengewalt zu unterdrücken. Und zu diesem Zweck wurden hauptsächlich preußische Truppen gewählt – Truppen desselben Königs, der im März 1848 feierlich versprochen hatte, sich an die Spitze der nationalen Bewegung zu stellen und Preußen in Deutschland aufgehen zu lassen, der dann zum deutschen Kaiser gewählt worden und nun diejenigen totzuschießen bereit war, die ihn tatsächlich zum Kaiser machen wollten.
Es ist zur Verteidigung dieser unerhörten Handlungsweise gesagt worden, dass dem Volksaufstand für die Reichsverfassung in der Pfalz und besonders demjenigen in Baden starke republikanische Tendenzen, Umsturzgelüste, beigemischt waren. Das ist richtig. Es ist aber ebenso wahr, dass, hätten die deutschen Fürsten in loyaler Weise, wie sie im März 1848 dem deutschen Volke das volle Recht gegeben hatten von ihnen zu erwarten, die Reichsverfassung angenommen, sie alle republikanischen Bestrebungen in Deutschland brachgelegt haben würden. Das deutsche Volk würde im Ganzen und großen zufrieden gewesen sein; ja, es würde sich unzweifelhaft sogar einige Änderungen der Reichsverfassung im monarchischen Sinne haben gefallen lassen. Und es ist nicht weniger wahr, dass die Weise, in welcher die Machthaber nach so vielen schönen Versprechungen die Hoffnung des deutschen Volkes auf nationale Einigung zu vereiteln suchten, nur zu gut geeignet war, allen Glauben an die nationale Gesinnung und die Loyalität der Fürsten zu zerstören und die Meinung zu verbreiten, dass nur auf republikanischem Wege eine einheitliche deutsche Nation geschaffen werden könne. Die Haltung des Königs von Preußen sowie der Könige von Bayern, Hannover und Sachsen stellten den national gesinnten Deutschen vor die klare Alternative, entweder alle deutschen Einheitsbestrebungen und alles, was damit an nationaler Freiheit, Macht und Größe zusammenhing, vorläufig aufzugeben oder dieselben auf dem Wege weiterzuführen, der von den Regierungen als revolutionär bezeichnet wurde. Die klägliche Geschichte Deutschlands während des nächsten Dezenniums hat schlagend bewiesen, dass diejenigen, welche die Situation im Jahre 1849 im Lichte dieser Alternativen auffassten, sie richtig auffassten.
Kehren wir nun zur Pfalz nach der Abberufung des Reichskommissars zurück. Zuerst wurden mit kleinen Truppenkörpern Versuche gemacht, der pfälzischen Bewegung Einhalt zu tun. Da dies jedoch nicht gelang und unterdes auch durch den Aufstand des Volkes und der Armee in Baden die Lage der Dinge viel ernster geworden war, so fing die preußische Regierung an, ein paar Armeekorps mobilzumachen und sich auf einen förmlichen Feldzug vorzubereiten. Es waren gerade diese Vorbereitungen, die durch die verschiedenen Aufstandsversuche in den preußischen Westprovinzen hatten verhindert werden sollen. Die Pfalz blieb nun mittlerweile eine Zeitlang unangegriffen, und das gutmütige, zu sanguinischen Anschauungen geneigte Völkchen sah in dieser zeitweiligen Ruhe ein Zeichen, dass die Fürsten, auch der König von Preußen, sich doch scheuten, einen offenen Waffengang zu unternehmen, weil sich für die große Sache der deutschen Einheit und Freiheit wahrscheinlich die anderen Völkerschaften ebenso begeistern würden wie die Pfälzer und die Badenser. Man gab sich daher gern dem Glauben hin, dass die Erhebung ebenso heiter enden werde, wie sie begonnen hatte; und dies erklärt die Tatsache, dass die lustige Stimmung inmitten der revolutionären Ereignisse, die ich als Picknickhumor beschrieb, eine gute Weile vorhielt. Nicht wenige der Führer wiegten sich auch in diese Vertrauensseligkeit ein, und als nun der Landesausschuss gar den offiziellen Titel einer „provisorischen Regierung“ annahm, da freute man sich des Gefühls, dass nun die „Fröhliche Pfalz, Gott erhalt's“ der bayerischen Wirtschaft für immer ledig sei und als hübsche kleine Republik und Bestandteil des großen deutschen Freistaates sich fortan werde ersprießlich selbst regieren können.
Die Verständigeren und Weitersehenden verhehlten sich jedoch nicht, dass, wie die Dinge sich nun einmal gestaltet hatten, es sich hier um einen Entscheidungskampf mit einer antinationalen und antiliberalen Reaktion handle, die bei dieser Gelegenheit ihre ganze wohlorganisierte Macht, wenn nötig, bis zu den letzten Reserven aufbieten werde, und dass dieser Macht gegenüber sich die Hilfsmittel der Pfalz und Badens bedenklich gering ausnahmen. (…)
Es würde wahrscheinlich nicht schwer gewesen sein, in der Pfalz ein aus rüstigen jungen Leuten bestehendes Armeekorps von zwanzig- bis fünfundzwanzigtausend Mann zu bilden, wäre die provisorische Regierung mit dem nötigen Kriegszeug versehen gewesen. Freiwillige meldeten sich in Menge; aber da man ihnen keine Musketen in die Hände geben, sondern sie nur darauf verweisen konnte, sich so gut es ging mit Sensen und Spießen zu bewaffnen, so verliefen sich viele davon. Ein Versuch, Musketen von Belgien einzuführen, misslang, da man naiverweise die Ladung durch preußisches Gebiet den Rhein herauf hatte kommen lassen, wo sie natürlich von den wachsamen Preußen abgefasst wurde. Eine Überrumpelung der in der Pfalz gelegenen Festung Landau, die bedeutende Vorräte enthielt, schlug ebenfalls fehl. So blieb denn der Waffenmangel eine der drückendsten Sorgen der provisorischen Regierung. (…)
Nach etwa sechswöchentlicher Arbeit hatte man in der Pfalz nicht mehr als sieben- bis achttausend Mann zum großen Teil schlecht bewaffneter und durchweg schlecht disziplinierter Truppen. In Baden war man viel besser bestellt. Die gesamte Infanterie und Artillerie sowie der größte Teil der Kavallerie des Großherzogtums Baden hatten sich der Volksbewegung angeschlossen und präsentierten ein wohlausgerüstetes Armeekorps von etwa fünfzehntausend Mann. Zugleich war die Festung Rastatt mit ihren Waffen-, Munitions- und Montierungsvorräten in die Hände der Aufständischen gefallen. Neugebildete Organisationen konnten also bequem mit dem Nötigen versehen werden, und so hätte sich dort ohne allzu große Schwierigkeit eine mehr oder minder schlagfähige Armee von vierzig- bis fünfzigtausend Mann herstellen lassen. Freilich hatten sich, mit wenigen Ausnahmen, die Offiziere zum Großherzog gehalten und von ihren Truppen getrennt. Aber ihre Stellen waren mit avancierten Unteroffizieren besetzt worden, und unter diesen gab es tüchtige Leute in hinreichender Anzahl, um unter den Liniensoldaten die Disziplin einigermaßen aufrechtzuerhalten. So erschien denn der badische Aufstand in ziemlich stattlicher Rüstung.
Aber die pfälzischen und badischen Führer hätten von vornherein mit der Tatsache rechnen müssen, dass die äußerste Anstrengung der Kräfte der beiden kleinen Länder nicht hinreichen konnte, der vereinigten Macht der deutschen Fürsten oder selbst Preußen allein die Spitze zu bieten. Es gab keine Hoffnung des Erfolges, wenn sich nicht die Volkserhebung über Baden und die Pfalz hinaus auf das übrige Deutschland ausbreitete.
Ich kann mich nicht rühmen, die Situation damals so klar durchschaut zu haben wie später. Freilich hatte ich eine Ahnung davon; aber dann tröstete ich mich mit dem Gedanken, die Führer, viel ältere Leute als ich, müssten doch besser wissen, was zu tun sei; und schließlich hielt mich mein hoffnungsvoller Jugendmut aufrecht, der mir wieder und wieder sagte, eine so gerechte Sache wie die unsrige könne unmöglich untergehen. Schon am Tage nach meiner Ankunft in Kaiserslautern hatte ich mich in eins der Volkswehrbataillone, die organisiert wurden, als Soldat wollen einreihen lassen. Aber Anneke riet mir, damit nicht zu eilig zu sein, sondern mich ihm anzuschließen; da er Chef der pfälzischen Artillerie sei, so könne er mir eine meinen Fähigkeiten mehr angemessene Stellung verschaffen. In der Tat brachte er mir ein paar Tage darauf ein Leutnantspatent, das er mir von der provisorischen Regierung erwirkt hatte, und so wurde ich Aide de camp im Stab des Artilleriechefs. Kinkel fand Verwendung als einer der Sekretäre der provisorischen Regierung. Die pfälzische Artillerie bestand nur aus den Böllern der rheinhessischen Freikorps, aus einem halben Dutzend ähnlicher kleiner Kanonen, von denen man sagte, sie würden im Gebirgskrieg recht nützlich sein, und aus einer später von der badischen provisorischen Regierung erstandenen Sechspfünderbatterie. (…)
Der Angriff, den die fröhlichen Pfälzer, wenigstens viele davon, so lange für unwahrscheinlich gehalten hatten, kam nun wirklich. Am 12. Juni rückte eine Abteilung preußischer Truppen über die Grenze. Wären die Flüche, die das sonst so gutmütige Völkchen den Preußen entgegenschleuderte, alle Kanonenkugeln gewesen, so hätte das preußische Korps schwerlich standhalten können. Aber die wirklichen Streitkräfte, über welche die provisorische Regierung der Pfalz gebot, waren so gering und befanden sich in einem so wenig schlagfertigen Zustand, dass an eine erfolgreiche Verteidigung des Landes nicht zu denken war. Man musste daher ein Zusammentreffen mit den Preußen vermeiden; und so kam es, dass die erste militärische Operation, an der ich teilnahm, in einem Rückzug bestand.
Einige Tage vorher hatte mein Chef, der Oberstleutnant Anneke, mich instruiert, zu jedem Augenblick marschbereit zu sein, was mir nicht schwerfiel, da mein Gepäck sehr bescheiden war. Es wurde mir auch ein Pferd zugewiesen, ein hübsches, hellbraunes Tier; und da ich das Reiten noch nicht verstand, so schickte mich Anneke in eine Reitbahn, wo ein Reitmeister mich aufsitzen hieß, mir in kurzen Worten den Schluss mit den Beinen und die Handgriffe der Führung erklärte, worauf er mit seiner Peitsche auf das Pferd einhieb, das in ziemlich wilden Sätzen mit mir umhersprang, bis ich seiner mächtig wurde. „So“, sagte der Reitmeister, „jetzt haben Sie genug für diese Gelegenheit. Das andere lernen Sie schon auf dem Marsch.“ Ich wurde auch mit einer Kavalleriereithose ausgestattet, die so schwer mit Leder besetzt war, dass sich nur mit Mühe darin zu Fuß gehen ließ. Der Reitmeister hatte recht gehabt. Die fortwährende Übung im aktiven Dienst machte mich bald zu einem sattelfesten und nicht ungeschickten Reiter.
Obgleich der Einmarsch der Preußen und der Befehl zum Rückzuge der pfälzischen Truppen von den Wohlunterrichteten schon mehrere Tage erwartet worden, so hatten diese Ereignisse doch die Wirkung, die gemütliche Verwirrung, die seit dem Ausbruch des Aufstandes in Kaiserslautern geherrscht hatte, bedeutend zu erhöhen und zu einer recht ungemütlichen zu machen. Des Befehlens und Anordnens und Widerrufens von Befehlen war kein Ende, und das Durcheinander wuchs von Stunde zu Stunde, bis es endlich zum wirklichen Aufbruch kam. Wenn ich nicht irre, war es in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni. Mit unserer Artillerie gab's allerdings nicht viel Schwierigkeit, da sie, wie schon erzählt, aus sehr wenigen Stücken bestand. Um zwei Uhr nachts stiegen wir zu Pferde. Ein Nachtmarsch ist fast immer eine trübselige Geschichte, besonders aber ein Nachtmarsch rückwärts. Doch muss ich gestehen, dass mich das dumpfe Rollen der Räder auf der Straße, das summende und schurrende Geräusch der Marschkolonne, das leise Schnauben der Pferde und das Klirren der Säbelscheiden in der Finsternis als etwas besonders Romantisches berührte. Darin fand ich viel Sympathie bei der Frau meines Chefs, Mathilde Franziska Anneke, einer noch jungen Frau von auffallender Schönheit, vielem Geist, großer Herzensgüte, poetisch feurigem Patriotismus und ausgezeichneten Charaktereigenschaften, die ihren Mann auf diesem Zuge zu Pferde begleitete.
Mit Sonnenaufgang nach diesem ersten Nachtmarsch fanden wir uns bei Frankenstein in einem scharf eingeschnittenen Tal zwischen mittelhohen Bergrücken, wo wir quer über die Straße nach Neustadt eine Defensivstellung einnahmen. Ein kalter Morgen bringt unter solchen Umständen ein Gefühl durchaus unromantischer Nüchternheit mit sich, und ich machte die Erfahrung, dass dann ein warmer Trunk, sei der Kaffee auch noch so dünn, und ein Stück Brot zu den großen Wohltaten des Lebens gehören. Die Preußen drängten nicht scharf nach, und wir blieben den Tag über durchaus ungestört bei Frankenstein im Biwak. (…) Hier und da erscholl der Ruf, dass man nun die „sakermentschen Preußen“ erwarten solle. Aber der Rückzug wurde doch fortgesetzt und die Pfalz ohne Schwertstreich gänzlich aufgegeben. Am 19. Juni gingen wir, etwa sieben- bis achttausend Mann stark, bei Knielingen über den Rhein auf badisches Gebiet und marschierten nach Karlsruhe.
Unser Einzug in die saubere, geschniegelte Hauptstadt des Großherzogtums Baden brachte unter den Einwohnern eine Sensation hervor, die dem pfälzischen Korps von Freiheitskämpfern keineswegs schmeichelhaft war. Die an das schmucke großherzogliche Militär gewöhnten Karlsruher Bürger schienen das Malerische und Romantische in dem Aussehen der pfälzischen Truppen durchaus nicht zu würdigen, sondern eher geneigt zu sein, ihre Türen und Läden zu schließen und ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen, wie man sich vor einer Räuberbande zu retten sucht. Wenigstens trugen die Gesichter vieler der Leute, die unseren Einmarsch beobachteten, unverkennbar den Ausdruck entschiedenen Widerwillens und ängstlicher Besorgnis. Wir trösteten uns mit dem Gedanken, der auch recht kräftigen Ausdruck fand, dass die Einwohnerschaft dieser Residenzstadt hauptsächlich aus Hofgesinde und Beamtenvolk bestehe und dass sie im Grunde des Herzens gut großherzoglich gesinnt sei und die Revolution grimmig hasse, wenn auch manche davon in den letzten Wochen die Republikaner gespielt hätten. (…) Noch an demselben Tage wurden uns Lager außerhalb der Stadt angewiesen, und schon am 20. Juni marschierten wir nordwärts zur Unterstützung der badischen Armee, die unterdessen ins Gedränge gekommen war.
Diese badische Armee hatte die Nordgrenze des Großherzogtums gegen den Reichsgeneral Peucker2 verteidigt. Gerade beim Ausbruch der Feindseligkeiten erhielt sie den polnischen General Mieroslawski3 zum Oberkommandeur. Er war ein noch junger Mann, hatte im letzten polnischen Aufstand Fähigkeit und Bravour bewiesen, besaß aber keine Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse und konnte nicht deutsch sprechen. Jedenfalls war er dem alten Sznayde4 weit vorzuziehen. Am 20. Juni gingen die Preußen bei Philippsburg von der Pfalz aus über den Rhein und kamen so der badischen Armee in den Rücken. Miroslawski wendete sich mit einer raschen Bewegung gegen sie, hielt sie durch einen entschlossenen Angriff bei Waghäusel fest und führte dann einen geschickten Flankenmarsch aus, welcher ihn zwischen den Preußen und den Peuckerschen Reichstruppen durchführte und mit dem pfälzischen Korps und den vom Oberlande herankommenden badischen Reserven in Verbindung brachte. Das Gefecht bei Waghäusel war für die badischen Truppen keineswegs ein unrühmliches. Wir hörten den Kanonendonner, als wir über Bruchsal heranmarschierten, und bald gingen auch Gerüchte von einem großen über die Preußen erfochtenen Sieg um. Die weitere Nachricht, dass Mieroslawski auf dem Rückzug sei, die württembergische Grenze entlang, und dass wir seine Flanke zu decken hätten, störte uns wenig in dem Glauben an den „Sieg bei Waghäusel“, dessen Früchte, wie es hieß, durch den „Verrat“ des Dragonerobersten, der den geschlagenen Feind verfolgen sollte, verlorengegangen seien. Am 23. Juni rückten wir nach Ubstadt vor, und dort empfingen wir die Kunde, dass wir am nächsten Morgen mit dem preußischen Vortrab zusammentreffen und uns zu schlagen haben würden. Die Aufträge, die ich von meinem Chef empfing, hielten mich bis nach Einbruch der Dunkelheit zu Pferde, und es war spät, als ich mein Quartier im Wirtshaus zu Ubstadt erreichte.
Auch am anderen Morgen, dem Morgen vor der Schlacht, wollte mir nicht feierlich zumute werden. Es schien mir fast, als ob über solche Stimmungen sehr viel Unwirkliches fantasiert würde. In meinem späteren Leben habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie allerdings vorkommen, aber doch nur ausnahmsweise. Gewöhnlich wenden sich die Gedanken am Morgen vor der Schlacht einer Menge von Dingen prosaischer Natur zu, unter denen das Frühstück eine nicht unwichtige Stelle einnimmt. So ging es uns auch an jenem Morgen in Ubstadt. Wir waren beizeiten im Sattel und sahen bald in einiger Entfernung vor unserer Front blinkende Lanzenspitzen auftauchen, die sich uns mit mäßiger Schnelligkeit näherten. Dies bedeutete, dass die Preußen eine oder mehrere Schwadronen Ulanen als Plänkler vorgeschickt hatten, denen die Infanterie und Artillerie demnächst zum Angriff folgen würden. So verschwanden denn die Ulanen, nachdem sie aus ihren Karabinern einige Schüsse abgegeben, die von unserer Seite erwidert wurden, und dann entwickelte sich immer lebhafter das Geknatter des Infanteriefeuers. Bald wurden auch auf beiden Seiten Geschütze aufgefahren, und die Kanonenkugeln flogen mit ihrem eigentümlichen Sausen herüber und hinüber, ohne viel Schaden zu tun. Anfangs war meine Aufmerksamkeit gänzlich in Anspruch genommen durch die Befehle, die mein Chef mir zu überbringen oder auszuführen gab. Aber nachdem unsere Artillerie postiert war und wir ruhig zu Pferde in ihrer Nähe hielten, hatte ich Muße genug, mir meine Gedanken und Gefühle zum Bewusstsein kommen zu lassen. Ich erlebte da wieder eine Enttäuschung. Ich war zum ersten Mal im Feuer. Ganz ruhig fühlte ich mich nicht. Die Nerven waren in nicht gewöhnlicher Erregung. Aber diese Erregung war weder die der heroischen Kampfesfreude noch die der Furcht. Da die feindlichen Geschütze zunächst ihr Feuer auf unsere Artillerie richteten, so sauste eine Kanonenkugel nach der andern dicht über unsere Köpfe, wo wir standen. Ich fühlte zuerst eine starke Neigung, wenn ich dies Sausen recht nahe über mir hörte, mich zu ducken; aber es fiel mir ein, dass sich dies für einen Offizier nicht schicke, und so blieb ich denn stramm aufrecht. Ebenso zwang ich mich, nicht zu zucken, wenn eine Musketenkugel dicht bei meinem Ohr vorbeipfiff. Die Verwundeten, die vorübergetragen wurden, erregten mein lebhaftes Mitgefühl; aber der Gedanke, dass mir im nächsten Augenblick ähnliches passieren könne, kam mir nicht in den Sinn. Ich sah ein Volkswehrbataillon, welches gegen eine feindliche Batterie geführt worden war, in Unordnung zurückkommen und sprengte, einem plötzlichen Impuls gehorchend, hinüber, um das Bataillon ordnen und wieder vorführen zu helfen – war aber auch ganz zufrieden, als ich bemerkte, wie der Bataillonsführer dies selbst besorgte. Als nun später mein Chef mich wieder mit Befehlen hin und her schickte, verging mir das bewusste Empfinden ganz, und ich dachte an nichts als den auszuführenden Auftrag und den Gang des Gefechts, wie ich ihn beobachten konnte. (…)
Übrigens war das Gefecht bei Ubstadt eine verhältnismäßig geringfügige Affäre – von unserer Seite nur dazu bestimmt, den Feind eine kurze Weile in seinem Vormarsch aufzuhalten, bis sich die badische Armee wieder in unserem Rücken geordnet haben könne, und uns langsam auf diese zurückzuziehen. Bei Ubstadt wurde diese Instruktion in ziemlich ordentlicher Weise ausgeführt. (…) Am nächsten Tag hatten wir ein ansehnliches Gefecht mit der preußischen Vorhut bei Bruchsal, welches wieder mit einem Rückzuge endete, diesmal aber nicht in gleicher Ordnung. Wie das bei Volksaufständen nicht selten ist, fingen die aufgeregten Leute an, den unglücklichen Verlauf des Unternehmens dem „Verrat“ irgendeines Führers zuzuschreiben, und bei dieser Gelegenheit erhob sich dieser Schrei gegen den armen General Sznayde, der auf dem Rückzug bei Durlach plötzlich von einer Rotte meuterischer Freischärler umringt und vom Pferd gerissen wurde. Er verschwand dann vom Schauplatze der Aktion, und die pfälzischen Truppen wurden dem badischen Armeekommando unterstellt.
An der Murglinie, den linken Flügel an die Festung Rastatt angelehnt, nahm das vereinigte badisch-pfälzische Heer seine letzte Defensivstellung und schlug sich am 28., 29. und 30. Juni teilweise recht brav, wenn auch erfolglos. Am Nachmittag des 30. Juni schickte mich mein Chef mit einem Auftrag, Artilleriemunition betreffend, in die Festung Rastatt und instruierte mich, ihn im Fort B., einer der großen Bastionen, von denen man das Gefechtsfeld draußen übersah, zu erwarten; er werde bald nachkommen. Ich entledigte mich meines Auftrags, begab mich an den von Anneke bestimmten Platz, band mein Pferd an die Lafette eines Festungsgeschützes und setzte mich auf den Wall nieder, wo ich, nachdem ich das Gefecht eine Zeitlang beobachtet hatte, trotz dem Kanonendonner fest einschlief. Als ich erwachte, war die Sonne am Untergehen. Ich fragte die umstehenden Artilleristen nach Anneke, aber niemand hatte ihn gesehen. Ich wurde unruhig und bestieg mein Pferd, um die Stadt zu verlassen und meinen Chef draußen aufzusuchen. Am Tor angekommen, empfing ich von dem wachhabenden Offizier die Nachricht, dass ich nicht mehr hinauskönne; unser Hauptkorps sei gegen Süden zurückgedrängt worden und die Festung von den Preußen vollständig eingeschlossen. Ich galoppierte nach dem Hauptquartier des Festungskommandanten auf dem Schloss und erfuhr dort die Bestätigung des Gehörten. Der Gedanke, in der Stadt bleiben zu müssen und Preußen ringsumher, traf mich wie ein unheilvolles Schicksal. Ich konnte mich nicht darein ergeben und fragte immer wieder, ob denn da gar kein Ausweg sei, bis endlich ein dabeistehender Offizier mir sagte: „Mir ist gerade so zumut wie Ihnen. Ich gehöre auch nicht hierher und habe an allen Punkten versucht durchzubrechen, aber es war umsonst. Wir müssen uns eben fügen und hierbleiben.“ Von Anneke fand ich keine Spur. Er hatte entweder die Stadt längst verlassen oder war vielleicht gar nicht hereingekommen. (…)
Dass unsere Sache, wenn nicht ein Wunder geschah, verloren war, konnte ich mir nun nicht mehr verhehlen. Und was ein solches Wunder hätte sein mögen, konnte selbst meine jugendliche Hoffnungsfreudigkeit sich nicht mehr vorstellen. Übergehen der preußischen Landwehren zum Volksheer? Das wäre nur möglich gewesen am Anfange des Feldzuges, wenn überhaupt. Nach einer Reihe von Niederlagen war diese Möglichkeit geschwunden. Ein großer Sieg der Unsrigen im Oberlande? Undenkbar, da der Rückzug von der Murglinie unzweifelhaft unsere Streitmacht mehr durch Demoralisation schwächen musste, als sie durch Zuzug verstärkt werden konnte. Große Siege der Ungarn im Osten? Aber die Ungarn waren weit entfernt und die Russen im Anzuge gegen sie. Eine neue Volkserhebung in Deutschland? Aber der revolutionäre Impuls hatte sich offenbar erschöpft. Da saßen wir denn in einer Festung, von den Preußen eingeschlossen. Eine längere Verteidigung der Festung konnte unserer Sache nicht mehr dienen – oder nur insofern, als sie bewies, dass ein Volksheer auch Mut besitzen und der militärischen Ehre Rechnung tragen kann. Aber unter allen Umständen konnte die Festung sich nur eine beschränkte Zeit halten. Und dann? Kapitulation. Und dann? Wir würden den Preußen in die Hände fallen. Nun war der Oberbefehlshaber der preußischen Truppen in Baden der Prinz von Preußen, in welchem damals niemand den später so populären und gefeierten Kaiser Wilhelm I. vermutete. Er galt zu jener Zeit für den schlimmsten Feind aller freiheitlichen Bestrebungen. Das allgemein geglaubte Gerücht, dass er es gewesen sei, der am 18. März 1848 in Berlin den Befehl gegeben habe, auf das Volk zu schießen, hatte ihm im Volksmund den Titel „der Kartätschenprinz“ eingetragen. (…)
Dass er im Jahr 1849, als seinem Bruder Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kaiserkrone angeboten wurde, zu denen gehörte, die eine günstige Erwägung dieses Anerbietens empfahlen, und dass, wäre er statt seines Bruders König von Preußen gewesen, die Krisis wahrscheinlich eine den deutschen Einheitsbestrebungen ersprießlichere Lösung gefunden haben würde, wusste man damals noch nicht. Auch würde eine solche Kunde schwerlich geglaubt worden sein, denn man hielt den Prinz von Preußen für einen ehrlichen und durchaus unverbesserlichen Absolutisten, der standhaft daran glaubte, dass die Könige von Gott eingesetzt und nur Gott Rechenschaft schuldig seien; dass das Volk nichts mit den Geschäften der Regierung zu tun haben dürfe; dass eine Auflehnung gegen die Königsgewalt einer direkten Beleidigung Gottes gleichkomme und dass es eine gebieterische Pflicht der Gewalthaber sei, über ein solches Verbrechen die erdenklich schwerste Strafe zu verhängen. So erschien der Prinz von Preußen dem Volk auch als ein fanatischer Soldat, dem die preußische Armee ein Herzensidol war – der in ihr das Schwert Gottes, das Bollwerk der Weltordnung sah, in dessen Augen ein preußisches Landeskind, das gegen die preußische Armee kämpfte, ein unsühnbares, dem Elternmord an Fluchwürdigkeit nicht nachstehendes Verbrechen beging und von dem ein solcher Verbrecher keine Gnade erwarten dürfe. Wir geborenen Preußen hatten also, wenn wir in die Hände des Prinzen Wilhelm fielen, die beste Aussicht, standrechtlich erschossen zu werden – besonders diejenigen, die wie ich gerade in den militärdienstpflichtigen Jahren standen. Und dabei erinnerte ich mich, dass ich kurz vor der Siegburger Affäre vor der königlichen Aushebungskommission hatte erscheinen müssen, welche, indem sie meine Eingabe um Zulassung als Einjährig-Freiwilliger willkürlich übersah, mich für ein Kürassierregiment bestimmte, mit Aussicht auf baldige Einberufung. Für mich würde es also gewiss keine Nachsicht geben. (…)
Da kam eines Tages – es war in der dritten Woche der Belagerung – ein preußischer Parlamentär in die Festung, der mit einer Aufforderung zur Übergabe zugleich die Nachricht brachte, dass die badisch-pfälzische Armee längst auf schweizerisches Gebiet übergetreten sei und damit aufgehört habe zu existieren; dass kein bewaffneter Insurgent mehr auf deutschem Boden stehe und dass das preußische Oberkommando irgendeinem Vertrauensmann, den die Besatzung von Rastatt hinausschicken möchte, um sich von diesen Tatsachen zu überzeugen, zur Ausführung dieses Auftrags Freiheit der Bewegung und sicheres Geleit gewähren wolle. Dieses Ereignis verursachte gewaltige Aufregung. Sofort versammelte der Gouverneur in dem Hauptsaal des Schlosses einen großen Kriegsrat, bestehend, wenn ich mich recht erinnere, aus allen Offizieren der Besatzung vom Kapitän aufwärts. Nach stürmischer Beratung wurde beschlossen, das Anerbieten des preußischen Oberkommandos anzunehmen, und Oberstleutnant Corvin5 empfing den Auftrag, die Lage der Dinge draußen zu erforschen und, falls er sie den Angaben des preußischen Parlamentärs entsprechend fände, um eine möglichst günstige Kapitulation für die Besatzung von Rastatt zu unterhandeln. (…)
Am zweiten Morgen nach Corvins Abreise wurde ich von dem Geräusch schwerer Schritte, rasselnder Säbel und verworrener Stimmen geweckt. Aus dem, was ich sah und hörte, schloss ich, dass Corvin von seiner Sendung zurückgekehrt war und dass der große Kriegsrat sich wieder versammelte. Der Gouverneur trat ein, gebot Ruhe und ersuchte Corvin, der an seiner Seite stand, vor der ganzen Versammlung seinen Bericht mündlich abzustatten. Corvin erzählte also, er sei, von einem preußischen Offizier begleitet, bis an die Grenze der Schweiz gefahren und habe sich an Ort und Stelle überzeugt, dass es in Baden keine Revolutionsarmee, ja, keinen Widerstand irgendwelcher Art gegen die preußischen Truppen mehr gäbe. Die Revolutionsarmee sei auf das schweizerische Gebiet übergetreten und habe natürlich an der Grenze ihre Waffen und ihre ganze kriegerische Ausrüstung abgeben müssen. Auch im übrigen Deutschland sei, wie er sich durch die Zeitungen unterrichtet habe, keine Spur von revolutionärer Bewegung mehr übrig, überall Unterwerfung und Ruhe. Selbst die Ungarn seien durch die russische Intervention in große Bedrängnis geraten und würden bald unterliegen müssen. Kurz, die Besatzung von Rastatt sei gänzlich verlassen und könne von keiner Seite auf Entsatz hoffen. Und schließlich, setzte Corvin hinzu, sei ihm im preußischen Hauptquartier angekündigt worden, dass das preußische Oberkommando die Übergabe der Festung auf Gnade oder Ungnade verlange und sich auf keinerlei Bedingungen einlassen werde.
Eine tiefe Stille folgte dieser Rede. Jeder der Zuhörer fühlte, dass Corvin die Wahrheit gesprochen. Endlich nahm jemand – ich erinnere mich nicht, wer – das Wort und stellte einige Fragen. Dann gab es ein Gewirr von Stimmen, in welchem man einige Hitzköpfe von „Sterben bis zum letzten Mann“ und dergleichen sprechen hörte, bis der Gouverneur einem ehemaligen preußischen Soldaten, der in der Pfalz Offizier geworden war, Gehör verschaffte. Dieser sagte, er sei so bereit wie irgendeiner, unserer Sache seinen letzten Blutstropfen zu opfern, und wir Preußen, wenn wir in die Hände der Belagerungsarmee fielen, müssten wahrscheinlich sowieso sterben. Aber er rate die sofortige Übergabe der Festung an. Tue man's heute nicht, so werde man es morgen tun müssen. Man solle nicht die Bürger der Stadt mit ihren Weibern und Kindern auch noch einer Hungersnot und einer weiteren Beschießung aussetzen, und alles dies umsonst. Es sei Zeit, ein Ende zu machen, was auch mit uns geschehen möge. – Es ging ein Gemurmel durch den Saal, dass dieser Mann vernünftig gesprochen; und so wurde denn der Beschluss gefasst, dass Corvin noch einmal versuchen solle, für die Offiziere und Mannschaften der Besatzung im preußischen Hauptquartier günstige Bedingungen zu erwirken. Wenn er aber nach gemachtem Versuch die Unmöglichkeit einsehe, solche Bedingungen zu erhalten, so solle er für die Übergabe auf Diskretion die nötigen Bestimmungen abschließen. Als wir den Saal verließen, fühlten wohl die meisten von uns, dass an etwas anderes als an eine Kapitulation auf Gnade oder Ungnade kaum zu denken sei. (…)
Um zwölf Uhr mittags sollten die Truppen aus den Toren marschieren und draußen auf dem Glacis der Festung vor den dort aufgestellten Preußen die Waffen strecken. Die Befehle waren bereits ausgefertigt. Ich ging nach meinem Quartier am Marktplatz, um meinen letzten Brief an meine Eltern zu schreiben. Ich dankte ihnen darin für alle Liebe und Sorge, die sie mir erwiesen, und bat sie, mir zu verzeihen, wenn ich ihnen ihre Ergebenheit jemals übel vergolten oder ihre Hoffnungen getäuscht hätte. Ich sagte ihnen, ich habe, meiner ehrlichen Überzeugung folgend, für die Sache des Rechts und des deutschen Volks die Waffen ergriffen, und dass, wenn es mein Los sein sollte, sterben zu müssen, es ein ehrenhafter Tod sein werde, dessen sie sich nicht zu schämen brauchten. Diesen Brief übergab ich dem guten Herrn Nusser, meinem Wirt, der mir mit Tränen in den Augen versprach, ihn der Post zu übergehen, sobald die Stadt wieder offen sein werde.
Unterdessen nahte die Mittagsstunde. Ich hörte bereits die Signale zum Antreten auf den Wällen und in den Kasernen, und ich machte mich fertig, zum Hauptquartier hinaufzugehen. Da schoss mir plötzlich ein neuer Gedanke durch den Kopf.
Ich erinnerte mich, dass ich vor wenigen Tagen auf einen unterirdischen Abzugskanal für das Straßenwasser aufmerksam gemacht worden war, der bei dem Steinmauerner Tor aus dem Innern der Stadt unter den Festungswerken durch ins Freie führte. Er war wahrscheinlich ein Teil eines unvollendeten Abzugssystems. Der Eingang des Kanals im Innern der Stadt befand sich in der Fortsetzung eines Grabens oder einer Gosse, nahe bei einer Gartenhecke, und draußen mündete er in einem von Gebüsch überwachsenen Graben an einem Welschkornfeld. Sobald diese Umstände zu meiner Kenntnis gekommen waren, hatte ich daran gedacht, dass, wenn die inneren und äußeren Mündungen dieses Kanals nicht scharf bewacht würden, Kundschafter sich durch ihn ein- und ausschleichen könnten. Ich machte Meldung davon, aber sogleich darauf kam die Unterhandlung mit dem Feind, die Sendung Corvins und die Aufregung über die bevorstehende Kapitulation, die mir die Kanalangelegenheit aus dem Sinne trieben. Jetzt im letzten Moment vor der Übergabe kam mir die Erinnerung wie ein Lichtblitz zurück. Würde es mir nicht möglich sein, durch diesen Kanal zu entkommen? Würde ich nicht, wenn ich so das Freie erreichte, mich bis an den Rhein durchschleichen, dort einen Kahn finden und nach dem französischen Ufer übersetzen können? Mein Entschluss war schnell gefasst – ich wollte es versuchen.
Ich rief meinen Burschen, der zum Abmarsch fertig geworden war.
„Adam“, sagte ich, „Sie sind ein Pfälzer und ein Volkswehrmann. Ich glaube, wenn Sie sich den Preußen ergeben, so wird man Sie bald nach Hause schicken. Ich bin ein Preuße, und uns Preußen werden sie wahrscheinlich totschießen. Ich will daher versuchen davonzukommen, und ich weiß, wie. Sagen wir also adieu!“
„Nein“, rief Adam, „ich verlasse Sie nicht, Herr Leutnant. Wohin Sie gehen, gehe ich auch.“ Die Augen des guten Jungen glänzten vor Vergnügen. Er war mir sehr zugetan.
„Aber“, sagte ich, „Sie haben nichts dabei zu gewinnen, und wir werden vielleicht große Gefahr laufen.“
„Gefahr oder nicht“, antwortete Adam entschieden, „ich bleibe bei Ihnen.“
In diesem Augenblick sah ich draußen einen mir bekannten Artillerieoffizier namens Neustädter vorübergehen. Er war wie ich in Rheinpreußen zu Hause und hatte früher in der preußischen Artillerie gedient.
„Wo gehen Sie hin, Neustädter?“ rief ich ihm durchs Fenster zu.
„Zu meiner Batterie“, antwortete er, „um die Waffen zu strecken.“
„Die Preußen werden Sie totschießen“, entgegnete ich. „Gehn Sie doch mit mir, und versuchen wir davonzukommen.“
Er horchte auf, kam ins Haus und hörte meinen Plan, den ich ihm mit wenigen Worten darlegte. „Gut“, sagte Neustädter, „ich gehe mit Ihnen.“6
(Aus: Sturmjahre. Lebenserinnerungen 1829-1852, Verlag der Nation, Berlin 1973, S. 199-236)
1 Franz Zitz (1803-1877), Jurist, war Mitglied des Vorparlament und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. Im März 1849 schied er aus dem Parlament aus, weil es ihm zu gemäßigt war, und beteiligte sich als Anführer des rheinhessischen Freikorps am pfälzisch-badischen Aufstand. Nach dessen Niederschlagung flüchtete er in die Schweiz und emigrierte dann in die USA, wo er wieder als Rechtsanwalt arbeitete.
2 Eduard von Peucker (1791-1876), preußischer General der Infanterie.
3 Ludwik Mieroslawski (1814-1878), ein polnischer Revolutionär, wurde wegen seiner militärischen Erfahrungen bei Aufständen in Polen nach Baden gerufen und zum Oberbefehlshaber der badischen Revolutionsarmee ernannt. Er schloss sich später (ab 1861) Guiseppe Garibaldis Unabhängigkeitskampf in Italien an.
4 Franz Sznayde (1790-1850), polnischer Kavallerieoffizier, übernahm im Mai 1849 den Oberbefehl über die Verbände der Aufständischen in der Rheinpfalz.
5 Otto von Corvin (1812-1886), Schriftsteller (u.a. „Der Pfaffenspiegel“), war bereits militärischer Ausbilder der Deutschen Demokratischen Legion in Paris und nahm 1848 am Heckerzug teil. Nach Übergabe der Festung Rastatt wurde er zum Tode verurteilt, das Urteil jedoch in sechs Jahre Einzelhaft umgewandelt. Nach der Haft berichtete er als freier Journalist aus Großbritannien und den USA.
6 Nach einem ersten gescheiterten Versuch am 23. Juli, der Fluchtkanal hatte sich durch heftigen Regen gefährlich mit Wasser gefüllt, gelang die Flucht vier Tage später, währenddessen sie sich versteckt gehalten hatten, tatsächlich. Ein Helfer brachte sie schließlich in seinem Kahn über den Rhein nach Elsass, von wo aus Schurz zu Fuß über Straßburg in die Schweiz entkam.
Lebenserinnerungen von Carl Schurz (3 Bände), erstmals veröffentlicht im Georg Reimer Verlag, Berlin 1906, 1907 und 1912.
Neuausgabe: Carl Schurz: Sturmjahre. Lebenserinnerungen 1829-1852, Verlag der Nation, Berlin 1973.
Neuausgabe von Band 1 und 2, herausgegeben von Daniel Göske, Wallstein, Göttingen 2015.
Joachim Maas: Der unermüdliche Rebell. Leben, Tat und Vermächtnis des Carl Schurz. Mit einem Anhang: Carl Schurz über Abraham Lincoln, Hamburg 1949.
Stefan Reinhardt: Die Darstellung der Revolution von 1848/49 in den Lebenserinnerungen von Carl Schurz und Otto von Corvin, Frankfurt am Main 1999.
Marianne und Otto Draeger: Die Carl Schurz Story. Vom deutschen Revolutionär zum amerikanischen Patrioten, Berlin 2006.
Rudolf Geiger: Der deutsche Amerikaner. Carl Schurz – Vom deutschen Revolutionär zum amerikanischen Staatsmann, Gernsbach 2007.
Walter Keßler: Carl Schurz – Kampf, Exil und Karriere, Köln 2006.
Daniel Nagel: Von republikanischen Deutschen zu deutsch-amerikanischen Republikanern. Ein Beitrag zum Identitätswandel der deutschen Achtundvierziger in den Vereinigten Staaten 1850–1861, St. Ingbert 2012.
CARL SCHURZ

Abb.: Carl Schurz als Bonner Student. Foto/Repro: Simon Rick, Euenheim; Fotoarchiv: Kreismedienzentrum Euskirchen
Frieden und Versöhnung in Freiheit, so Carl Schurz, sind die übergeordneten Ziele der Demokratie, innergesellschaftlich wie international. Aber um diese Ziele zu erreichen, müssen Widerstände gegebenenfalls auch gewaltsam überwunden werden. Die Demokratie braucht eine „Armee der Freiheit“, sie muss erkämpft werden und „wehrhaft“ bleiben, denn sie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern die stets bedrohte Ausnahme. Deren Schutz ist für Carl Schurz das Fundament jedes politischen demokratischen Realismus. Dieser Überzeugung folgte er sowohl während der 48/49er-Revolution als auch im amerikanischen Exil, wo er sich vom Revolutionär zum Staatsmann wandelte. Als General der Nordstaaten kämpfte er gegen die Sklaverei und für die Rechte der indigenen Bevölkerung. Er war Mitbegründer der Republikanischen Partei und stieg am Ende gar zum Innenminister der USA auf.
Am 02. März wird Carl Schurz in Liblar, einem Ort in der preußischen Rheinprovinz nahe Köln, als Sohn des Landschullehrers Christian Schurz und seiner Ehefrau Marianne geboren.
Der Vater gibt sein Schulmeisteramt auf, weil er die sechsköpfige Familie – Carl hat drei jüngere Geschwister – damit nicht hinreichend versorgen kann, und eröffnet eine kleine Eisenwarenhandlung. Die finanziellen Probleme werden dadurch nicht geringer, so dass Carl seine Schullaufbahn unterbrechen, muss, um als Ältester in der Familie auszuhelfen.
Gleichwohl schafft es Carl Schurz im Juli 1847, als „Externer“ das Abitur zu bestehen, und beginnt noch im selben Jahr ein Studium der Geschichte an der Universität Bonn. Hier befreundet er sich mit dem radikal „Demokratie-bewegten“ Kunst- und Kulturhistoriker Professor Gottfried Kinkel.
Schurz schließt sich der Bonner Burschenschaft „Frankonia“ an, wird deren Sprecher sowie am 1. Dezember Präsident des neu gegründeten demokratischen Studentenvereins in Bonn.
Im Mai 1849 nimmt Schurz, gemeinsam mit Kinkel, an dem Versuch teil, im nahen Siegburg das Zeughaus zu stürmen, um Aufständische mit Waffen zu unterstützen. Das Unternehmen scheitert, und Schurz flieht nach Baden, wo er als Adjutant von Fritz Anneke am Badischen Aufstand teilnimmt. Als auch dies scheitert, gelingt ihm auf abenteuerliche Weise die Flucht aus der von Preußen eingeschlossenen Festung Rastatt. Er entkommt in die Schweiz.
Gottfried Kinkel hingegen war gefangengenommen worden. Im August 1850 reist Schurz deshalb unter einem Tarnnamen und mit falschem Pass nach Deutschland ein und befreit seinen ehemaligen Professor Anfang November in einer tollkühnen Aktion aus dem Zuchthaus Spandau. Über Rostock und Warnemünde gelingt ihnen per Schiff die Flucht nach Schottland.
Aber die „Reaktion“ in Europa wird immer massiver. Also schifft sich Carl Schurz im Herbst 1852 nach New York ein, dorthin, wo die Demokratie verwirklicht scheint. Auch hier bleibt er politisch aktiv und wird zu einem einflussreichen Führer der aufstrebenden Republikanischen Partei.
Nach seinem Wahlsieg ernennt ihn der neue Präsident Abraham Lincoln zum Botschafter in Spanien. Schon bald darauf, im Januar 1862, kehrt Schurz jedoch in die USA zurück, um während des amerikanischen Bürgerkrieges in die Unionsarmee einzutreten, und steigt in kurzer Zeit zum Generalmajor und Divisionskommandeur auf.
Carl Schurz wird in den Senat der Vereinigten Staat gewählt, in dem er (bis 1875) den Bundesstaat Missouri vertritt. Hier macht er sich vor allem als Korruptionsbekämpfer einen Namen.
Der gerade ernannte US-Präsident Rutherford B. Hayes beruft Schurz als Innenminister in sein Kabinett (bis 1881). Hier macht er sich vor allem um einen Wandel der Indianerpolitik verdient, indem er die bislang militärisch dominierte Verwaltung einer zivilen Reform unterzieht.
Gemeinsam mit Persönlichkeiten wie Mark Twain oder William James gründet Schurz die „American Anti-Imperialist-League“, die sich gegen die zunehmend imperialistische Orientierung der US-amerikanischen Außenpolitik unter Präsident Theodore Roosevelt wendet.
Am 14. Mai 1906 stirbt Carl Schurz in New York, wo er auch beerdigt wird. In „Harper’s Weekly“ erscheint ein Nachruf von Mark Twain.
Uwe Timm
In Berlin gibt es neun Bismarck-Denkmäler – an Carl Schurz erinnert keins. Wie wäre die deutsche Geschichte verlaufen, wenn es umgekehrt wäre? Wenn Carl Schurz Kanzler des Deutschen Reichs geworden wäre, wenn es keine Einigung Deutschlands durch Kriege gegeben hätte, und, daraus folgend, kein Primat des Militärs und des Adels, sondern eine demokratisch-bürgerliche Verfassung mit einer konstitutionellen Monarchie? Wenn die revolutionäre Bewegung von 1848 ihr Ziel eines demokratischen Deutschlands erreicht hätte?
Man kann sagen, die Zeit war dafür nicht reif. Aber einige ihrer Protagonisten waren es, zu ihnen, den revolutionären Demokraten, gehörte Carl Schurz. Sein Denkmal steht heute in New York, imposant und ästhetisch weit beeindruckender als die Statue vom uniformierten Bismarck, der mit Pickelhaube an der Siegessäule wacht. Der New Yorker Schurz am Morningside Drive trägt Anzug und Mantel und hält als Senator und Innenminister der Vereinigten Staaten ganz zivil einen Hut in der Hand. Und das, obwohl Schurz im amerikanischen Bürgerkrieg General der Unionsarmee gewesen ist und in Schlachten wie Bull Run, Gettysburg und Chattanooga eine Freiwilligen-Division gegen die Sklavenhalter-Gesellschaft der Südstaaten geführt hat. Weiterlesen
Am Anfang eines abenteuerlichen Lebens steht der Student, der aus bürgerlichen, aber prekären Verhältnissen kommt; der Vater, ein Ladenbesitzer, musste nach einem Konkurs ins Schuldgefängnis. Der junge Carl Schurz erreicht auf Umwegen die Hochschulreife, studiert in Bonn, interessiert sich für die Französische Revolution und will ihre Leitbegriffe – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – auch in Deutschland heimisch machen. Er schreibt und agitiert, fordert die Pressefreiheit, das allgemeine Wahlrecht (noch sind die Frauen wie selbstverständlich davon ausgenommen), und er strebt die Einheit des in Fürstentümer und Hansestädte zersplitterten Deutschlands an. Ein langhaariger, schlaksiger junger Mann, der sich, beeinflusst durch seinen Professor und späteren Freund Gottfried Kinkel, an der Bonner Universität radikalisiert, der in einem lebendigen Deutsch Artikel und Aufrufe schreibt, der aufrüttelnd in der Öffentlichkeit reden kann, dem es gelingt, für ein paar Tage Bonn in republikanische Selbstverwaltung zu bringen, der einen bewaffneten Marsch nach Siegburg unternimmt, mit dem Ziel, das dortige Zeughaus zu stürmen und die darin gelagerten Waffen zu erbeuten. Preußische Husaren zersprengen den Aufmarsch der Revolutionäre.
Carl Schurz geht 1849 nach Baden, wo sich die Aufständischen versammeln, entschlossen, die in der Frankfurt Paulskirche beschlossene Reichsverfassung gegen die preußische Intervention durchzusetzen. Er kämpft als Oberleutnant in der Pfälzischen Volkswehr, die mit anderen Aufständischen in der Festung Raststatt von den Preußischen Truppen eingeschlossen wird. Nach dreiwöchiger Belagerung kapituliert die Festung. Neunzehn Aufständische werden sofort erschossen. Carl Schurz gelingt es mit einem Kameraden, durch einen Abwasserkanal zu entkommen, und kann sich nach Frankreich und von dort in die Schweiz durchschlagen.
All das ist nicht dem Hunger nach Abenteuer geschuldet, sondern entspringt dem entschlossenen Ernst seiner freiheitlichen Gesinnung, zu der das Ideal der Brüderlichkeit, also die Solidarität gehört. Sein Freund, Gottfried Kinkel, wird in Raststatt gefangengenommen und zu lebenslanger Festungshaft verurteilt. Auf Befehl des Kartätschenprinzen Wilhelm, dem späteren Kaiser Wilhelm I., wird dieses Urteil in eine unehrenhafte Zuchthausstrafe umgewandelt. Mit einer staunenswerten Sorgfalt und Energie plant Schurz die Befreiung des Freundes aus dem Zuchthaus in Spandau, reist unter falschen Namen durch Deutschland, sammelt Geld ein, besticht einen Gefängniswärter, legt den Fluchtweg aus Preußen fest, und steckt sich am Abend, die Wärter feiern in einem nahen Gasthof, ein Jagdmesser in den Gürtel und ein Paar Pistolen in die Tasche. Schurz beschreibt in seinen Lebenserinnerungen, wie sich Kinkel über das Zuchthausdach abseilt, Ziegel fallen krachend auf die nächtliche Straße, wo die Kutsche wartet und Kinkel und Schurz nach Rostock bringen wird. Von dort segeln die Freunde nach England: Das Leben im Exil beginnt. Schurz schreibt Artikel, hält Kontakt zu anderen Revolutionären, darunter, im Streit, mit Karl Marx. Im Jahr 1852 heiratet er in London Margarethe Meyer, eine politisch denkende und handelnde Frau. Viele der 48-Revolutionäre waren, das ist kennzeichnend, mit selbstständigen, sozial engagierten Frauen verbunden. Im selben Jahr wandert Schurz in die USA aus, wo Margarethe später die Kindergarten-Bewegung gründen wird.
Musste die Revolution von 1848 scheitern? Carl Schurz sieht die Gründe in der Zerstrittenheit der in der Frankfurter Paulskirche versammelten Abgeordneten. Schurz betont deren beste Absichten und das hohe Niveau der Diskussionen, kritisiert aber, wie sie sich in langen Debatten über Nebensächlichkeiten verloren und in Eigensinn und Eitelkeiten verharrten.
Tatsächlich gab es objektive Gründe, die in den divergierenden Positionen der konservativen, liberalen, demokratischen und republikanischen Abgeordneten lagen, die zudem noch verschiedene regionale Interessen vertraten. Darüber hinaus spielten die konfessionellen Unterschiede zwischen dem überwiegend evangelischen Norden und dem katholischen Süden eine Rolle. Wahrscheinlich trifft zu, was der Historikers Heinrich August Winkler vermutet, zugleich die Einheit und Freiheit in Deutschland herzustellen, war historisch eine Überforderung der deutschen Liberalen.
1868 treffen der inzwischen bekannte amerikanische Staatsbürger Carl Schurz und Otto von Bismarck in Berlin zusammen. Schurz hat diese Situation in seinen Lebenserinnerungen, wie auch das erste Treffen mit Lincoln, beschrieben. Zwei Welten, zwei Gegensätze, auch im Äußeren, hier der Monarchist in der preußischen, wenn auch aufgeknöpften Generalsuniform, und dort der schlichte, in einen zerknitterten Mantel gekleidete Abraham Lincoln im Dritter-Klasse-Zugabteil. Man würde sich wünschen, dass solche Beschreibungen in den Unterricht der Schulen aufgenommen würden, als verdichtete mentalitätsgeschichtliche Situationen, aber auch wegen des vorbildlichen Stils, in dem sie erzählt werden. Carl Schurz schreibt ein verbales, wortgenaues, syntaktisch bewegliches Deutsch, das von dem grimmigen Sprachkritiker Karl Kraus hoch gelobt und zitiert wurde.
1865 nimmt Carl Schurz seinen Abschied aus dem aktiven Dienst in der US-Armee, gründet eine Zeitung und engagiert sich in der Republikanischen Partei. Er wird 1869 Senator von Missouri und 1877, unter dem Präsidenten Rutherford B. Hayes, Innenminister der Vereinigten Staaten. In dieser Funktion entzieht er dem Militär die Zuständigkeit für die indigene Bevölkerung und unterstellt diese der zivilen Verwaltung. Zugleich setzt er sich für deren schulische Bildung ein. Damals wurde er von den Siedlern als „Indianerfreund“ diffamiert, heute wird sein von der europäischen Aufklärung geleitetes Erziehungsprogramm von postkolonialen Kritikern als Zerstörung indigener Kultur –verständlich, aber zuweilen recht unhistorisch – in Frage gestellt.
Dieser unbestechliche Demokrat bekämpft nach seiner Amtszeit die Korruption in der republikanischen Partei und wendet sich später gegen die imperialistische Politik Theodore Roosevelts, die auf Kuba und Asien ausgerichtet ist. Er bleibt, liest man seine Lebenserinnerungen, ein genauer, auch selbstkritischer Beobachter der politischen Entwicklung Amerikas, der beides schreibend zusammenführt: die zeitgeschichtlichen Ereignisse mit deren Ursachen sowie die Besonderheit der jeweiligen handelnden Personen. Ein unangepasster Denker und Handelnder, der seinem Gewissen und der Überzeugung verpflichtet bleibt, dass Frieden und Freiheit allein in einer demokratischen Gesellschaft verwirklicht und gesichert werden können – in der Alten wie in der Neuen Welt.
Carl Schurz stirbt am 14. Mai 1906 in New York. Sein Freund Mark Twain lobt in einem Nachruf die unbefleckte Ehrenhaftigkeit, seinen unangreifbaren Patriotismus, seine hohe Intelligenz, seinen Scharfsinn – und nennt ihn seinen Lotsenbruder.
Im Jahr 2022 hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue, dem Schloss der Hohenzollern, die 1849 die demokratische Bewegung zusammenschießen ließen, ein Denkmal für Carl Schurz aufstellen lassen. Eine überfällige, demokratische Erweiterung im deutschen Geschichtsbild.
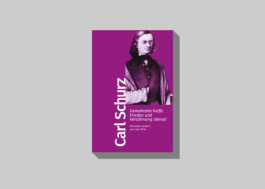
Carl Schurz
Demokratie heißt: Frieden und Versöhnung überall
Erschienen am 10.10.2024
Taschenbuch mit Klappen, 176 Seiten
€ (D) 14,– / € (A) 14,40
ISBN 978-3-462-50015-8
In Mainz angekommen, erfuhr ich von einem Mitglied des dortigen demokratischen Vereins, dass Kinkel bereits durch die Stadt passiert sei, um nach der Pfalz zu gehen; der Mainzer Volksführer Zitz1, der ein rheinhessisches Korps organisiert habe, um den Pfälzern zu Hilfe zu ziehen, und augenblicklich in Kirchheimbolanden stehe, könne mir wahrscheinlich Näheres sagen. So machte ich mich denn zu Fuß nach Kirchheimbolanden auf den Weg, mein Gepäck in einem Tornister auf dem Rücken tragend. In der kleinen Stadt Kirchheimbolanden fand ich Zitz, einen hochgewachsenen, stattlichen Mann inmitten seiner, wie es schien, wohlausgerüsteten und auch einigermaßen disziplinierten Freischar. Das Lager machte keinen üblen Eindruck. (Zitz wurde wenige Jahre später in New York bekannt als Mitglied der Advokatenfirma Zitz und Kapp.) Nur hatte die Artillerie, die aus drei oder vier kleinen Böllern bestand, wie man sie zum Knallen bei Festlichkeiten gebraucht, etwas Spielzeugartiges. Von Zitz erfuhr ich, dass Kinkel nach Kaiserslautern, der revolutionären Hauptstadt der Pfalz, gegangen sei, um der dort sitzenden provisorischen Regierung seine Dienste anzubieten. So wanderte ich denn weiter nach Kaiserslautern. Dort fand ich auch sogleich Kinkel und Anneke, beide im besten Humor. Sie begrüßten mich herzlich und quartierten mich im Gasthof Zum Schwan ein, wo ich vorläufig, wie Kinkel sagte, mich redlich nähren und einen guten pfälzischen Nachtschlaf genießen sollte; am nächsten Tage werde man mir schon etwas zu tun geben. Weiterlesen
Am anderen Morgen war ich früh auf den Beinen, erfrischt und tatendurstig. Mit besonderer Begierde beobachtete ich, wie ein in Aufstand befindliches Volk sich in der äußeren Erscheinung ausnahm. Ich fand, dass die Gäste im Wirtshaus ruhig frühstückten, wie sonst. Ich hörte sagen, dass der Sohn des Schwanenwirts dieser Tage seine Hochzeit feiern werde und dass große Vorbereitungen im Gange seien. Auf den Straßen ging es allerdings recht lebhaft zu – hier Leute, die ihre gewöhnlichen·Geschäfte zu besorgen schienen, da Trupps von jungen Männern in bürgerlicher Kleidung mit Musketen auf den Schultern, die offenbar zu der in der Bildung begriffenen Volkswehr gehörten; dazwischen Soldaten in der bayerischen Uniform, die zum Volke übergegangen waren – und sogar Polizisten, leibhaftige Gendarmen in ihrer Amtstracht, mit dem Säbel an der Seite und augenscheinlich in der Ausübung der gewöhnlichen Funktionen des Sicherheitsdienstes. Nun waren meinem von Rheinpreußen hergebrachten Gefühl die Begriffe „Gendarm“ und „Freiheit“ unvereinbar, und es kostete den Schwanenwirt einige Mühe, mich verstehen zu machen, dass diese Gendarmen sich auf die Reichsverfassung hatten einschwören lassen, nun der provisorischen Regierung dienten und überhaupt ganz gute Kerle seien. Überhaupt fand ich, obgleich unzweifelhaft die Führer ihre sehr sorgenvollen Stunden hatten, die Bevölkerung im Ganzen in einer in hohem Grad gemütlich-heiteren Stimmung, den Reiz des Augenblicks rückhaltlos genießend, scheinbar ohne sich viel mit dem Gedanken an das zu quälen, was der kommende Tag bringen werde. Das war eine allgemeine Sonntagsnachmittagslaune, ein wahrer Picknickhumor. (…)
Bei dem großen Völkerschacher auf dem Wiener Kongress nach den napoleonischen Kriegen war die Rheinpfalz an das Königreich Bayern gefallen. Aber wie sie geographisch nicht mit Altbayern zusammenhing, so hatte sich dort auch kein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit dem Königreich entwickeln wollen. Ein wirklicher bayerischer Patriotismus wollte in der Pfalz nicht wachsen. Als nun die bayerische Regierung auch altbayerische Beamte in die Pfalz schickte, um die Pfälzer regieren zu helfen, wurden die gegenseitigen Beziehungen noch unfreundlicher. Die „hungrigen Altbayern“, hieß es, würden nach der reichen Pfalz geschickt, um sich füttern zu lassen. Das Verhältnis war demjenigen, das zwischen der preußischen Rheinprovinz und Altpreußen existiert hatte, nicht unähnlich. Die Pfälzer waren daher in beständiger Opposition gegen Altbayern, und diese Opposition würde hingereicht haben, sie in die Reihen der Liberalen zu treiben, wäre nicht das geweckte, lebhafte, aufgeklärte Völkchen von Natur aus zu einer liberalen Denkweise disponiert gewesen. Dass dieser Liberalismus bei den Pfälzern einen entschieden deutschnationalen Charakter trug, versteht sich von selbst. In der Tat hatte sich eine der berühmtesten nationalen Demonstrationen anfangs der dreißiger Jahre, das Hambacher Fest, auf pfälzischem Boden abgespielt, und unter den Führern der nationalen Bewegung gab es immer Pfälzer in vorderster Reihe.
Als nun der König von Bayern die von dem Frankfurter Nationalparlament gemachte Verfassung anzuerkennen verweigerte, brach in der Pfalz sofort die allgemeine Entrüstung in hellen Flammen aus. Es verstand sich bei den Pfälzern von selbst, dass, wenn der König von Bayern nicht deutsch sein wollte, die Pfalz aufhören müsse, bayerisch zu sein. Am 2. Mai wurde in Kaiserslautern eine große Volksversammlung abgehalten, in der alle liberalen Vereine der Pfalz vertreten waren. Diese Versammlung ernannte einen Landesverteidigungsausschuss, welcher den gefassten Beschlüssen gemäß die Regierung der Provinz in die Hände nehmen und für die Organisierung einer bewaffneten Macht sorgen sollte. (…)
Die heillose Verworrenheit, welche die Weigerung des Königs von Preußen, die Reichsverfassung und die Kaiserkrone anzunehmen, über Deutschland gebracht hatte, trat nun krass zutage. Wie schon erwähnt, forderte das Nationalparlament am 4. Mai durch Beschluss „die Regierungen, die gesetzgebenden Körper, die Gemeinden der Einzelstaaten, das gesamte deutsche Volk auf, die Verfassung des deutschen Reichs zur Anerkennung und Geltung zu bringen“. Da nun der König von Bayern die Reichsverfassung anzuerkennen verweigerte, so fühlten die Pfälzer mit vollem Recht, dass sie, indem sie sich gegen die bayerische Regierung erhoben, im Sinne des Beschlusses des Nationalparlamentes handelten – in der Tat, dass sie einem Befehl der höchsten nationalen Autorität in Deutschland zu gehorchen suchten. Der Landesausschuss wandte sich also in durchaus logischer Weise durch die pfälzischen Abgeordneten im Nationalparlament an dieses und an die Provisorische Reichszentralgewalt um Anerkennung und Schutz. Die Reichszentralgewalt, an deren Spitze, wie bekannt, der österreichische Erzherzog Johann stand, schickte darauf einen Reichskommissar nach der Pfalz, um an Ort und Stelle „im Namen der Reichsgewalt alle zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Gesetze in jenem Land erforderlichen Maßregeln zu ergreifen“ und insbesondere Fürsorge zu treffen, dass gewisse vom Landesausschuss gefassten Beschlüsse wieder aufgehoben werden möchten. Der Reichskommissar erklärte auch die betreffenden Beschlüsse für aufgehoben, „bestätigte“ aber den „Landesausschuss für Verteidigung und Durchführung der deutschen Reichsverfassung“ und erklärte denselben für berechtigt, die Volkswehr zu organisieren, zu bewaffnen und auf die Reichsverfassung zu vereidigen und „gegen gewaltsame Angriffe auf die Reichsverfassung in der Pfalz äußerstenfalls selbständig einzuschreiten“. Damit war nun dem Erzherzog-Reichsverweser keineswegs gedient.
Der Erzherzog Johann war ursprünglich dadurch, dass er eine Bürgerliche geheiratet und dass er sich auch durch politisch freisinnige Äußerungen bei dem österreichischen Hof missliebig gemacht, in den Geruch liberaler Gesinnungen gekommen und bei dem großen Publikum populär geworden. Dies hatte ihm im Jahre 1848 die Wahl zum Amt des Reichsverwesers eingetragen. Es war nun nicht unnatürlich, dass ihn darauf der Wunsch und die Hoffnung erfasste, er möge selbst die deutsche Kaiserkrone empfangen. Die Wahl des Königs von Preußen enttäuschte ihn gewaltig, und er machte seinem Unmut dadurch Luft, dass er dem Präsidium des Nationalparlaments sofort seine Abdankung von dem Reichsverweser-Amt ankündigte. Doch ließ er sich überreden, diese Abdankung vorläufig zurückzuhalten, und er tat dies denn auch umso williger, als er von dem österreichischen Hof die dringende Weisung empfing, ein so wichtiges Amt, solange es bestehe, nicht fahrenzulassen, da er darin den dynastischen Interessen Österreichs sehr wichtige Dienste leisten könne. Das dynastische Interesse Österreichs wurde aber damals so verstanden, dass unter keiner Bedingung ein König von Preußen deutscher Kaiser werden und dass überhaupt keine Konstituierung des deutschen Reichs, in der nicht die österreichische Gesamtmacht Platz fände und die Führerrolle spielte, zustande kommen dürfe. Die vom Nationalparlament gemachte Reichsverfassung war also dem österreichischen Hof ein Gräuel, und ihre Einführung musste mit allen Mitteln verhindert werden. Nun mag der Liberalismus des Erzherzogs Johann ursprünglich immer so echt gewesen sein – gewiss ist, dass ihm das monarchistische Interesse im Allgemeinen und das österreichische im Besonderen viel mehr am Herzen lag als die Reichsverfassung und die deutsche Einheit.
Da stellte sich denn folgende wahrhaft groteske Lage der Dinge heraus: Das deutsche Nationalparlament hatte sich in der Provisorischen Zentralgewalt, an deren Spitze der Reichsverweser Erzherzog Johann gestellt worden war, ein exekutives Organ gegeben, um seinem Willen Achtung zu verschaffen und seine Beschlüsse praktisch durchzuführen. Die bei weitem wichtigste seiner Willensäußerungen bestand in der von ihm gemachten deutschen Reichsverfassung und der Wahl des Königs von Preußen als deutscher Kaiser. Der König von Preußen weigerte sich, die Reichsverfassung als zu Recht bestehend anzuerkennen und die auf ihn gefallene Kaiserwahl anzunehmen. Das Nationalparlament forderte darauf nicht nur alle deutschen Regierungen, sondern auch die gesetzgebenden Körper und die Gemeinden der deutschen Einzelstaaten, ja, das ganze deutsche Volk auf, die Reichsverfassung zur Anerkennung und Geltung zu bringen. Das Volk der Pfalz tat genau das, wozu das Nationalparlament das deutsche Volk aufforderte. Es stand für die Reichsverfassung auf gegen den König von Bayern, welcher der Reichsverfassung seine Anerkennung versagte. Ein von der Reichszentralgewalt in die Pfalz geschickter Reichskommissar fühlte sich durch seine Loyalität dem Nationalparlament gegenüber und durch die Logik der Umstände gezwungen, den pfälzischen Landesausschuss für Verteidigung und Durchführung der Reichsverfassung zu bestätigen und zur Zurückweisung gewaltsamer Angriffe auf die Reichsverfassung für berechtigt zu erklären. Und was tat darauf der Reichsverweser, der zu dem Zwecke geschaffen worden und dessen oberste Pflicht darin bestand, den Willen des Nationalparlaments und besonders die Reichsverfassung zur Anerkennung und Geltung zu bringen? Er rief den Reichskommissar sofort zurück und schickte sich an, die Volksbewegung, die in Übereinstimmung mit dem Aufruf des Nationalparlaments zur Verteidigung und Durchführung der Reichsverfassung begonnen worden war, mit Waffengewalt zu unterdrücken. Und zu diesem Zweck wurden hauptsächlich preußische Truppen gewählt – Truppen desselben Königs, der im März 1848 feierlich versprochen hatte, sich an die Spitze der nationalen Bewegung zu stellen und Preußen in Deutschland aufgehen zu lassen, der dann zum deutschen Kaiser gewählt worden und nun diejenigen totzuschießen bereit war, die ihn tatsächlich zum Kaiser machen wollten.
Es ist zur Verteidigung dieser unerhörten Handlungsweise gesagt worden, dass dem Volksaufstand für die Reichsverfassung in der Pfalz und besonders demjenigen in Baden starke republikanische Tendenzen, Umsturzgelüste, beigemischt waren. Das ist richtig. Es ist aber ebenso wahr, dass, hätten die deutschen Fürsten in loyaler Weise, wie sie im März 1848 dem deutschen Volke das volle Recht gegeben hatten von ihnen zu erwarten, die Reichsverfassung angenommen, sie alle republikanischen Bestrebungen in Deutschland brachgelegt haben würden. Das deutsche Volk würde im Ganzen und großen zufrieden gewesen sein; ja, es würde sich unzweifelhaft sogar einige Änderungen der Reichsverfassung im monarchischen Sinne haben gefallen lassen. Und es ist nicht weniger wahr, dass die Weise, in welcher die Machthaber nach so vielen schönen Versprechungen die Hoffnung des deutschen Volkes auf nationale Einigung zu vereiteln suchten, nur zu gut geeignet war, allen Glauben an die nationale Gesinnung und die Loyalität der Fürsten zu zerstören und die Meinung zu verbreiten, dass nur auf republikanischem Wege eine einheitliche deutsche Nation geschaffen werden könne. Die Haltung des Königs von Preußen sowie der Könige von Bayern, Hannover und Sachsen stellten den national gesinnten Deutschen vor die klare Alternative, entweder alle deutschen Einheitsbestrebungen und alles, was damit an nationaler Freiheit, Macht und Größe zusammenhing, vorläufig aufzugeben oder dieselben auf dem Wege weiterzuführen, der von den Regierungen als revolutionär bezeichnet wurde. Die klägliche Geschichte Deutschlands während des nächsten Dezenniums hat schlagend bewiesen, dass diejenigen, welche die Situation im Jahre 1849 im Lichte dieser Alternativen auffassten, sie richtig auffassten.
Kehren wir nun zur Pfalz nach der Abberufung des Reichskommissars zurück. Zuerst wurden mit kleinen Truppenkörpern Versuche gemacht, der pfälzischen Bewegung Einhalt zu tun. Da dies jedoch nicht gelang und unterdes auch durch den Aufstand des Volkes und der Armee in Baden die Lage der Dinge viel ernster geworden war, so fing die preußische Regierung an, ein paar Armeekorps mobilzumachen und sich auf einen förmlichen Feldzug vorzubereiten. Es waren gerade diese Vorbereitungen, die durch die verschiedenen Aufstandsversuche in den preußischen Westprovinzen hatten verhindert werden sollen. Die Pfalz blieb nun mittlerweile eine Zeitlang unangegriffen, und das gutmütige, zu sanguinischen Anschauungen geneigte Völkchen sah in dieser zeitweiligen Ruhe ein Zeichen, dass die Fürsten, auch der König von Preußen, sich doch scheuten, einen offenen Waffengang zu unternehmen, weil sich für die große Sache der deutschen Einheit und Freiheit wahrscheinlich die anderen Völkerschaften ebenso begeistern würden wie die Pfälzer und die Badenser. Man gab sich daher gern dem Glauben hin, dass die Erhebung ebenso heiter enden werde, wie sie begonnen hatte; und dies erklärt die Tatsache, dass die lustige Stimmung inmitten der revolutionären Ereignisse, die ich als Picknickhumor beschrieb, eine gute Weile vorhielt. Nicht wenige der Führer wiegten sich auch in diese Vertrauensseligkeit ein, und als nun der Landesausschuss gar den offiziellen Titel einer „provisorischen Regierung“ annahm, da freute man sich des Gefühls, dass nun die „Fröhliche Pfalz, Gott erhalt's“ der bayerischen Wirtschaft für immer ledig sei und als hübsche kleine Republik und Bestandteil des großen deutschen Freistaates sich fortan werde ersprießlich selbst regieren können.
Die Verständigeren und Weitersehenden verhehlten sich jedoch nicht, dass, wie die Dinge sich nun einmal gestaltet hatten, es sich hier um einen Entscheidungskampf mit einer antinationalen und antiliberalen Reaktion handle, die bei dieser Gelegenheit ihre ganze wohlorganisierte Macht, wenn nötig, bis zu den letzten Reserven aufbieten werde, und dass dieser Macht gegenüber sich die Hilfsmittel der Pfalz und Badens bedenklich gering ausnahmen. (…)
Es würde wahrscheinlich nicht schwer gewesen sein, in der Pfalz ein aus rüstigen jungen Leuten bestehendes Armeekorps von zwanzig- bis fünfundzwanzigtausend Mann zu bilden, wäre die provisorische Regierung mit dem nötigen Kriegszeug versehen gewesen. Freiwillige meldeten sich in Menge; aber da man ihnen keine Musketen in die Hände geben, sondern sie nur darauf verweisen konnte, sich so gut es ging mit Sensen und Spießen zu bewaffnen, so verliefen sich viele davon. Ein Versuch, Musketen von Belgien einzuführen, misslang, da man naiverweise die Ladung durch preußisches Gebiet den Rhein herauf hatte kommen lassen, wo sie natürlich von den wachsamen Preußen abgefasst wurde. Eine Überrumpelung der in der Pfalz gelegenen Festung Landau, die bedeutende Vorräte enthielt, schlug ebenfalls fehl. So blieb denn der Waffenmangel eine der drückendsten Sorgen der provisorischen Regierung. (…)
Nach etwa sechswöchentlicher Arbeit hatte man in der Pfalz nicht mehr als sieben- bis achttausend Mann zum großen Teil schlecht bewaffneter und durchweg schlecht disziplinierter Truppen. In Baden war man viel besser bestellt. Die gesamte Infanterie und Artillerie sowie der größte Teil der Kavallerie des Großherzogtums Baden hatten sich der Volksbewegung angeschlossen und präsentierten ein wohlausgerüstetes Armeekorps von etwa fünfzehntausend Mann. Zugleich war die Festung Rastatt mit ihren Waffen-, Munitions- und Montierungsvorräten in die Hände der Aufständischen gefallen. Neugebildete Organisationen konnten also bequem mit dem Nötigen versehen werden, und so hätte sich dort ohne allzu große Schwierigkeit eine mehr oder minder schlagfähige Armee von vierzig- bis fünfzigtausend Mann herstellen lassen. Freilich hatten sich, mit wenigen Ausnahmen, die Offiziere zum Großherzog gehalten und von ihren Truppen getrennt. Aber ihre Stellen waren mit avancierten Unteroffizieren besetzt worden, und unter diesen gab es tüchtige Leute in hinreichender Anzahl, um unter den Liniensoldaten die Disziplin einigermaßen aufrechtzuerhalten. So erschien denn der badische Aufstand in ziemlich stattlicher Rüstung.
Aber die pfälzischen und badischen Führer hätten von vornherein mit der Tatsache rechnen müssen, dass die äußerste Anstrengung der Kräfte der beiden kleinen Länder nicht hinreichen konnte, der vereinigten Macht der deutschen Fürsten oder selbst Preußen allein die Spitze zu bieten. Es gab keine Hoffnung des Erfolges, wenn sich nicht die Volkserhebung über Baden und die Pfalz hinaus auf das übrige Deutschland ausbreitete.
Ich kann mich nicht rühmen, die Situation damals so klar durchschaut zu haben wie später. Freilich hatte ich eine Ahnung davon; aber dann tröstete ich mich mit dem Gedanken, die Führer, viel ältere Leute als ich, müssten doch besser wissen, was zu tun sei; und schließlich hielt mich mein hoffnungsvoller Jugendmut aufrecht, der mir wieder und wieder sagte, eine so gerechte Sache wie die unsrige könne unmöglich untergehen. Schon am Tage nach meiner Ankunft in Kaiserslautern hatte ich mich in eins der Volkswehrbataillone, die organisiert wurden, als Soldat wollen einreihen lassen. Aber Anneke riet mir, damit nicht zu eilig zu sein, sondern mich ihm anzuschließen; da er Chef der pfälzischen Artillerie sei, so könne er mir eine meinen Fähigkeiten mehr angemessene Stellung verschaffen. In der Tat brachte er mir ein paar Tage darauf ein Leutnantspatent, das er mir von der provisorischen Regierung erwirkt hatte, und so wurde ich Aide de camp im Stab des Artilleriechefs. Kinkel fand Verwendung als einer der Sekretäre der provisorischen Regierung. Die pfälzische Artillerie bestand nur aus den Böllern der rheinhessischen Freikorps, aus einem halben Dutzend ähnlicher kleiner Kanonen, von denen man sagte, sie würden im Gebirgskrieg recht nützlich sein, und aus einer später von der badischen provisorischen Regierung erstandenen Sechspfünderbatterie. (…)
Der Angriff, den die fröhlichen Pfälzer, wenigstens viele davon, so lange für unwahrscheinlich gehalten hatten, kam nun wirklich. Am 12. Juni rückte eine Abteilung preußischer Truppen über die Grenze. Wären die Flüche, die das sonst so gutmütige Völkchen den Preußen entgegenschleuderte, alle Kanonenkugeln gewesen, so hätte das preußische Korps schwerlich standhalten können. Aber die wirklichen Streitkräfte, über welche die provisorische Regierung der Pfalz gebot, waren so gering und befanden sich in einem so wenig schlagfertigen Zustand, dass an eine erfolgreiche Verteidigung des Landes nicht zu denken war. Man musste daher ein Zusammentreffen mit den Preußen vermeiden; und so kam es, dass die erste militärische Operation, an der ich teilnahm, in einem Rückzug bestand.
Einige Tage vorher hatte mein Chef, der Oberstleutnant Anneke, mich instruiert, zu jedem Augenblick marschbereit zu sein, was mir nicht schwerfiel, da mein Gepäck sehr bescheiden war. Es wurde mir auch ein Pferd zugewiesen, ein hübsches, hellbraunes Tier; und da ich das Reiten noch nicht verstand, so schickte mich Anneke in eine Reitbahn, wo ein Reitmeister mich aufsitzen hieß, mir in kurzen Worten den Schluss mit den Beinen und die Handgriffe der Führung erklärte, worauf er mit seiner Peitsche auf das Pferd einhieb, das in ziemlich wilden Sätzen mit mir umhersprang, bis ich seiner mächtig wurde. „So“, sagte der Reitmeister, „jetzt haben Sie genug für diese Gelegenheit. Das andere lernen Sie schon auf dem Marsch.“ Ich wurde auch mit einer Kavalleriereithose ausgestattet, die so schwer mit Leder besetzt war, dass sich nur mit Mühe darin zu Fuß gehen ließ. Der Reitmeister hatte recht gehabt. Die fortwährende Übung im aktiven Dienst machte mich bald zu einem sattelfesten und nicht ungeschickten Reiter.
Obgleich der Einmarsch der Preußen und der Befehl zum Rückzuge der pfälzischen Truppen von den Wohlunterrichteten schon mehrere Tage erwartet worden, so hatten diese Ereignisse doch die Wirkung, die gemütliche Verwirrung, die seit dem Ausbruch des Aufstandes in Kaiserslautern geherrscht hatte, bedeutend zu erhöhen und zu einer recht ungemütlichen zu machen. Des Befehlens und Anordnens und Widerrufens von Befehlen war kein Ende, und das Durcheinander wuchs von Stunde zu Stunde, bis es endlich zum wirklichen Aufbruch kam. Wenn ich nicht irre, war es in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni. Mit unserer Artillerie gab's allerdings nicht viel Schwierigkeit, da sie, wie schon erzählt, aus sehr wenigen Stücken bestand. Um zwei Uhr nachts stiegen wir zu Pferde. Ein Nachtmarsch ist fast immer eine trübselige Geschichte, besonders aber ein Nachtmarsch rückwärts. Doch muss ich gestehen, dass mich das dumpfe Rollen der Räder auf der Straße, das summende und schurrende Geräusch der Marschkolonne, das leise Schnauben der Pferde und das Klirren der Säbelscheiden in der Finsternis als etwas besonders Romantisches berührte. Darin fand ich viel Sympathie bei der Frau meines Chefs, Mathilde Franziska Anneke, einer noch jungen Frau von auffallender Schönheit, vielem Geist, großer Herzensgüte, poetisch feurigem Patriotismus und ausgezeichneten Charaktereigenschaften, die ihren Mann auf diesem Zuge zu Pferde begleitete.
Mit Sonnenaufgang nach diesem ersten Nachtmarsch fanden wir uns bei Frankenstein in einem scharf eingeschnittenen Tal zwischen mittelhohen Bergrücken, wo wir quer über die Straße nach Neustadt eine Defensivstellung einnahmen. Ein kalter Morgen bringt unter solchen Umständen ein Gefühl durchaus unromantischer Nüchternheit mit sich, und ich machte die Erfahrung, dass dann ein warmer Trunk, sei der Kaffee auch noch so dünn, und ein Stück Brot zu den großen Wohltaten des Lebens gehören. Die Preußen drängten nicht scharf nach, und wir blieben den Tag über durchaus ungestört bei Frankenstein im Biwak. (…) Hier und da erscholl der Ruf, dass man nun die „sakermentschen Preußen“ erwarten solle. Aber der Rückzug wurde doch fortgesetzt und die Pfalz ohne Schwertstreich gänzlich aufgegeben. Am 19. Juni gingen wir, etwa sieben- bis achttausend Mann stark, bei Knielingen über den Rhein auf badisches Gebiet und marschierten nach Karlsruhe.
Unser Einzug in die saubere, geschniegelte Hauptstadt des Großherzogtums Baden brachte unter den Einwohnern eine Sensation hervor, die dem pfälzischen Korps von Freiheitskämpfern keineswegs schmeichelhaft war. Die an das schmucke großherzogliche Militär gewöhnten Karlsruher Bürger schienen das Malerische und Romantische in dem Aussehen der pfälzischen Truppen durchaus nicht zu würdigen, sondern eher geneigt zu sein, ihre Türen und Läden zu schließen und ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen, wie man sich vor einer Räuberbande zu retten sucht. Wenigstens trugen die Gesichter vieler der Leute, die unseren Einmarsch beobachteten, unverkennbar den Ausdruck entschiedenen Widerwillens und ängstlicher Besorgnis. Wir trösteten uns mit dem Gedanken, der auch recht kräftigen Ausdruck fand, dass die Einwohnerschaft dieser Residenzstadt hauptsächlich aus Hofgesinde und Beamtenvolk bestehe und dass sie im Grunde des Herzens gut großherzoglich gesinnt sei und die Revolution grimmig hasse, wenn auch manche davon in den letzten Wochen die Republikaner gespielt hätten. (…) Noch an demselben Tage wurden uns Lager außerhalb der Stadt angewiesen, und schon am 20. Juni marschierten wir nordwärts zur Unterstützung der badischen Armee, die unterdessen ins Gedränge gekommen war.
Diese badische Armee hatte die Nordgrenze des Großherzogtums gegen den Reichsgeneral Peucker2 verteidigt. Gerade beim Ausbruch der Feindseligkeiten erhielt sie den polnischen General Mieroslawski3 zum Oberkommandeur. Er war ein noch junger Mann, hatte im letzten polnischen Aufstand Fähigkeit und Bravour bewiesen, besaß aber keine Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse und konnte nicht deutsch sprechen. Jedenfalls war er dem alten Sznayde4 weit vorzuziehen. Am 20. Juni gingen die Preußen bei Philippsburg von der Pfalz aus über den Rhein und kamen so der badischen Armee in den Rücken. Miroslawski wendete sich mit einer raschen Bewegung gegen sie, hielt sie durch einen entschlossenen Angriff bei Waghäusel fest und führte dann einen geschickten Flankenmarsch aus, welcher ihn zwischen den Preußen und den Peuckerschen Reichstruppen durchführte und mit dem pfälzischen Korps und den vom Oberlande herankommenden badischen Reserven in Verbindung brachte. Das Gefecht bei Waghäusel war für die badischen Truppen keineswegs ein unrühmliches. Wir hörten den Kanonendonner, als wir über Bruchsal heranmarschierten, und bald gingen auch Gerüchte von einem großen über die Preußen erfochtenen Sieg um. Die weitere Nachricht, dass Mieroslawski auf dem Rückzug sei, die württembergische Grenze entlang, und dass wir seine Flanke zu decken hätten, störte uns wenig in dem Glauben an den „Sieg bei Waghäusel“, dessen Früchte, wie es hieß, durch den „Verrat“ des Dragonerobersten, der den geschlagenen Feind verfolgen sollte, verlorengegangen seien. Am 23. Juni rückten wir nach Ubstadt vor, und dort empfingen wir die Kunde, dass wir am nächsten Morgen mit dem preußischen Vortrab zusammentreffen und uns zu schlagen haben würden. Die Aufträge, die ich von meinem Chef empfing, hielten mich bis nach Einbruch der Dunkelheit zu Pferde, und es war spät, als ich mein Quartier im Wirtshaus zu Ubstadt erreichte.
Auch am anderen Morgen, dem Morgen vor der Schlacht, wollte mir nicht feierlich zumute werden. Es schien mir fast, als ob über solche Stimmungen sehr viel Unwirkliches fantasiert würde. In meinem späteren Leben habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie allerdings vorkommen, aber doch nur ausnahmsweise. Gewöhnlich wenden sich die Gedanken am Morgen vor der Schlacht einer Menge von Dingen prosaischer Natur zu, unter denen das Frühstück eine nicht unwichtige Stelle einnimmt. So ging es uns auch an jenem Morgen in Ubstadt. Wir waren beizeiten im Sattel und sahen bald in einiger Entfernung vor unserer Front blinkende Lanzenspitzen auftauchen, die sich uns mit mäßiger Schnelligkeit näherten. Dies bedeutete, dass die Preußen eine oder mehrere Schwadronen Ulanen als Plänkler vorgeschickt hatten, denen die Infanterie und Artillerie demnächst zum Angriff folgen würden. So verschwanden denn die Ulanen, nachdem sie aus ihren Karabinern einige Schüsse abgegeben, die von unserer Seite erwidert wurden, und dann entwickelte sich immer lebhafter das Geknatter des Infanteriefeuers. Bald wurden auch auf beiden Seiten Geschütze aufgefahren, und die Kanonenkugeln flogen mit ihrem eigentümlichen Sausen herüber und hinüber, ohne viel Schaden zu tun. Anfangs war meine Aufmerksamkeit gänzlich in Anspruch genommen durch die Befehle, die mein Chef mir zu überbringen oder auszuführen gab. Aber nachdem unsere Artillerie postiert war und wir ruhig zu Pferde in ihrer Nähe hielten, hatte ich Muße genug, mir meine Gedanken und Gefühle zum Bewusstsein kommen zu lassen. Ich erlebte da wieder eine Enttäuschung. Ich war zum ersten Mal im Feuer. Ganz ruhig fühlte ich mich nicht. Die Nerven waren in nicht gewöhnlicher Erregung. Aber diese Erregung war weder die der heroischen Kampfesfreude noch die der Furcht. Da die feindlichen Geschütze zunächst ihr Feuer auf unsere Artillerie richteten, so sauste eine Kanonenkugel nach der andern dicht über unsere Köpfe, wo wir standen. Ich fühlte zuerst eine starke Neigung, wenn ich dies Sausen recht nahe über mir hörte, mich zu ducken; aber es fiel mir ein, dass sich dies für einen Offizier nicht schicke, und so blieb ich denn stramm aufrecht. Ebenso zwang ich mich, nicht zu zucken, wenn eine Musketenkugel dicht bei meinem Ohr vorbeipfiff. Die Verwundeten, die vorübergetragen wurden, erregten mein lebhaftes Mitgefühl; aber der Gedanke, dass mir im nächsten Augenblick ähnliches passieren könne, kam mir nicht in den Sinn. Ich sah ein Volkswehrbataillon, welches gegen eine feindliche Batterie geführt worden war, in Unordnung zurückkommen und sprengte, einem plötzlichen Impuls gehorchend, hinüber, um das Bataillon ordnen und wieder vorführen zu helfen – war aber auch ganz zufrieden, als ich bemerkte, wie der Bataillonsführer dies selbst besorgte. Als nun später mein Chef mich wieder mit Befehlen hin und her schickte, verging mir das bewusste Empfinden ganz, und ich dachte an nichts als den auszuführenden Auftrag und den Gang des Gefechts, wie ich ihn beobachten konnte. (…)
Übrigens war das Gefecht bei Ubstadt eine verhältnismäßig geringfügige Affäre – von unserer Seite nur dazu bestimmt, den Feind eine kurze Weile in seinem Vormarsch aufzuhalten, bis sich die badische Armee wieder in unserem Rücken geordnet haben könne, und uns langsam auf diese zurückzuziehen. Bei Ubstadt wurde diese Instruktion in ziemlich ordentlicher Weise ausgeführt. (…) Am nächsten Tag hatten wir ein ansehnliches Gefecht mit der preußischen Vorhut bei Bruchsal, welches wieder mit einem Rückzuge endete, diesmal aber nicht in gleicher Ordnung. Wie das bei Volksaufständen nicht selten ist, fingen die aufgeregten Leute an, den unglücklichen Verlauf des Unternehmens dem „Verrat“ irgendeines Führers zuzuschreiben, und bei dieser Gelegenheit erhob sich dieser Schrei gegen den armen General Sznayde, der auf dem Rückzug bei Durlach plötzlich von einer Rotte meuterischer Freischärler umringt und vom Pferd gerissen wurde. Er verschwand dann vom Schauplatze der Aktion, und die pfälzischen Truppen wurden dem badischen Armeekommando unterstellt.
An der Murglinie, den linken Flügel an die Festung Rastatt angelehnt, nahm das vereinigte badisch-pfälzische Heer seine letzte Defensivstellung und schlug sich am 28., 29. und 30. Juni teilweise recht brav, wenn auch erfolglos. Am Nachmittag des 30. Juni schickte mich mein Chef mit einem Auftrag, Artilleriemunition betreffend, in die Festung Rastatt und instruierte mich, ihn im Fort B., einer der großen Bastionen, von denen man das Gefechtsfeld draußen übersah, zu erwarten; er werde bald nachkommen. Ich entledigte mich meines Auftrags, begab mich an den von Anneke bestimmten Platz, band mein Pferd an die Lafette eines Festungsgeschützes und setzte mich auf den Wall nieder, wo ich, nachdem ich das Gefecht eine Zeitlang beobachtet hatte, trotz dem Kanonendonner fest einschlief. Als ich erwachte, war die Sonne am Untergehen. Ich fragte die umstehenden Artilleristen nach Anneke, aber niemand hatte ihn gesehen. Ich wurde unruhig und bestieg mein Pferd, um die Stadt zu verlassen und meinen Chef draußen aufzusuchen. Am Tor angekommen, empfing ich von dem wachhabenden Offizier die Nachricht, dass ich nicht mehr hinauskönne; unser Hauptkorps sei gegen Süden zurückgedrängt worden und die Festung von den Preußen vollständig eingeschlossen. Ich galoppierte nach dem Hauptquartier des Festungskommandanten auf dem Schloss und erfuhr dort die Bestätigung des Gehörten. Der Gedanke, in der Stadt bleiben zu müssen und Preußen ringsumher, traf mich wie ein unheilvolles Schicksal. Ich konnte mich nicht darein ergeben und fragte immer wieder, ob denn da gar kein Ausweg sei, bis endlich ein dabeistehender Offizier mir sagte: „Mir ist gerade so zumut wie Ihnen. Ich gehöre auch nicht hierher und habe an allen Punkten versucht durchzubrechen, aber es war umsonst. Wir müssen uns eben fügen und hierbleiben.“ Von Anneke fand ich keine Spur. Er hatte entweder die Stadt längst verlassen oder war vielleicht gar nicht hereingekommen. (…)
Dass unsere Sache, wenn nicht ein Wunder geschah, verloren war, konnte ich mir nun nicht mehr verhehlen. Und was ein solches Wunder hätte sein mögen, konnte selbst meine jugendliche Hoffnungsfreudigkeit sich nicht mehr vorstellen. Übergehen der preußischen Landwehren zum Volksheer? Das wäre nur möglich gewesen am Anfange des Feldzuges, wenn überhaupt. Nach einer Reihe von Niederlagen war diese Möglichkeit geschwunden. Ein großer Sieg der Unsrigen im Oberlande? Undenkbar, da der Rückzug von der Murglinie unzweifelhaft unsere Streitmacht mehr durch Demoralisation schwächen musste, als sie durch Zuzug verstärkt werden konnte. Große Siege der Ungarn im Osten? Aber die Ungarn waren weit entfernt und die Russen im Anzuge gegen sie. Eine neue Volkserhebung in Deutschland? Aber der revolutionäre Impuls hatte sich offenbar erschöpft. Da saßen wir denn in einer Festung, von den Preußen eingeschlossen. Eine längere Verteidigung der Festung konnte unserer Sache nicht mehr dienen – oder nur insofern, als sie bewies, dass ein Volksheer auch Mut besitzen und der militärischen Ehre Rechnung tragen kann. Aber unter allen Umständen konnte die Festung sich nur eine beschränkte Zeit halten. Und dann? Kapitulation. Und dann? Wir würden den Preußen in die Hände fallen. Nun war der Oberbefehlshaber der preußischen Truppen in Baden der Prinz von Preußen, in welchem damals niemand den später so populären und gefeierten Kaiser Wilhelm I. vermutete. Er galt zu jener Zeit für den schlimmsten Feind aller freiheitlichen Bestrebungen. Das allgemein geglaubte Gerücht, dass er es gewesen sei, der am 18. März 1848 in Berlin den Befehl gegeben habe, auf das Volk zu schießen, hatte ihm im Volksmund den Titel „der Kartätschenprinz“ eingetragen. (…)
Dass er im Jahr 1849, als seinem Bruder Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kaiserkrone angeboten wurde, zu denen gehörte, die eine günstige Erwägung dieses Anerbietens empfahlen, und dass, wäre er statt seines Bruders König von Preußen gewesen, die Krisis wahrscheinlich eine den deutschen Einheitsbestrebungen ersprießlichere Lösung gefunden haben würde, wusste man damals noch nicht. Auch würde eine solche Kunde schwerlich geglaubt worden sein, denn man hielt den Prinz von Preußen für einen ehrlichen und durchaus unverbesserlichen Absolutisten, der standhaft daran glaubte, dass die Könige von Gott eingesetzt und nur Gott Rechenschaft schuldig seien; dass das Volk nichts mit den Geschäften der Regierung zu tun haben dürfe; dass eine Auflehnung gegen die Königsgewalt einer direkten Beleidigung Gottes gleichkomme und dass es eine gebieterische Pflicht der Gewalthaber sei, über ein solches Verbrechen die erdenklich schwerste Strafe zu verhängen. So erschien der Prinz von Preußen dem Volk auch als ein fanatischer Soldat, dem die preußische Armee ein Herzensidol war – der in ihr das Schwert Gottes, das Bollwerk der Weltordnung sah, in dessen Augen ein preußisches Landeskind, das gegen die preußische Armee kämpfte, ein unsühnbares, dem Elternmord an Fluchwürdigkeit nicht nachstehendes Verbrechen beging und von dem ein solcher Verbrecher keine Gnade erwarten dürfe. Wir geborenen Preußen hatten also, wenn wir in die Hände des Prinzen Wilhelm fielen, die beste Aussicht, standrechtlich erschossen zu werden – besonders diejenigen, die wie ich gerade in den militärdienstpflichtigen Jahren standen. Und dabei erinnerte ich mich, dass ich kurz vor der Siegburger Affäre vor der königlichen Aushebungskommission hatte erscheinen müssen, welche, indem sie meine Eingabe um Zulassung als Einjährig-Freiwilliger willkürlich übersah, mich für ein Kürassierregiment bestimmte, mit Aussicht auf baldige Einberufung. Für mich würde es also gewiss keine Nachsicht geben. (…)
Da kam eines Tages – es war in der dritten Woche der Belagerung – ein preußischer Parlamentär in die Festung, der mit einer Aufforderung zur Übergabe zugleich die Nachricht brachte, dass die badisch-pfälzische Armee längst auf schweizerisches Gebiet übergetreten sei und damit aufgehört habe zu existieren; dass kein bewaffneter Insurgent mehr auf deutschem Boden stehe und dass das preußische Oberkommando irgendeinem Vertrauensmann, den die Besatzung von Rastatt hinausschicken möchte, um sich von diesen Tatsachen zu überzeugen, zur Ausführung dieses Auftrags Freiheit der Bewegung und sicheres Geleit gewähren wolle. Dieses Ereignis verursachte gewaltige Aufregung. Sofort versammelte der Gouverneur in dem Hauptsaal des Schlosses einen großen Kriegsrat, bestehend, wenn ich mich recht erinnere, aus allen Offizieren der Besatzung vom Kapitän aufwärts. Nach stürmischer Beratung wurde beschlossen, das Anerbieten des preußischen Oberkommandos anzunehmen, und Oberstleutnant Corvin5 empfing den Auftrag, die Lage der Dinge draußen zu erforschen und, falls er sie den Angaben des preußischen Parlamentärs entsprechend fände, um eine möglichst günstige Kapitulation für die Besatzung von Rastatt zu unterhandeln. (…)
Am zweiten Morgen nach Corvins Abreise wurde ich von dem Geräusch schwerer Schritte, rasselnder Säbel und verworrener Stimmen geweckt. Aus dem, was ich sah und hörte, schloss ich, dass Corvin von seiner Sendung zurückgekehrt war und dass der große Kriegsrat sich wieder versammelte. Der Gouverneur trat ein, gebot Ruhe und ersuchte Corvin, der an seiner Seite stand, vor der ganzen Versammlung seinen Bericht mündlich abzustatten. Corvin erzählte also, er sei, von einem preußischen Offizier begleitet, bis an die Grenze der Schweiz gefahren und habe sich an Ort und Stelle überzeugt, dass es in Baden keine Revolutionsarmee, ja, keinen Widerstand irgendwelcher Art gegen die preußischen Truppen mehr gäbe. Die Revolutionsarmee sei auf das schweizerische Gebiet übergetreten und habe natürlich an der Grenze ihre Waffen und ihre ganze kriegerische Ausrüstung abgeben müssen. Auch im übrigen Deutschland sei, wie er sich durch die Zeitungen unterrichtet habe, keine Spur von revolutionärer Bewegung mehr übrig, überall Unterwerfung und Ruhe. Selbst die Ungarn seien durch die russische Intervention in große Bedrängnis geraten und würden bald unterliegen müssen. Kurz, die Besatzung von Rastatt sei gänzlich verlassen und könne von keiner Seite auf Entsatz hoffen. Und schließlich, setzte Corvin hinzu, sei ihm im preußischen Hauptquartier angekündigt worden, dass das preußische Oberkommando die Übergabe der Festung auf Gnade oder Ungnade verlange und sich auf keinerlei Bedingungen einlassen werde.
Eine tiefe Stille folgte dieser Rede. Jeder der Zuhörer fühlte, dass Corvin die Wahrheit gesprochen. Endlich nahm jemand – ich erinnere mich nicht, wer – das Wort und stellte einige Fragen. Dann gab es ein Gewirr von Stimmen, in welchem man einige Hitzköpfe von „Sterben bis zum letzten Mann“ und dergleichen sprechen hörte, bis der Gouverneur einem ehemaligen preußischen Soldaten, der in der Pfalz Offizier geworden war, Gehör verschaffte. Dieser sagte, er sei so bereit wie irgendeiner, unserer Sache seinen letzten Blutstropfen zu opfern, und wir Preußen, wenn wir in die Hände der Belagerungsarmee fielen, müssten wahrscheinlich sowieso sterben. Aber er rate die sofortige Übergabe der Festung an. Tue man's heute nicht, so werde man es morgen tun müssen. Man solle nicht die Bürger der Stadt mit ihren Weibern und Kindern auch noch einer Hungersnot und einer weiteren Beschießung aussetzen, und alles dies umsonst. Es sei Zeit, ein Ende zu machen, was auch mit uns geschehen möge. – Es ging ein Gemurmel durch den Saal, dass dieser Mann vernünftig gesprochen; und so wurde denn der Beschluss gefasst, dass Corvin noch einmal versuchen solle, für die Offiziere und Mannschaften der Besatzung im preußischen Hauptquartier günstige Bedingungen zu erwirken. Wenn er aber nach gemachtem Versuch die Unmöglichkeit einsehe, solche Bedingungen zu erhalten, so solle er für die Übergabe auf Diskretion die nötigen Bestimmungen abschließen. Als wir den Saal verließen, fühlten wohl die meisten von uns, dass an etwas anderes als an eine Kapitulation auf Gnade oder Ungnade kaum zu denken sei. (…)
Um zwölf Uhr mittags sollten die Truppen aus den Toren marschieren und draußen auf dem Glacis der Festung vor den dort aufgestellten Preußen die Waffen strecken. Die Befehle waren bereits ausgefertigt. Ich ging nach meinem Quartier am Marktplatz, um meinen letzten Brief an meine Eltern zu schreiben. Ich dankte ihnen darin für alle Liebe und Sorge, die sie mir erwiesen, und bat sie, mir zu verzeihen, wenn ich ihnen ihre Ergebenheit jemals übel vergolten oder ihre Hoffnungen getäuscht hätte. Ich sagte ihnen, ich habe, meiner ehrlichen Überzeugung folgend, für die Sache des Rechts und des deutschen Volks die Waffen ergriffen, und dass, wenn es mein Los sein sollte, sterben zu müssen, es ein ehrenhafter Tod sein werde, dessen sie sich nicht zu schämen brauchten. Diesen Brief übergab ich dem guten Herrn Nusser, meinem Wirt, der mir mit Tränen in den Augen versprach, ihn der Post zu übergehen, sobald die Stadt wieder offen sein werde.
Unterdessen nahte die Mittagsstunde. Ich hörte bereits die Signale zum Antreten auf den Wällen und in den Kasernen, und ich machte mich fertig, zum Hauptquartier hinaufzugehen. Da schoss mir plötzlich ein neuer Gedanke durch den Kopf.
Ich erinnerte mich, dass ich vor wenigen Tagen auf einen unterirdischen Abzugskanal für das Straßenwasser aufmerksam gemacht worden war, der bei dem Steinmauerner Tor aus dem Innern der Stadt unter den Festungswerken durch ins Freie führte. Er war wahrscheinlich ein Teil eines unvollendeten Abzugssystems. Der Eingang des Kanals im Innern der Stadt befand sich in der Fortsetzung eines Grabens oder einer Gosse, nahe bei einer Gartenhecke, und draußen mündete er in einem von Gebüsch überwachsenen Graben an einem Welschkornfeld. Sobald diese Umstände zu meiner Kenntnis gekommen waren, hatte ich daran gedacht, dass, wenn die inneren und äußeren Mündungen dieses Kanals nicht scharf bewacht würden, Kundschafter sich durch ihn ein- und ausschleichen könnten. Ich machte Meldung davon, aber sogleich darauf kam die Unterhandlung mit dem Feind, die Sendung Corvins und die Aufregung über die bevorstehende Kapitulation, die mir die Kanalangelegenheit aus dem Sinne trieben. Jetzt im letzten Moment vor der Übergabe kam mir die Erinnerung wie ein Lichtblitz zurück. Würde es mir nicht möglich sein, durch diesen Kanal zu entkommen? Würde ich nicht, wenn ich so das Freie erreichte, mich bis an den Rhein durchschleichen, dort einen Kahn finden und nach dem französischen Ufer übersetzen können? Mein Entschluss war schnell gefasst – ich wollte es versuchen.
Ich rief meinen Burschen, der zum Abmarsch fertig geworden war.
„Adam“, sagte ich, „Sie sind ein Pfälzer und ein Volkswehrmann. Ich glaube, wenn Sie sich den Preußen ergeben, so wird man Sie bald nach Hause schicken. Ich bin ein Preuße, und uns Preußen werden sie wahrscheinlich totschießen. Ich will daher versuchen davonzukommen, und ich weiß, wie. Sagen wir also adieu!“
„Nein“, rief Adam, „ich verlasse Sie nicht, Herr Leutnant. Wohin Sie gehen, gehe ich auch.“ Die Augen des guten Jungen glänzten vor Vergnügen. Er war mir sehr zugetan.
„Aber“, sagte ich, „Sie haben nichts dabei zu gewinnen, und wir werden vielleicht große Gefahr laufen.“
„Gefahr oder nicht“, antwortete Adam entschieden, „ich bleibe bei Ihnen.“
In diesem Augenblick sah ich draußen einen mir bekannten Artillerieoffizier namens Neustädter vorübergehen. Er war wie ich in Rheinpreußen zu Hause und hatte früher in der preußischen Artillerie gedient.
„Wo gehen Sie hin, Neustädter?“ rief ich ihm durchs Fenster zu.
„Zu meiner Batterie“, antwortete er, „um die Waffen zu strecken.“
„Die Preußen werden Sie totschießen“, entgegnete ich. „Gehn Sie doch mit mir, und versuchen wir davonzukommen.“
Er horchte auf, kam ins Haus und hörte meinen Plan, den ich ihm mit wenigen Worten darlegte. „Gut“, sagte Neustädter, „ich gehe mit Ihnen.“6
(Aus: Sturmjahre. Lebenserinnerungen 1829-1852, Verlag der Nation, Berlin 1973, S. 199-236)
1 Franz Zitz (1803-1877), Jurist, war Mitglied des Vorparlament und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. Im März 1849 schied er aus dem Parlament aus, weil es ihm zu gemäßigt war, und beteiligte sich als Anführer des rheinhessischen Freikorps am pfälzisch-badischen Aufstand. Nach dessen Niederschlagung flüchtete er in die Schweiz und emigrierte dann in die USA, wo er wieder als Rechtsanwalt arbeitete.
2 Eduard von Peucker (1791-1876), preußischer General der Infanterie.
3 Ludwik Mieroslawski (1814-1878), ein polnischer Revolutionär, wurde wegen seiner militärischen Erfahrungen bei Aufständen in Polen nach Baden gerufen und zum Oberbefehlshaber der badischen Revolutionsarmee ernannt. Er schloss sich später (ab 1861) Guiseppe Garibaldis Unabhängigkeitskampf in Italien an.
4 Franz Sznayde (1790-1850), polnischer Kavallerieoffizier, übernahm im Mai 1849 den Oberbefehl über die Verbände der Aufständischen in der Rheinpfalz.
5 Otto von Corvin (1812-1886), Schriftsteller (u.a. „Der Pfaffenspiegel“), war bereits militärischer Ausbilder der Deutschen Demokratischen Legion in Paris und nahm 1848 am Heckerzug teil. Nach Übergabe der Festung Rastatt wurde er zum Tode verurteilt, das Urteil jedoch in sechs Jahre Einzelhaft umgewandelt. Nach der Haft berichtete er als freier Journalist aus Großbritannien und den USA.
6 Nach einem ersten gescheiterten Versuch am 23. Juli, der Fluchtkanal hatte sich durch heftigen Regen gefährlich mit Wasser gefüllt, gelang die Flucht vier Tage später, währenddessen sie sich versteckt gehalten hatten, tatsächlich. Ein Helfer brachte sie schließlich in seinem Kahn über den Rhein nach Elsass, von wo aus Schurz zu Fuß über Straßburg in die Schweiz entkam.
Lebenserinnerungen von Carl Schurz (3 Bände), erstmals veröffentlicht im Georg Reimer Verlag, Berlin 1906, 1907 und 1912.
Neuausgabe: Carl Schurz: Sturmjahre. Lebenserinnerungen 1829-1852, Verlag der Nation, Berlin 1973.
Neuausgabe von Band 1 und 2, herausgegeben von Daniel Göske, Wallstein, Göttingen 2015.
Joachim Maas: Der unermüdliche Rebell. Leben, Tat und Vermächtnis des Carl Schurz. Mit einem Anhang: Carl Schurz über Abraham Lincoln, Hamburg 1949.
Stefan Reinhardt: Die Darstellung der Revolution von 1848/49 in den Lebenserinnerungen von Carl Schurz und Otto von Corvin, Frankfurt am Main 1999.
Marianne und Otto Draeger: Die Carl Schurz Story. Vom deutschen Revolutionär zum amerikanischen Patrioten, Berlin 2006.
Rudolf Geiger: Der deutsche Amerikaner. Carl Schurz – Vom deutschen Revolutionär zum amerikanischen Staatsmann, Gernsbach 2007.
Walter Keßler: Carl Schurz – Kampf, Exil und Karriere, Köln 2006.
Daniel Nagel: Von republikanischen Deutschen zu deutsch-amerikanischen Republikanern. Ein Beitrag zum Identitätswandel der deutschen Achtundvierziger in den Vereinigten Staaten 1850–1861, St. Ingbert 2012.
Wir nutzen Cookies und ähnliche Technologien, um Geräteinformationen zu speichern und auszuwerten. Mit deiner Zustimmung verarbeiten wir Daten wie Surfverhalten oder eindeutige IDs. Ohne Zustimmung können einige Funktionen eingeschränkt sein.