
CHRISTIAN SCHÜLER
Abb.: Lithographie-Porträt von Schertle, Verlag Schmerber’sche
Buchhandlung, um 1850
Der Jurist und Advokat im Staatsdienst Christian Gottlieb Schüler war kein Rebell, aber ein „bürgerlicher“ Demokrat reinsten Wassers. Seine Parlamentsberichte aus Frankfurt machten den Jenaer Abgeordneten zu einem kritischen Chronisten des ersten gesamtdeutschen Parlaments – und dienen der historischen Forschung als wertvolle Quelle der deutschen Demokratiegeschichte. Als führendes Mitglied im Verfassungsausschuss war er maßgeblich am Verfassungsentwurf der Nationalversammlung beteiligt. Diese „Reichsverfassung“ diente den Müttern und Vätern unseres Grundgesetzes als eine Art Blaupause – und bildet bis heute dessen Kernbestand.
Am 27. März wird Gottlieb Christian Schüler in dem zum Herzogtum Sachsen-Meiningen gehörenden Salzungen geboren. Sein Vater, Johann Gottfried Schüler, ist Advokat, seine Mutter die Tochter eines Amtmannes.
Als Sohn einer lokal verwurzelten Bürgersfamilie folgt er dem Vorbild des Vaters. Nach dem Besuch des Lyzeums in Meiningen (1813-1817) studiert er Rechtswissenschaften an den Universitäten Jena und Heidelberg und schließt sich dort der Burschenschaftsbewegung an, für die das Studium als Grundlage politischen Handelns gilt.
Nach Abschluss des Studiums nimmt Schüler zu Beginn des Jahres 1820 seine Tätigkeit als Advokat in Salzungen auf.
Schüler tritt in den Staatsdienst ein, zunächst als Amtssekretär, dann als Landgerichtsassessor, später als Oberlandesgerichtsrat.
Schüler wird in den Landtag von Sachsen-Meiningen gewählt und gehört dort zur liberalen Opposition.
Trotz seines "oppositionellen" politischen Engagements wird Schüler zum Rat am Oberappellationsgericht in Jena ernannt (und wird dieses Amt 36 Jahre lang bis zu seinem Tod bekleiden). Wegen dieser Tätigkeit siedelt die Familie (Schüler ist seit 1824 verheiratet) nach Jena über, wo in der Folge die vier jüngsten seiner insgesamt 11 Kinder geboren werden.
„Als Beweis der Achtung“, welcher er sich seit seinem Eintritt in das höchste Gericht erworben habe, erhält Schüler von der juristischen Fakultät der Universität Jena die Ehrendoktorwürde. Das ermöglicht ihm nun zusätzlich eine Universitätslaufbahn. Als Honorarprofessor hält er von nun an Vorlesungen über Kriminal- und Prozessrecht.
Als die Revolution Thüringen erreicht, engagiert sich Schüler sofort. Im März leitet er eine Protestdeputation, die vor dem Weimarer Landtag die Märzforderungen vorträgt. Er stellt sich anschließend zur Wahl zur Frankfurter Nationalversammlung und wird am 28. April mit großer Mehrheit gewählt. Ab Mai liefert er seinen Wählern dann regelmäßig Berichte über das Geschehen in der Paulskirche.
Nach dem Scheitern der Revolution und der Auflösung der Nationalversammlung kehrt Schüler enttäuscht nach Jena zurück, bleibt aber weiterhin politisch aktiv. Von 1864 bis 1868 gehört er dem Gemeinderat der Stadt Jena an, seit 1866 als dessen Vorsitzender.
Als Rechtsprofessor, Gerichtsrat und Lokalpolitiker hochgeachtet – und 1870 zum Ehrenbürger der Stadt Jena ernannt – stirbt Christian Schüler am 1. Juli 1874.
Ina Hartwig
Gottlieb Christian Schüler war als einflussreicher Abgeordneter der demokratischen Fraktion „Deutscher Hof“ ein besonders bemerkenswerter Vertreter des ersten gesamtdeutschen Parlaments – sowohl in der Perspektive seiner Zeitgenossinnen und Zeitgenossen als auch unserer demokratieerfahrenen Gegenwart. Einerseits war Schüler radikal: radikal in seinem demokratischen Idealismus, der von der spontanen Überzeugungskraft der politischen Rede ausging und einen Parlamentarismus unter Bedingungen vorsah, die angesichts der Realität fast märchenhaft anmuten – damals wie heute. Die Korrespondenz an seine Ehefrau verfasste er während seiner Zeit in der Paulskirche in Form offener Briefe, um seine Arbeit als Abgeordneter möglichst transparent zu machen. An seiner radikalen politischen Kernforderung hielt Schüler konsequent fest: Die nationalstaatliche Einheit Deutschlands und die Schaffung einer politischen „Zentralgewalt“ hielt der Jenaer Jurist für unabdingbar, auch wenn sie mit einem Souveränitätsverlust für die Einzelstaaten einhergehen musste. Weiterlesen
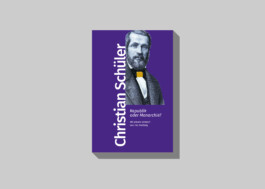
Christian Schüler
Republik oder Monarchie?
Erschienen am 10.10.2024
Taschenbuch mit Klappen, 192 Seiten
€ (D) 14,– / € (A) 14,40
ISBN 978-3-462-50014-1
Andererseits erwies sich Schüler in seiner Arbeit als Abgeordneter als pragmatisch, lotete Kompromisse aus und hielt nicht dogmatisch an Maximalforderungen fest, wenn sich diese als nicht mehrheitsfähig erwiesen. Schon in seiner Bewerbungsrede für die Wahl zur Nationalversammlung 1848 verwahrte er sich dagegen, wegen seiner liberalen demokratischen Ansichten auf die Republik als ideale Staatsform festgelegt zu sein („Ich werde mich an die Seite des entschiedenen Fortschritts anschließen, aber lasst Euch nicht ins Ohr blasen, ich sei ein Republikaner“).
Im persönlichen Umgang mit den politischen Gegnern schließlich scheint Schüler höchst wertschätzend, respektvoll und um Ausgleich bemüht gewesen zu sein. Mehr als einmal hob er in seinen Berichten aus dem Parlament die intellektuelle Brillanz von Abgeordneten hervor, die ihm politisch fernstanden. Aufrufen zum Verlassen des institutionellen Weges, zur Abspaltung oder gar zum gewaltsamen Aufstand zur Durchsetzung der eigenen politischen Ideale versperrte er sich auch, als seine Fraktion in der Paulskirche zunehmend unter Druck geriet.
Gottlieb Christian Schüler wurde 1798 in Salzungen, das damals zum Herzogtum Sachsen-Meiningen gehörte, als Sohn eines Advokaten und Enkel eines Amtsmannes geboren. Durch seine Herkunft war er mit der deutschen „Kleinstaaterei“ biografisch vertraut. Die sogenannten Ernestinischen Herzogtümer auf dem Territorium der heutigen Bundesländer Thüringen und Sachsen, die auf den Herzog und Kurfürsten Ernst von Sachsen-Wittenberg zurückgingen, waren seit dem 15. Jahrhundert durch Erbteilung in immer kleinere Staaten zerfallen, die politisch vergleichsweise wenig Gewicht hatten. Nach seiner Zeit auf dem Lyzeum in Meiningen begann Schüler 1816 ein juristisches Studium in Jena im benachbarten Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. 1818 wechselte er für ein Jahr an die Universität in Heidelberg – damals Teil des Großherzogtums Baden – wo er sein Studium ein Jahr später beendete. Nach Tätigkeiten als Advokat in seiner Geburtsstadt ging er 1827 in den Staatsdienst, arbeitete unter anderem für das Meininger Ministerium und seit 1838 am Oberappelationsgericht in Jena, einer gemeinsamen Institution aller Ernestinischen Herzogtümer in Thüringen. Hier war er bis zu seinem Tod im Jahr 1874 tätig, die 1841 verliehene Ehrendoktorwürde der Universität Jena ermöglichte ihm außerdem die Tätigkeit als Honorarprofessor.
Als Schüler den Wahlkreis Jena als Abgeordneter 1848 in der Paulskirche vertrat, war er also gesellschaftlich etabliert und mit 51 Jahren schon in einem fortgeschrittenen Alter. Dies bedeutete aber keinesfalls eine Mäßigung seiner radikalen demokratischen Ansichten. Der Schriftsteller Heinrich Laube, ebenfalls Abgeordneter, reiste im Mai gemeinsam mit Schüler nach Frankfurt und charakterisiert ihn bei der literarischen Verarbeitung der Zugfahrt folgendermaßen: „Der Professor neben mir, ein langer Mann mit langen Beinen, stieg zum Beispiel über alle Hindernisse so unbefangen hinweg, dass es ein Vergnügen war, solch einen Kontrast anzusehen zwischen grauem Haar und grüner Einsicht.“1
Die damals revolutionäre Idee eines vereinten Deutschlands hatte Schüler schon in jungen Jahren begeistert, als Burschenschaftler nahm er 1817 am ersten Wartburgfest teil, um mit Studenten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum einen Nationalstaat mit eigener Verfassung zu fordern. Dabei lag ihm jedoch nationaler Chauvinismus fern, wie seine späteren Reden in der Paulskirche belegen. So wandte er sich gegen „Eroberungs- und Unterdrückungskriege“ sowie explizit gegen die preußische Expansion in Polen oder die Österreichs in Italien: „Es ist gegen das deutsche Interesse, dass der deutsche Name mit Hass und Fluch beladen wird bei allen nach Freiheit und nationaler Selbständigkeit strebenden Völkern.“ Die Vorstellung, dass eine bestimmte Adelsdynastie als Souverän über Krieg und Frieden entschied und die dahinterstehenden Interessen nicht deckungsgleich mit den – von Schüler als einheitlich angenommenen – Interessen einer Nation sein könnten, war ihm unerträglich.
Grundsätzlich begegnete Schüler dem Adel mit großen Vorbehalten. In einem von Fürsten- und Königshäusern dominierten deutschen Nationalstaat machte er die Gefahr einer weitgehenden Unterdrückung, gar einer „Verschwörung gegen das Volk“ aus. Ein „Monarchenbund“ von sich gegenseitig unterstützenden Adelsgeschlechtern könnte schlechterdings einer weiterhin in Einzelstaaten fragmentierten Öffentlichkeit gegenüberstehen, so seine Befürchtung. In einer entsprechenden Atmosphäre hätten die von ihm als äußerst relevant angesehenen Bürgerrechte wohl kaum gedeihen können. Auch bei dieser Einschätzung konnte er sich auf die eigene Erfahrung stützen: So war er 1833 vom Wahlkollegium der Städte Meiningen, Wasungen und Salzungen zum Landtagsdeputierten gewählt worden und hatte hier der liberalen Opposition angehört. Nachdem sich die politische Lage im Fürstentum aber gedreht hatte und in eine repressive Richtung umgeschlagen war, wurde Schüler 1837 seitens des Oberlandesgerichts kurzerhand der Urlaub verwehrt, den er zur Wahrnehmung seiner Pflichten als Landtagsabgeordneter brauchte. Diese Erfahrung machte er ein zweites Mal, als er während seiner Zeit im Paulskirchenparlament auch zum Abgeordneten des Weimarer Landtages gewählt wurde. Hier wurde der Jurist sogar per Mehrheitsentscheid zum Präsidenten auserkoren; da der Großherzog die Personalie ablehnte, konnte er letztlich aber nur das Amt des Vizepräsidenten antreten. Die erneute Urlaubsverweigerung im Jahr 1850 beendete auch Schülers Tätigkeit im Weimarer Landtag.
Trotz der biografisch bedingten Skepsis gegenüber dynastisch bestimmten Souveränen trat Schüler in der Paulskirche nicht etwa mit der republikanischen Forderung auf, die Adelsherrschaft gänzlich zu beenden. Vielmehr plädierte er dafür, die einzelnen gekrönten Häupter in ihrer Funktion als Landesväter und -mütter zu belassen und lediglich ihre hoheitlichen Befugnisse zugunsten einer nationalstaatlichen „Zentralgewalt“ zu beschneiden. Diese wiederum sollte demokratisch legitimiert sein und von einem zivilen Präsidenten, keinesfalls aber von einem Kaiser geführt werden.
Sehr pragmatisch argumentierte der Jenaer mit der Kostenersparnis, die eine Aufgabe eines Teiles der Souveränität durch die deutschen Staaten mit sich bringen würde. So müssten zahlreiche Institutionen und Behörden nicht in jedem einzelnen Land bestehen – womöglich hatte Schüler bei dieser Überlegung das zentrale Oberappelationsgericht seiner thüringischen Heimat im Kopf –, nicht eine Vielzahl kleiner Armeen finanziert werden und nicht diverse Parallelstrukturen im Eisenbahn- und Postwesen konkurrieren. Der Handel wiederum ließe sich durch eine einheitliche Währung sowie die Normierung von Gewichts- und Maßeinheiten und dergleichen entscheidend vereinfachen, so Schüler. Den Widerstand einzelner Staaten gegen solche Maßnahmen antizipierte er mit der kühlen und nicht unrealistischen Prognose, dass die kleineren deutschen Fürstentümer ohnehin langfristig in einem der beiden großen deutschen Staaten, also Preußen oder Österreich, aufgehen und ihre politische Eigenständigkeit verlieren würden.
Schülers Vision des zukünftigen Deutschlands war generell stark föderalistisch geprägt und nahm Strukturen vorweg, die sich letztlich im demokratischen Deutschland der Weimarer Republik und später der Bundesrepublik Bahn brechen sollten. Die zentralistische Gegenposition, wie sie sich mit der Reichsgründung 1871 schließlich durchsetzte, beurteilte er schon als Paulskirchenabgeordneter hellsichtig als äußerst problematisch. Dabei störte er sich nicht nur daran, dass an der Spitze des Deutschen Reichs ein Kaiser stand, zumal aus dem Hause Hohenzollern. In der Paulskirche hatte er sich ausdrücklich vom Vorbild Frankreichs distanziert, denn auch eine stark zentralistische Republik bewertete er kritisch.
Nicht nur in dieser Hinsicht lesen sich Schülers Texte und Reden aus heutiger Perspektive fast modern. So beschränkte sich die Demokratie in seinem Verständnis nicht auf eine in der Verfassung verbriefte Wahl der Regierung durch das Volk. Er forderte sie auch als bürgerrechtlichen Ausgangspunkt und zivilgesellschaftliche Grundlage ein: „Es muss daher das demokratische Prinzip der Selbstregierung durch alle bürgerlichen Verhältnisse hindurchgehen. Das Individuum, die Vereine, die Gemeinden, die Provinzen müssen sich möglichst frei und von der höchsten Staatsgewalt ungehindert bewegen und sich in ihrer Eigentümlichkeit ausbilden können.“ Er machte bei sich selbst keine Ausnahme: Als er in seinem Jenaer Wahlbezirk durch die Stimmen der Mehrheit eines Wahlmännergremiums zum Paulskirchenabgeordneten bestimmt wurde, bemühte er sich, dies durch nachträgliche Urwahlen bestätigen zu lassen.
Schüler verband seine Forderung nach Legitimation durch eine möglichst direkte Demokratie mit einer Selbstverpflichtung zu weitgehender Transparenz – womit er sich wiederum problemlos in die Debatten unserer Tage einschalten könnte. In regelmäßigen Berichten, die auf seinen Wunsch über die Presse Verbreitung fanden, schrieb er seinen Wählern sowie seiner Familie von seiner Arbeit in der Paulskirche. Die Texte richteten sich an eine Leserschaft, für die die parlamentarische Tätigkeit etwas Neues und Erklärungswürdiges war. Schüler beschrieb die sich herausbildenden Parteien und umriss ihr inhaltliches Profil, erklärte die parlamentarischen Prozesse und fasste die Debatten zusammen. Die Begeisterung des seine frischen Eindrücke wiedergebenden Verfassers wirkt dabei bis heute ansteckend.
Als Mitglied des Verfassungsausschusses wirkte Gottlieb Christian Schüler an zentraler Stelle des jungen Parlaments. Seine Berichte hatten daher nicht nur für die Zeitgenossen Nachrichtenwert, sondern dienen der historischen Forschung bis heute als wertvolle Quellen der deutschen Demokratiegeschichte. Als Angehöriger der linken Minderheit konnte der Jenaer Jurist zwar viele seiner auf umfassende Bürgerrechte abzielenden Forderungen nicht durchsetzen, äußerte sich im Ergebnis aber sehr positiv über die Arbeit des Ausschusses: „Doch muss man so viel anerkennen, dass die Anträge des Ausschusses durchgängig von einem freisinnigen Geiste ausgehen, und dass, wenn auch die linke Seite noch manche Verbesserung wünscht, doch schon die Mehrheitsanträge so viel Freiheit gewähren werden, als sie bis jetzt wohl kaum in irgendeinem Land der Welt ist.“
Schüler gehörte dem Parlament bis zum Schluss an und vollzog auch den Umzug von Frankfurt nach Stuttgart in der Hoffnung auf eine Wirkmächtigkeit des „Rumpfparlaments“. Nach der endgültigen Auflösung der ersten demokratisch gewählten Volksvertretung Deutschlands kehrte er nach Jena zurück. Hier trug ihm sein radikal-demokratisches Engagement vor dem Hintergrund der veränderten politischen Großwetterlage zwar eine gesellschaftliche Randstellung ein, von Restriktionen blieb er aber weitgehend verschont. Keinesfalls ergab sich die Notwendigkeit zum Gang ins Exil, mit der sich andere „48er“ konfrontiert sahen. Tatschlich betätigte sich Schüler einige Jahre später erneut politisch. 1860 trat er dem Deutschen Nationalverein bei, wenngleich er die sich bald abzeichnende Befürwortung der kleindeutschen Lösung unter preußischer Führung durch diese Sammlungsbewegung sehr skeptisch sah. 1864 bis 1868 gehörte er schließlich dem Jenaer Gemeinderat an, seit 1866 als Vorsitzender. Spätestens mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft war Schüler in seiner Heimatstadt vollständig rehabilitiert, ohne dass er von seinen politischen Überzeugungen zurückgetreten wäre.
Auch wenn Gottlieb Christian Schüler trotz seiner historischen Bedeutung nicht zu den bekanntesten Abgeordneten der Paulskirche gehört, ist die Auseinandersetzung mit seinen Texten und Redemanuskripten absolut lohnenswert. Seine idealistische und gleichzeitig unvoreingenommene Herangehensweise an den Parlamentarismus ist besonders heute, in einer Zeit also, in der die Demokratie für viele zu einer nebensächlichen Gewohnheit avanciert ist, inspirierend und nicht nur historisch aufschlussreich.
Die Transparenz, die Schüler mit seinen Briefen für seine Wähler in Thüringen herstellte, ist in der heutigen parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik weitgehend Standard. Die Debatten des Deutschen Bundestags können im Livestream verfolgt werden, eine vielstimmige Presselandschaft kommentiert das politische Geschehen, und die Parlamente stellen zahlreiche Dokumente zu ihrer eigenen Tätigkeit zum digitalen Abruf bereit.
Folgt man den Schlagzeilen der deutschen Hauptstadtpresse, könnte man meinen, die relevanten politischen Entscheidungen würden allein in Berlin getroffen. Doch die Realität ist im Jahr 2024 eine andere und sehr viel näher an Schülers föderalistischem Ideal. Die Länderparlamente, Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen und Stadträte verhandeln zentrale politische Fragen, die sich oftmals viel unmittelbarer auf den Alltag der Menschen auswirken als die Entscheidungen der Bundespolitik. In Frankfurt etwa tagt heute keine 200 Meter von der Paulskirche entfernt das Stadtparlament im Rathaus Römer und debattiert Fragen wie den zukünftigen Standort der städtischen Bühnen, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die städtebauliche Gestalt neuer Wohnquartiere oder die Verteilung der städtischen Steuereinnahmen bei den jährlichen Haushaltsdebatten. Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sowie der einzelnen Ausschüsse finden öffentlich statt, wie in anderen deutschen Städten und Gemeinden auch. Bürgerinnen und Bürger können die politischen Debatten mit geringem Aufwand selbst verfolgen und die Arbeit ihrer gewählten Volksvertreterinnen und -vertreter kontrollieren. Wenn die Lektüre dieses Buches den einen oder die andere durch das historische Beispiel motiviert, dieses heute selbstverständliche Recht gelegentlich wahrzunehmen, wäre das eine gute Nachricht für die parlamentarische Demokratie.
1 Laube, Heinrich: Das erste deutsche Parlament. Erster Band. Leipzig 1849, S. 7.
An meine lieben Mitbürger.
Wenn auch ich nach der hohen Ehre strebe, von meinen lieben Mitbürgern als Abgeordneter zu der konstituierenden Nationalversammlung gewählt zu werden, so kann mich nur meine heiße Liebe zu meinem deutschen Vaterland, mein sehnlichster Wunsch, zu dessen Einheit, Freiheit, Ruhm und Glück nach meinen schwachen Kräften mitzuwirken, dazu veranlassen; für mich persönlich ist es nur mit den größten Aufopferungen verbunden. Aber kein Opfer soll mir zu groß, keine Last zu schwer sein, wenn es mein geliebtes Vaterland gilt.
Deshalb lege auch ich meinen Mitbürgern mein politisches Glaubensbekenntnis vor. Weiterlesen
Man pflegt dabei gewöhnlich mit einer Antwort auf die Frage zu beginnen, ob man für eine Republik oder für konstitutionelle Monarchie sei. Das sind aber, dünkt mich, nicht die eigentlichen Gegensätze, um welche es sich zunächst dreht. Die erste Frage ist vielmehr die:
Soll Deutschland ein einheitlicher Staat werden mit gänzlicher Auflösung der 38 Einzelstaaten, aus denen es jetzt besteht,
oder
Soll vielmehr Deutschland ein aus den 38 Einzelstaaten zusammengesetzter Bundesstaat werden?
Erst dann, wenn man sich für einen ganz einheitlichen Staat erklärt hätte, würde die weitere Unterfrage entstehen:
Soll die Regierungsform dieses einheitlichen. Staates eine monarchische oder eine republikanische werden?
Handelte es sich um die Frage: Republik oder Monarchie? im Allgemeinen, so würde ich auch dann der Meinung sein, die erbliche Monarchie, jedoch auf breitester volkstümlicher Grundlage, sei der Republik vorzuziehen, schon deshalb, weil die fortgeerbte Liebe und Anhänglichkeit an die regierende Familie dem Staat eine Festigkeit und Haltbarkeit gibt, welche die Republik, die einen solchen bleibenden und persönlichen Repräsentanten der Staatseinheit nicht hat, häufig entbehrt.
Handelte es sich aber mehr um die Frage, soll Deutschland ein aus 34 Monarchien und 4 freien Städten zusammengesetzter Bundesstaat werden? so muss ich gestehen, dass ich eine solche Zerstückelung Deutschlands in viele unter sich selbst ungleiche und den natürlichen Stammesunterschieden nicht entsprechende Monarchien niemals gutheißen würde, wenn sie erst neu vorgenommen werden sollte, wenn sie nicht schon bestünde. Diese Zerstückelung halte-ich für die Ursache alles unser Nationalunglücks, unserer Schwäche dem Ausland gegenüber, unserer Unfreiheit, Klein- und Engherzigkeit im Innern. Aber sollen denn deshalb unsere 34 Fürsten sofort abgesetzt werden? Das wollen wir nicht, das können wir nicht. Die deutschen Völker haben sich daran gewöhnt, sie hängen an ihren Fürstenhäusern. Ein versuchter plötzlicher Umsturz des Bestehenden würde zu den Schrecken des Bürgerkriegs, zur gänzlichen Zerrüttung Deutschlands führen, eine gänzliche Vernichtung der jetzigen Verhältnisse würde zugleich die Elemente unserer Bildung vernichten. Man mache keine gefährlichen Experimente und springe nicht in ein Extrem über. Unsere Einzelstaaten haben noch zu viel Lebensfähigkeit. So lange aber eine Einrichtung noch nicht abgestorben ist, muss man sie nicht begraben wollen.
Aber möglichst unschädlich machen muss man diese Zerstückelung. Man muss, ohne die Einzelstaaten aufzulösen, das ganze Deutschland mit dem Geist der Einheit zu durchdringen, sein Volksleben und seine Interessen innigst miteinander zu verschmelzen suchen. Das geschieht durch eine volkstümliche und nur unter dem Einfluss des Volksgeistes stehende Zentralbehörde, welche die höchste Gewalt in Deutschland ausübt und welcher die Einzelstaaten unterworfen sind. An der Spitze soll nicht ein erblicher Kaiser stehen, sondern ein auf Zeit gewählter Präsident. Denn was man auch gegen eine wiederkehrende Wahl des Oberhauptes mit Recht sagen mag, so ist diese Einrichtung doch notwendig, solange Deutschland aus monarchischen Einzelstaaten besteht; wenn das monarchische Element in der Mitte ist, so muss oben drüber wieder ein volkstümliches stehen; stände die zweifache monarchische Gewalt übereinander, so würde durch ihre Verbindung die Freiheit Deutschlands erdrückt werden. Auch ist nicht außer Berücksichtigung zu lassen, dass Deutschland an 34 fürstlichen Civillisten1 schon schwer genug zu tragen hat und nicht gern noch eine kaiserliche obendrein auf sich nehmen wird.
Zur ausschließlichen Kompetenz der Zentralgewalt muss gehören:
das Recht über Krieg und Frieden, das Recht der Gesandtschaften, der Bündnisse, das Heerwesen, die Kriegsflotte,
die Gesetzgebung in bürgerlichen und peinlichen2 Sachen und im Gerichtswesen, Handelsgesetzgebung,
Herstellung einer Einheit in Münze, Maß, Gewicht,
Anordnung aller Einrichtungen, welche als für ganz Deutschland gemeinsam angesehen werden müssen, Posten, Eisenbahnen usw.
Auch muss die Zentralgewalt auf Abstellung von Missbräuchen in den Einzelstaaten und auf Ersparnisse im Haushalt derselben hinwirken können. Sie muss ein höchstes Gericht für Streitigkeiten der Einzelstaaten untereinander sowie der Fürsten und der Völker gegeneinander errichten.
Ist so eine Einheit Deutschlands hergestellt, so wird sich das Nationalbewusstsein heben und kräftigen, ein großer und freier Geist, ein Geist der Bruderliebe und des Patriotismus wird an die Stelle der Engherzigkeit, des Philistertums und des Egoismus treten. Der friedliche und ruhige Weg zu allen künftigen Verbesserungen wird angebahnt sein.
Für die politische Gestaltung Deutschlands auf diese Grundlage hin werde ich kämpfen aus allen Kräften, so lange es zu kämpfen gilt, solange die Sache der konstituierenden Nationalversammlung noch nicht entschieden ist. Hat sich aber einmal die Nation durch die Mehrheit ihrer Vertreter für eine bestimmte Regierungsform entschieden, so geht mir dann der Wille der Nation über alle Theorie, und die Regierungsform soll mir die liebste sein, welche die Nationalversammlung beschlossen hat.
In Beziehung auf die Einzelheiten der Zusammensetzung der Zentralgewalt habe ich zwar auch bestimmte Ansichten, allein ich möchte mich darüber nicht gern auf bindende Weise aussprechen, sondern muss bitten. meinem Urteil noch Spielraum zu gewähren und mir zu gestatten, den Belehrungen und Eindrücken, welche die Diskussion hervorbringt, zugänglich bleiben zu können.
Als Volksrechte, welche durch die konstituierende Nationalversammlung jedenfalls fest und unter den Schutz der Zentralgewalt gestellt werden müssen, bezeichne ich:
Sicherstellung der Person und des Eigentums.
Volle Pressefreiheit ohne das System der Kautionen und Konzessionen.
Rechtliche Gleichstellung aller Religionsparteien, Unabhängigkeit der Kirche vom Staat.
Allgemeines deutsches Staatsbürgerrecht und Freizügigkeit.
Allgemeine deutsche Volksbewaffnung, möglichste Verminderung der stehenden Heere.
Aufhebung der inneren Landes- wie Schifffahrtszölle.
Aufhebung der auf den notwendigen Lebensbedürfnissen haftenden Steuern, der Salz-, Fleisch-, Malzsteuern usw. Einführung einer Einkommenssteuer, welche die Ärmeren erleichtert und mehr auf die Reicheren fällt.
Aufhebung der den Landmann und den Gewerbetreibenden drückenden Lasten.
Freie Gemeindeverfassung.
Freies Vereins- und Versammlungsrecht.
Aufhebung der auf Geburt, Rang und Stand ruhenden Vorrechte; gleiche Berechtigung zu Staats- und Gemeindeämtern.
Hebung der Schulen und des Lehrerstandes.
Volkstümliches Recht, volkstümliche Gerichtsverfassung mit Mündlichkeit und Öffentlichkeit; in Strafsachen mit Schwurgerichten,
dadurch zugleich Verminderung der Beamtenheere.
Sorge für das geistige und körperliche Wohl der arbeitenden Klassen.
Mitbürger, ich habe unter Euch gelebt seit vielen Jahren. Meinen Charakter kennt Ihr. Ich habe die Sache der Freiheit ergriffen, als es noch mit großer Gefahr für mich verknüpft war; ich habe mein ganzes Leben lang die Sache der Wahrheit, der Freiheit und des Rechts nicht einen Augenblick verleugnet, ich habe dafür, wenn auch in engeren Kreisen, gesprochen und gekämpft ohne Menschenfurcht und Scheu. Der Sache des deutschen Volkes gebe ich mich hin mit voller Aufopferung und Selbstverleugnung. Durch langjährige Erfahrung kenne ich die Mängel unseres Staats- und Rechtszustandes, die Bedürfnisse unseres Volkes. Den Fragen der Gesetzgebung und eines volkstümlichen Rechtes habe ich seit langer Zeit mein Nachdenken gewidmet. Ich bin im Bewusstsein der Zeit und glaube frei zu sein von den Vorurteilen und der Anschauungsweise der Bürokratie.
Nur durch offenes und entschiedenes Eingehen in den Geist der Zeit, nur durch Förderung der Sache des Fortschritts und der Volksfreiheit können Revolutionen vermieden werden, durch halbe Maßregeln oder durch reaktionäre Bewegungen werden sie herbeigeführt. Ich werde mich an die Seite des entschiedenen Fortschritts anschließen, aber lasst Euch nicht ins Ohr blasen, ich sei ein Republikaner.
So gestattet mir denn, durch Eure Wahl unmittelbar teilzunehmen an der Herbeiführung einer schönen Zeit, einer herrlichen Zukunft! Ich werde es für die höchste Ehre und das größte Glück meines Lebens halten.
Jena, am heiligen Ostermorgen 1848.
C. Schüler
1 Damit wird der jährliche Betrag bezeichnet, der einem Monarchen für die Unterhaltung sämtlicher Gebäude sowie für seine Angehörigen und Bediensteten aus der Staatskasse gewährt wird.
2 Der Begriff „peinlich“ (von lat. Poena = Strafe) meint in diesem Zusammenhang Leibes- und Lebensstrafen (etwa Gefängnis-, Zuchthaus- oder Todesstrafen).
Frankf. Dienstags d. 16 Mai 1848
Bestes Mutterchen
Heute Nachmittag, 3 Uhr, werden wir eine Sitzung haben, um über die förmliche Eröffnung des Parlaments zu beraten. Gestern wohnte ich einer sehr interessanten Sitzung des Fünfziger Ausschusses bei.1 Weiterlesen
Ich habe gestern mehr Bekanntschaften gemacht als während des ganzen Vorparlaments. Es hat sich unter den bis jetzt hier anwesenden Abgeordneten schon ein sehr guter Geist der Eintracht, des Zusammenhaltens, der Kraft und der Entschiedenheit eingestellt, und ich sehe jetzt schon der Zukunft mit viel mehr Zuversicht und Hoffnung entgegen als noch vor wenigen Tagen. Ich glaube, dass schon wenig Tage nach Eröffnung der Nationalversammlung durch die Festigkeit u. Kraft derselben, durch rasches u. entschlossenes Handeln, sich die Zuversicht u. das Vertrauen in Deutschland wieder herstellen werden, und dadurch wird hoffentlich zugleich die allgemeine Geschäftsstockung, welche uns im gegenwärtigen Augenblick durch die gänzliche Brotlosigkeit der Arbeiter die größten Gefahren zu bereiten droht, ihr Ende erreichen.
In meinem Stübchen habe ich mich ganz wohnlich eingerichtet, und es ist mir, als hätte ich schon lange da gewohnt. Wahrscheinlich wird die förmliche u. feierliche Eröffnung der Nationalversammlung schon nächsten Donnerstag, übermorgen, vor sich gehen. Dann wirds alle Tage was Neues geben. (…)
Am 18. Mai. Noch immer habe ich keinen Brief von zu Hause. Es laufen zwar häufig Briefe an mich ein, aber wenn ich sie erbreche, sind sie immer nur Selbstempfehlungen hiesiger Tuch-, Galanterie-, Modewaren-, Zigarren- u. anderer Händler. Auch haben sich wieder zwei Bediente u. ein Sekretär bei mir angemeldet, und die Handwerksburschen aus Jena u. Weimar bemühen sich drei Tage hoch, um die Landsmannschaft aufzusuchen u. sich ein Reisegeld zu erbitten. Es gibt jetzt jeden Abend Straßenkrawall hier, täglich werden welche arretiert, welche die Republik ausrufen. Auch die umliegenden Ortschaften sind sehr republikanisch. Die Regierungen tragen aber auch nach Möglichkeit dazu bei, das Volk aufzureizen und misstrauisch zu machen. So jetzt wieder der König v. Preußen. Der hiesige Gasthof: zum König v. Preußen, hat seinen Namen umgeändert in: Deutscher Hof. Die linke Seite des Parlaments wird dort heute eine Vorberatung halten über die Wahl eines Präsidenten; die rechte Seite wird für Gagern2 sein, die linke für Robert Blum3, ich glaube, dass die rechte Seite wenigstens in der Präsidentenfrage die entschiedene Majorität haben wird. – Die Stadt gewinnt ein festliches Ansehen. Die seit sechs Wochen aufbewahrten schwarz-rot-goldenen Fahnen flattern plötzlich wieder aus allen Fenstern.
Am 19. Mai. Gestern Nachm., 4 Uhr, ist die Nationalversammlung feierlich eröffnet worden unter Glockengeläute u. Kanonen-Donner. Die erste Sitzung ging mit Formalien dahin. Gestern Abend bis 11 Uhr waren noch vorbereitende Zusammenkünfte wegen der Wahl eines provisorischen Präsidenten. Die linke Seite besteht nicht auf Robert Blum, sondern wird, um eine Vermittlung mit der rechten Seite herbeizuführen, Soiron4 ihre Stimme geben, u. man glaubt, die rechte Seite werde sich dem anschließen. Zum Zeitunglesen habe ich hier noch nicht kommen können, habe aber erzählen hören, im Frkf. Journal habe von einer Zusammenkunft von Weimarern u. Jenensern auf der Oelmühle gestanden. Wie ist es damit? Schreibe mir doch das Nähere darüber. Hat es nur gestern in unserem Garten auch so schön geregnet wie hier? Die Luft hat sich aufs wohltätigste abgekühlt.
Ich schließe nunmehr diesen Brief, ohne dass ich bis jetzt irgendeine Nachricht von zu Hause hätte. Schreibe ja recht bald. Grüße alle, alle vielmals von mir, besonders auch die Weimarischen u. Meininger Jungen5, an die ich nicht besonders schreiben kann, u. gib mir Nachricht, wie es ihnen geht. Hoffentlich seid ihr noch alle gesund, namentlich auch Hermann6 u. Bernhard7.
Lebt wohl einsteilen. Um 8 Uhr muss ich schon wieder in die Versammlung.
Euer treuer Vater
1 Der Fünfziger-Ausschuss sollte auf Beschluss des Vorparlaments den Bundestag bis zum Zusammentritt der Nationalversammlung unterstützen und überwachen.
2 Heinrich von Gagern (1799-1880) war seit März 1848 Ministerpräsident der hessischen Märzregierung.
3 Siehe den Robert Blum-Band dieser Edition.
4 Alexander von Soiron (1806-1855), Advokat aus Mannheim, war zuvor Präsident des Fünfziger-Ausschusses.
5 Gemeint sind Schülers Söhne Fritz (geb. 1829) und Rudolph (geb. 1832), die in Weimar das Gymnasium besuchen, sowie Ludwig (geb. 1831) und Richard (geb. 1824), die in Meiningen zur Schule gehen.
6 Hermann Schüler (geb. 1825), der älteste Sohn, Pharmazie- und Philosophiestudent in Jena.
7 Bernhard Schüler (geb. 1846), der jüngste Sohn.
Schon seit längerer Zeit fühlte ich die Verpflichtung und das Bedürfnis, meinen Mitbürgern, in deren ehrenvollem Auftrag ich mich hier befinde, öftere Mitteilungen über den Gang der Verhandlungen der konstituierenden National-Versammlung zu machen, teils weil ich ihnen Rechenschaft schuldig bin, teils aber auch in meinem eigenen Interesse, um falschen Auffassungen und Missdeutungen meiner Abstimmungen zu begegnen. Weiterlesen
Ich stand jedoch anfänglich an, die Jenaischen Wochenblätter zu diesen Mitteilungen zu benutzen, indem diese nur in Jena, nicht aber in den übrigen Städten und Ortschaften meines Wahlbezirks gelesen werden. Da sich mir jedoch ein anderes Organ nicht darbietet, die Redaktion der Jen. Wochenbl. aber mit dankenswerter Bereitwilligkeit mir ihre Vermittlung zugesagt hat, so habe ich dieses Anerbieten ergriffen, indem es doch besser ist, ich mache einem Teil meiner Wähler meine Mitteilung als gar niemandem, und indem ja diese Blätter auch den Bewohnern der übrigen Ortschaften des Wahlbezirks zugänglich sind, wenn sie sich dafür interessieren.
Ich werde natürlich nicht das nochmals mitteilen, was in allen Zeitungen und in den stenographischen Berichten steht, aber ich möchte meine Mitbürger ein wenig hinter die Kulissen sehen lassen, sie ein wenig mit dem Parteigetriebe bekannt machen, welches nicht jedem offen vorliegt und doch zum Verständnis der Verhandlungen so wichtig ist. Ich beginne mit der Schilderung der einzelnen Parteien und deren Schattierungen.
Sogleich nach dem Zusammentreten der Nationalversammlung war zu bemerken, dass sich dieselbe in zwei Parteien teile, welche sich auch schon im Vorparlament und im Fünfziger-Ausschuss herausgestellt hatten; die eine Partei, die linke Seite genannt, bestand etwa aus einem Drittel, die andere, die rechte Seite, aus etwa zwei Dritteln der Mitglieder der Versammlung. Man versuchte anfänglich von der rechten Seite her, dieser Partei den Namen der konstitutionell-monarchischen beizulegen und die linke Seite die republikanische Partei zu nennen, allein diese Benennungen haben keinen Eingang gefunden, denn sie sind ganz unrichtig; es handelt sich bei der Parteistellung gar nicht um die theoretische Frage über Republik oder konstitutionelle Monarchie, sondern um das mehr oder weniger entschiedene Ergreifen derjenigen Maßregeln, welche durch die gegenwärtige ganz eigentümliche und verwickelte Lage Deutschlands geboten sind, es gibt auch auf der linken Seite viele, welche an sich für die konstitutionelle Monarchie sind, und es gibt dagegen auch auf der rechten Seite Männer, welche erklären, sie hielten an sich und der Theorie nach die Republik für die bessere Staatsform. Republikaner in dem Sinne, dass sie die jetzt bestehenden Monarchien in den einzelnen deutschen Ländern sogleich ganz aufheben wollten, gibt es auch auf der äußersten Linken fast gar nicht. Am wenigsten sind die Mitglieder der linken Seite mit denen zu verwechseln, welche Aufruhr und Unordnung hervorrufen wollen, sie wollen vielmehr Ordnung und Gesetzlichkeit dauernd befestigen, und sie unterwerfen sich aufrichtig den Beschlüssen der Mehrheit, wenn ihnen diese auch nicht angenehm sind.
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Seiten der Nationalversammlung ist vielmehr der, dass die linke Seite die errungene Freiheit des Volks in ihrer vollen Ausdehnung und die Einheit Deutschland gegenüber den Sonderbestrebungen der mächtigeren deutschen Monarchen rasch und entschieden gesetzlich feststellen, dass sie die höchste Autorität in Deutschland in die Hände der Nationalversammlung und der Zentralgewalt legen will, um Ruhe und Ordnung herstellen und zugleich den allenthalben auftauchenden Reaktionsgelüsten kräftig entgegentreten zu können, damit sie sich in dem Stand erhalte, die zu beschließende Verfassung ungehindert von dem Widerstreben der Einzel-Regierungen einführen zu können. Die rechte Seite dagegen will mehr die bestehenden Zustände aufrechterhalten, sie will sich um die laufenden Vorgänge in Deutschland so wenig als möglich kümmern, sondern in Ruhe die Verfassung ausarbeiten und dann über deren Einführung eine Vereinbarung mit den deutschen Fürsten treffen.
Beide Hauptparteien waren natürlich im Anfange nicht organisiert, erst allmählig fanden sich die Gleichgesinnten mehr zusammen. Man versuchte, für die Parteien Programme (politische Glaubensbekenntnisse) aufzustellen, die die Mitglieder unterschreiben sollten, man fand aber bald, dass sich die Verschiedenheiten nicht in bestimmte Formeln fassen ließen; bei verschiedenen Fragen gestalteten sich die Parteien wieder anders, es musste mehr dem Gefühl jedes Einzelnen anheimgestellt werden, zu welcher Partei er eigentlich gehöre.
Seit Beschließung des Gesetzes über die provisorische Zentralgewalt gestalteten sich die Parteien bestimmter, man sonderte sich in einzelne Klubs ab, welche sich mehr und mehr abschlossen, die einzelnen Klubs nahmen Statuten an, welche aber mehr die Organisation, die Disziplin und Taktik der Klubs betrafen, von Aufstellung bestimmt formulierter Glaubensbekenntnisse sah man mehr und mehr ab. Doch sind natürlich den Mitgliedern die Ansichten und Grundsätze des Klubs bekannt, und wer gegen die Grundsätze des Klubs spricht oder abstimmt, muss natürlich aus dem Klub austreten.
Gegenwärtig bestehen, von der linken nach der rechten Seite zugerechnet, folgende Klubs:
1) Der Klub im Donnersberg1, sonst im Holländischen Hof oder Hotel Schröter, dieser Klub bildet die äußerste Linke, er nennt sich radikal-demokratisch, seine Mitglieder sind entschiedene Republikaner, ohne jedoch in den Einzelstaaten Deutschlands die erbliche Fürstenwürde gegen den Willen der Bevölkerung aufheben zu wollen. Bezüglich der völkerrechtlichen Verhältnisse stellen sie das Prinzip der Humanität, der Gerechtigkeit, der freien Selbstbestimmung jedes Volkes oben an und verdammen alle Eroberungskriege. Auf das Prinzip der Nationalität legen ihre Wortführer wohl zu wenig Gewicht. Der Klub besteht aus etwa 40 Mitgliedern. Ruge 2 und Zitz 3 gelten als die Führer, obwohl Zitz in der Nationalversammlung wenig hervortritt. Es sind ausgezeichnete Männer und Redner von Geist und Feuer in diesem Klub, darunter mögen nur genannt werden: Schmidt aus Löwenberg in Schlesien, Zimmermannaus Stuttgart (bekannt durch seine Geschichte des Bauernkriegs), Hagen aus Heidelberg, Simon aus Trier, Wesendonck aus Düsseldorf, Kollaczek aus Schlesien. Auch Schaffrath und Günther aus Sachsen, Wiesner aus Wien, Brentano etc. gehören diesem Klub an4.
2) Der Klub zum Deutschen Hof; er wird gewöhnlich gemeint, wenn man von der linken Seite ohne weiteren Beisatz spricht. Dieser Klub, welchem ich selbst angehöre, will die durch die Revolution erlangte oder erstrebte Volksfreiheit in ihrer vollen Ausdehnung und in allen ihren Konsequenzen; in Beziehung auf die Verfassung der Einzelstaaten geht er davon aus, dass die Revolution (wie es in der Paulskirche ausgedrückt wurde) vor den Thronen stehen geblieben ist, dass also die Einzelstaaten ihre Fürsten behalten wollten, dass aber Adel und Hofschranzenwesen, Pomp und Etikette, Beamtenherrschaft und Vielregieren keineswegs dem deutschen Volke besonders angenehme Dinge sind und soweit als möglich aufgehoben oder beschränkt werden müssen, dass möglichste Einfachheit und Sparsamkeit im Staatswesen einzuführen ist. Während aber in den Einzelstaaten das Bestehen der erblichen Monarchie unangetastet bleiben soll, ist der Klub darin einverstanden, dass der Gesamtstaat Deutschland keinen Obermonarchen, keinen Kaiser, erhalten, sondern eine den demokratischen Prinzipien entsprechende Verfassung bekommen soll, denn wie auch das einzelne Klubmitglied über Monarchie oder Republik an sich denken mag, so stimmen sie doch darin überein, dass, solange die Untermonarchien bestehen, eine so ganz eigentümliche Verbindung zwischen einem Obermonarchen und 34 Untermonarchen, die sich gegenseitig stützen und tragen, die ihre Kräfte gegen die Freiheitsideen vereinigen würden, einen unerträglichen Druck hervorbringen müsste, schlimmer als der alte Bundestag, welcher nur in neuer Gestalt mit einem Oberpolizeidirektor an der Spitze, dadurch auferstehen würde. Auch an die Kosten einer kaiserlichen Civilliste und eines kaiserlichen Hofstaates neben den schon bestehenden 34 Civillisten darf gedacht werden, denn wenn gleich eine gute Regierungsform niemals zu teuer erkauft werden kann, so ist doch jeder Groschen zu bedauern, welcher aufgewendet wird, um eine schlechte Regierungsform herzustellen. Der Deutsche Hof legt viel mehr Gewicht auf das Prinzip der Nationalität und auf die Einheit Deutschlands als der Donnersberg, er achtet aber auch bei anderen Nationen ihre Freiheit und Selbstständigkeit und verabscheut jeden Eroberungs- und Unterdrückungskrieg. Sein deutscher Patriotismus verleitet ihn nicht zur Ungerechtigkeit gegen andere Völker.
Der Deutsche Hof ist das Stammhaus der ganzen linken Seite, die übrigen Fraktionen haben sich allmählig von ihm abgespalten; aber sie betrachten den Deutschen Hof fortwährend als das Mutterhaus und haben freien Zutritt zu seinen Klubsitzungen. Sollen gemeinschaftliche Beratungen aller Schattierungen der linken Seite sein, so kommen sie im Deutschen Hof zusammen. Die Mitglieder des Deutschen Hofs stehen mit den Mitgliedern des Donnersbergs und der Westendhall in den persönlich freundschaftlichsten Verhältnissen, sie verteidigen und schützen sich gegenseitig gegen die Bedrückungen und Anfeindungen der rechten Seite. Der Deutsche Hof hält gute Manneszucht, die Unordnungen und Unterbrechungen in den Sitzungen der Nationalversammlung, welche so oft von der linken Seite ausgehen, fallen nicht dem Deutschen Hof zur Last, sondern fast ausschließlich dem Donnersberg, welcher keineswegs gut diszipliniert ist. Da jedoch die Mitglieder der verschiedenen Klubs der linken Seite in der Paulskirche vermischt untereinander sitzen, so müssen wir es mit auf uns nehmen, wenn der Donnersberg Unordnungen anfängt. Unter den Mitgliedern des Deutschen Hofs ist viel gesunder, frischer, freier und mutiger Sinn.
Der Klub zum Deutschen Hof hat über 70 Mitglieder. Blum5und Vogt sind die Hauptredner. Auch Itzstein gehört zu diesem Klub, aber er kommt nicht häufig in die Klubsitzungen und spricht noch seltener darin. Eins der ausgezeichnetsten Mitglieder ist Löwe aus Calve. Auch Nauwerck aus Berlin, Rösler aus Oels etc. verdienen genannt zu werden.6 Die meisten Sachsen, fast alle Rheinbaiern, viele Württemberger, Schlesier, Österreicher etc. gehören diesem Klub an.
3) der Klub in Westendhall (weshalb die Mitglieder gewöhnlich Westindier genannt werden). Es ist dies eine Schattierung der reinen linken Seite; er stimmt in seinen Grundsätzen und in seiner Abstimmung ganz mit dem Deutschen Hof zusammen, nur könnte man sagen, dass die Westindier die Sachen etwas mehr staatsmännisch, fast diplomatisch behandeln gegenüber der naiven Treuherzigkeit der meisten Mitglieder des Deutschen Hofs, welche mehr Volksmänner als Staatsmänner sind. Westendhall birgt daher auch mehr künftig mögliche Minister in seinem Schoße als der Deutsche Hof. Auch persönlich sind die Westindier uns eng befreundet, und wir haben bereits die vollständige Vereinigung beider Klubs versucht. Nur an einigen Zufälligkeiten und an wenigen Personen ist es gescheitert. Bei allen wichtigen Angelegenheiten beschicken und besprechen wir uns. Dagegen sind die Westindier in etwas gespanntem Verhältnis zu dem Württemberger Hof. Die Führer der Westendhall gehörten nämlich früher selbst zum Klub des Württemberger Hofs, den sie erst gestiftet hatten, sie traten aber dort aus, weil der Württemberger Hof durch Eintritt vieler Mitglieder aus dem Zentrum immer mehr zu einem linken Zentrum als zu einer Schattierung der reinen linken Seite wurde. Westendhall besteht aus 36 Mitglieder. Als die hauptsächlichsten müssen genannt werden: Raveaux, die beiden Simon aus Breslau. Rappard, Schoder, Venedey, Vischer aus Tübingen, Reh aus Darmstadt, Jucho aus Frankfurt u. A. 7
4) Der Klub im Württemberger Hof, das linke Zentrum. Dieser Klub nimmt in Übereinstimmung mit der reinen linken Seite das Prinzip der Volkssouveränität an und will, dass die künftige Reichsverfassung dieses Prinzip gewährleiste. Er erkennt die Nationalversammlung für selbstständig konstituierend, unabhängig von der Zustimmung der deutschen Fürsten. Er will die Selbstständigkeit der einzelnen deutschen Staaten so weit, aber auch nur so weit beschränkt haben, als zur Herstellung einer kräftigen Einheit nötig ist. Stimmen aber auch hiernach die ausgesprochenen Grundsätze des Württemberger Hofs mit denen der reinen linken Seite im Wesentlichen zusammen, so weicht er doch in seinen Abstimmungen häufig von uns ab. Der Württemberger Hof hat es sich nämlich zur besonderen Aufgabe gemacht, ein vermittelndes Element zu sein und von den Prinzipien so viel nachzugeben, als es die praktischen Rücksichten verlangen, er ist daher weder warm noch kalt. Bei persönlichen Fragen nimmt er meistens die Partei für die rechte Seite gegen die linke, und hilft uns mit tyrannisieren. Einige Mal, wo wir gemeinschaftliche Maßregeln verabredet hatten, hat er uns bei der Ausführung im Stich gelassen. Es ist daher bei der Linken im Allgemeinen keine günstige Stimmung für den Württemberger Hof, und manche meinen, sie wollten lieber mit offenen und entschiedenen Gegnern zu tun haben als mit den halben und unzuverlässigen Freunden.
Der Württemberger Hof hat 66 Mitglieder. Darunter gehören Mittermaier, Biedermann, Rießer, Clausen, von Hermann, Widenmann, Zacharia, Stenzel, auch die Exminister Heckscher, Robert Mohl, Fallati gehörten zum Württemberger Hof.8 Die Linke im Frack nennt sie Arnold Ruge.
5) Der Klub in der Mainlust. Es hat sich erst ganz kürzlich gebildet dadurch, dass seine Mitglieder, welche früher zum Casino gehörten, dort austraten und auf der Mainlust einen eigenen Klub bildeten. Der Grund ihres Austritts aus dem Casino lag darin, dass sie etwas mehr nach links neigten, namentlich verlangten sie, das Casino solle bestimmt den Grundsatz anerkennen, dass die Nationalversammlung die Reichsverfassung selbstständig und nicht erst durch Vereinbarung mit den Fürsten einführen könne, was jedoch das Casino nicht tat. Mainlust hat 30-40 Mitglieder, darunter sind besonders Lette aus Berlin und Fuchs aus Breslau zu nennen9. Auch Eisenmann10, welcher jetzt, seitdem er die Reaktion sieht, bedeutend mehr nach links neigt, ist aus dem Casino ausgetreten, hat sich aber noch nicht entschieden, ob er zur Mainlust oder zum Württemberger Hof treten will.
6) Der Klub im Casino, früher am Hirschgraben, das rechte Zentrum und die rechte Seite. Es ist mir nicht gut möglich, die politischen Grundsätze, welche diesen Klub zusammenhalten, anzugeben, denn es scheinen die verschiedenartigsten politischen Richtungen in demselben vertreten zu sein; nur eins scheinen die Mitglieder dieses Klubs gemeinschaftlich zu haben, die Gespensterfurcht vor der Republik und die Feindseligkeit gegen die linke Seite. Man kann die Mitglieder dieses Klubs etwa in drei Klassen teilen:
a) Professoren; in dieser Klasse findet man viel guten Willen, viel doktrinäre Schulweisheit, dagegen geringen politischen Takt, große Scheu vor kühnen und eingreifenden Maßregeln, Verkennung der politischen Lage Deutschlands und der Forderungen der neuen Zeit. Sie meinen, sie könnten die Revolution in der Studierstube beendigen, indem sie eine Verfassung ausarbeiten wie ein gelehrtes Werk. Viele scheinen es sich ordentlich zur Ehre anzurechnen, dass sie jetzt noch dieselbe politische Theorie haben wir vor Jahren, dass die freie frische Luft der Neuzeit sie nicht durchdrungen, in ihnen keine neuen Keime und Blüten entwickelt hat. Diese Klasse steht dem linken Zentrum noch am nächsten, sie meint es mit der Freiheit, wenngleich sie dieselbe etwas beschränkt versteht, ehrlich. Viele sind für eine strenge Einheit Deutschlands, welche sie durch einen Kaiser befestigen zu können glauben, andere sind etwas mehr partikularistisch. Als Wortführer dieser Professoren des rechten Centrums können angeführt werden: Dahlmann, Waiz, Beseler11
b) Beamte; sie klammern sich mehr an den Partikularismus an, weil in den Einzelstaaten die Beamtenherrschaft nun einmal befestigt und von der Reichseinheit wenig Heil für sie zu hoffen ist. Hierher gehören die Großherzogl. Badischen Reaktionäre Welcker, Matthy und die Exminister Beckerath, Bassermann, Schmerling etc.12 Diese Klasse steht wohl etwas weiter rechts als die eben genannte Klasse der Professoren.
c) Die Adeligen; sie stehen noch weiter rechts und grenzen an die äußerste Rechte. Die Hauptwortführer — Graf Schwerin, Graf Wartensleben, Fürst Lichnowsky, v. Vincke, v. Auerswald 13 – sind Verfechter des Stockpreußentums und daher entschiedene Partikularisten; sie wollen der Nationalversammlung und der Zentralgewalt – falls nicht etwa der König von Preußen deutscher Kaiser wird – so wenig als möglich Macht geben und alle Gewalt in den Händen der Fürsten der einzelnen deutschen Staaten lassen. Die Nationalversammlung soll daher nicht konstituierend sein, sondern über die Gesamtverfassung mit den Fürsten unterhandeln. Dass diese Klasse überhaupt das historische Recht und das Privilegienwesen vertritt, soweit es heutzutage noch möglich ist, braucht nicht erst erwähnt zu werden.
Das Casino treibt den deutschen Patriotismus häufig bis zur Ungerechtigkeit und Unterdrückung anderer Völker. Viele scheinen zu glauben, die Macht und Ehre Deutschlands werde dadurch erhöht, dass die Fürsten der einzelnen deutschen Staaten, Österreich, Preußen etc., auch große außerdeutsche Besitzungen haben und Eroberungen machen, da doch dadurch die Einheit und Macht Deutschlands mehr untergraben und die Politik dieser Fürsten eine undeutsche wird, auch solche außerdeutschen Länder unter der Herrschaft deutscher Fürsten nur Werkzeuge der Reaktion sind.
Das Casino ist der Zahl seiner Mitglieder nach der stärkste Klub; er zählte vor dem Austritt der Mainlüstlinge gegen 170 Mitglieder. (Die Fortsetzung folgt.)
1 Die Fraktionen (Klubs) wurden benannt nach den Lokalen, in denen sie sich üblicherweise trafen.
2 Arnold Ruge (1802-1880); Philosoph, zog sich schon bald enttäuscht aus der Nationalversammlung zurück. Siehe den Arnold Ruge-Band dieser Edition.
3 Franz Zitz (1803-1877), Jurist, schied im März 1849 ebenfalls aus dem Parlament aus, weil es ihm zu gemäßigt war, und beteiligte sich als Anführer des rheinhessischen Freikorps am pfälzisch-badischen Aufstand. Nach dessen Niederschlagung flüchtete er in die Schweiz und emigrierte dann in die USA.
4 Franz Schmidt (1818-1853), „deutsch-katholischer“ Theologe; Wilhelm Zimmermann (1807-1878), protestantischer Theologe und Historiker; Karl Hagen (1810-1868), Historiker; Ludwig Simon (1819-1872), Jurist; Hugo Wesendonck (1817-1900), Jurist; Adolph Kollaczek (1821-1889), Lehrer; Wilhelm Schaffrath (1814-1893), Jurist; Georg Günther (1808-1872), Journalist; Adolph Wiesner (1806-1867), Jurist und Journalist; Lorenz Brentano (1813-1891), Jurist.
5 Robert Blum (1807-1848), Publizist und Verleger, einer der führenden und populärsten Demokraten, wurde nach der Niederschlagung des Oktoberaufstands in Wien 1848 zum Tode verurteilt und hingerichtet (siehe den Robert Blum-Band dieser Edition).
6 Carl Vogt (1817-1895), Naturwissenschaftler; Adam von Itzstein (1775-1855), einer der Führer der liberalen Opposition; Wilhelm Löwe (1814-1886), Mediziner, Vizepräsident der Frankfurter Nationalversammlung; Carl Nauwerck (1810-1891), Orientalist und Journalist; Gustav Adolph Rösler (1818-1855), Lehrer und Publizist.
7 Franz Raveaux (1810-1851), Publizist und Karnevalist; Ludwig Simon (1819-1872), Jurist; Heinrich Simon (1805-1860), Jurist; Conrad von Rappard (1805-1881), Jurist; Jacob Venedey (1805-1871), Jurist und Publizist; Friedrich Vischer ((1807-1887), Literaturprofessor; Theodor Reh ((1801-1868), Jurist; Friedrich Jucho ((1805-1884), Rechtsanwalt und Notar.
8 Gabriel Riesser ((1806-1863), Notar in Hamburg; Henrik Clausen (1793-1877), Theologe; Friedrich von Hermann (1795-1868), Nationalökonom; Christian Wiedenmann (1802-1976), Advokat in Düsseldorf; Heinrich Zacharia (1806-1875), Professor der Rechte; Gustav Stenzel (1792-1854), Historiker; Johann Heckscher (1797-1865), Jurist; Robert von Mohl (1799-1875), Staatswissenschaftler; Johannes Fallati (1809-1855), Nationalökonom;
9 Wilhelm Lette (1799-1868), Jurist; Carl Fuchs (1801-1855), Jurist.
10 Gottfried Eisenmann (1795-1867), medizinischer Publizist.
11 Friedrich Christoph Dahlmann (1785-1860), Historiker und Staatswissenschaftler; Georg Waitz (1813-1886), Rechtshistoriker, Mediävist; Wilhelm Beseler (1806-1884), Rechtswissenschaftler.
12 Carl Theodor Welcker (1790-1869), Rechtswissenschaftler; Karl Mathy (1807-1868), Journalist; Hermann von Beckerath (1801-1870), Bankier; Friedrich Daniel Bassermann (1811-1855), Unternehmer; Anton von Schmerling (1805-1893), Jurist.
13 Graf Maximilian von Schwerin-Putzar (1804-1872); Alexander von Wartensleben-Schwirsen (1807-1883); Fürst Felix von Lichnowsky (1814-1848); Georg Freiherr von Vincke (1811-1875); Hans von Auerswald (1792-1848).
7) Der Klub im steinernen Haus, die äußerste Rechte.1 Ich bin nicht so tief in die Geheimnisse dieses Klubs eingeweiht, um ihre politischen Grundsätze genau angeben zu können; nach den Personen zu schließen aber scheinen sie möglichst vollständige Wiederherstellung der alten Zustände, Reaktion gegen Freiheit und Einheit Deutschlands zum Ziel zu haben. Nur das Verhältnis der Kirche zum Staat wollen sie total umändern. Kommt es auf Unterdrückung fremder Völker zu Gunsten Österreichs oder Preußens an, so sind sie eroberungssüchtig, aber von Befreiungskriegen (wie in Schleswig-Holstein) scheinen sie keine Freunde zu sein. Ihre Zahl mag gegen 40 betragen; es gehören dazu: v. Radowitz, v. Rotenhan, v. Lasaulx,2 viele Ultramontanen, Bayern etc. Weiterlesen
Es gibt jedoch auch noch viele Mitglieder der Nationalversammlung, welche sich keiner bestimmten Partei angeschlossen haben, sondern sich einzeln auf eigene Faust herumtreiben. Sie werden gewöhnlich Stegreifritter oder Strandläufer genannt. Es sind deren wohl immer noch 120 oder mehr.
Man wird beim Zusammenzählen finden, dass die linke Seite und das linke Zentrum zusammengenommen die Hälfte sämtlicher Klubmitglieder ausmachen.
Schließt sich daher bei einer Abstimmung das linke Zentrum der linken Seite an, so halten sie der rechten Seite gerade die Waage; die Strandläufer geben dann den Ausschlag. Gewöhnlich stimmen sie auf irgendeine Autorität hin mit der rechten Seite; allein da man sich nicht auf sie verlassen und sich mit ihnen nicht verständigen kann, so kann man die Majorität nicht gut vorausberechnen.
Die Klubs haben ihre großen Vorteile, doch sind sie auch nicht ohne Nachteil. Der hauptsächlichste Nachteil besteht darin, dass die einzelnen Klubmitglieder sich durch die Klubsitzungen und Beratungen häufig so in ihren einseitigen Parteiansichten befestigen und versteifen, dass sie schon mit einer ganz bestimmten gefassten Entschließung in die Paulskirche kommen und sich durch die beste Diskussion und die vernünftigsten Gründe nicht mehr belehren lassen. Es sind jedoch die Vorteile weit überwiegend. Sie liegen besonders darin, dass in den Klubsitzungen die Gegenstände erst aufs Ernstlichste beraten und auf allen Seiten beleuchtet werden, so dass man nicht ganz unvorbereitet in die Sitzungen der Paulskirche kommt. Zugleich haben die Klubs festgelegt, dass, eilige Fälle ausgenommen, keins ihrer Mitglieder einen Antrag bei der Nationalversammlung stellen darf, ohne ihn erst dem Klub vorzulegen und dessen Meinung darüber einzuholen; findet dann der Antrag bei der eigenen Partei keine Unterstützung, oder wird man durch die dagegen vorgebrachten Gründe belehrt, dass der Antrag nicht gut ist, so bringt man ihn gar nicht in die Nationalversammlung. Auf solche Weise sollen nur Anträge an die Nat.-Vers. kommen, welche vorher beraten und erwogen sind und wenigstens die Richtung einer bestimmten Partei vertreten, und es soll dem Andrang ganz unbegründeter, zeitraubender, von niemand unterstützter Anträge gewehrt werden. Leider aber kann man dadurch die Strandläufer nicht abhalten, die Versammlung immer noch mit einer Sintflut von nutzlosen Anträgen zu überschwemmen. (…).
Auch wird in den Klubs, besonders vor einem entscheidenden Kampf, der Feldzugsplan entworfen, es werden die hauptsächlichsten Redner der Partei ausgesucht und ihre Reihenfolge bestimmt; man verständigt sich darüber, welche Gründe hauptsächlich geltend gemacht werden sollen und welche Gründe man klugerweise lieber nicht vorbringt; die Unruhigen und Hitzigen werden ermahnt, sich zu mäßigen, sich nicht durch Heftigkeit eine Blöße zu geben oder die Gegner zu reizen.
Bei wichtigen Gegenständen halten auch mehrere Klubs derselben Hauptrichtung gemeinschaftliche Beratungen, und kürzlich ist namentlich bei Gelegenheit der Frage über Sistierung (Aufhebung) des dänischen Waffenstillstandes zwischen Westendhall, dem Deutschen Hof und dem Donnersberg verabredet worden, wöchentlich regelmäßig einmal eine gemeinschaftliche Sitzung zu halten.
Natürlich lernt man schon durch die Klubversammlungen seine eigenen Parteigenossen näher kennen und tritt in freundschaftlichere Beziehungen zu ihnen, als es in Beziehung auf die Mitglieder anderer Parteien der Fall ist; doch ist so viel anzuerkennen, dass der Privatverkehr aller Reichstagsglieder untereinander, von welcher Farbe sie auch sein mögen, ein freundlicher und unbefangener ist. Es hat sich ein eigener Reichstagston gebildet, welcher etwas Kameradschaftliches hat und aus welchem das Komplimentenwesen verbannt ist; niemand redet den anderen mit einem Titel an, sondern bloß mit dem Familiennamen. Kommen in gemeinschaftlichen Speisehäusern, in Weinhäusern, auf kleinen Ausflügen in der Umgebung Männer der verschiedenen Parteien zusammen, so schließen sie sich aneinander an, streiten und kämpfen über ihre Parteiansichten und über die laufenden Tagesfragen, ohne dass ich je eine persönliche Feindseligkeit daraus hätte erwachsen sehen, ja, gerade die Offenheit und Entschiedenheit, mit welcher jeder seine Parteimeinung ausspricht, bringt den offenen und zutraulichen Ton hervor, ein Friede dagegen, den man künstlich dadurch herbeiführen will, dass man über die Differenzpunkte, die einem am meisten am Herzen liegen, nicht miteinander spricht, ist ein fauler und schlechter Friede, welcher zu Heuchelei, zu Spannung, zu innerlicher Verbitterung oder doch zu Leerheit der Unterhaltung führt. Oft, wenn der Sturm in der Paulskirche am heftigsten getobt hat, sieht man unmittelbar darauf außer der Paulskirche die entschiedensten politischen Gegner sich ruhig und unbefangen über die Vorfälle unterhalten; natürlich gibt es aber auch auf den beiden äußersten Seiten einzelne, welche in einseitiger Parteileidenschaft so verbissen und verbittert sind, dass es ihnen nicht möglich ist, mit Männern von anderen Parteien gesellig zu verkehren. Vielfach spricht sich der Wunsch aus, dass wir einen gemeinschaftlichen Versammlungspunkt haben möchten. Manche von der rechten Seite, welche Anfangs eine solche Gespensterfurcht vor den „Republikanern“ hatten, dass sie jeden, der zur linken Seite gehörte, für einen blutdürstigen Wüterich, für einen zweiten Danton oder Marat, hielten, äußerten bei näherer Bekanntschaft unverhohlen ihre Freude darüber, dass sie unter uns so viele gutmütige Menschen, welche mitunter auch wirklich einen Anflug von Menschenverstand hätten, kennenlernten, und sie baten um häufigere gemeinschaftliche Zusammenkünfte, um ihr anfängliches Misstrauen zu überwinden. Es ist auch wirklich merkwürdig, wie manche, welche auf der Rednerbühne von einer ungemessenen Heftigkeit befallen werden, im gewöhnlichen Privatleben die besten und friedfertigsten Menschen sind, so dass man sie durchaus unrichtig beurteilt, wenn man sie nirgends anders sieht als auf der Tribüne.
Vielleicht gestattet es mir die Zeit, später einige der bekanntesten Persönlichkeiten näher zu schildern.
Der Verfassungsausschuss.
Da die Beratungen in großen Versammlungen immer schwerfällig und zeitraubend sind, da zu näherer Beurteilung mancher Beratungsgegenstände spezielle Fachkenntnisse gehören, welche nicht jedes Mitglied der Versammlung hat, da manche Fragen ein genaueres Durchstudieren von Urkunden, Akten, Rechnungen u. dergl. erfordern, so ist es in allen Ständeversammlungen und Parlamenten gebräuchlich, dass wichtigere Gegenstände erst durch dazu niedergesetzte Ausschüsse vorbereitet werden, ehe sie an die ganze Versammlung selbst gebracht werden. So ist es natürlich auch hier in der Nationalversammlung; es sind Ausschüsse niedergesetzt für Entwerfung der künftigen Reichsverfassung, für die bürgerliche und peinliche Gesetzgebung, für Geschäftsordnung, für die völkerrechtlichen Angelegenheiten, für volkswirtschaftlichen Gegenstände, für Prüfung der Wahlurkunden, für Militärangelegenheiten und Volksbewaffnung, für die Kriegsmarine usw. Diese Ausschüsse werden in der Regel so gebildet: Die ganze Nationalversammlung wird durch das Los in 15 Abteilungen geteilt, jede dieser Abteilungen wählt dann aus ihrer Mitte durch Stimmzettel mit absoluter Stimmenmehrheit ein Mitglied in den zu bildenden Ausschuss; jeder Ausschuss besteht sonach regelmäßig aus 15 Mitgliedern. Nur in den Verfassungsausschuss und in den Ausschuss für volkswirtschaftliche Fragen hat man wegen der Wichtigkeit dieser Gegenstände und wegen der vielen diesen Ausschüssen überwiesenen Arbeiten aus jeder Abteilung zwei Mitglieder gewählt, so dass jeder dieser beiden Ausschüsse aus 30 Mitgliedern besteht, mithin aus mehr Personen als manche Ständeversammlung kleiner Länder.
Diese Art, die Ausschussmitglieder nach Abteilungen zu wählen, hat große Nachteile, aber auch wieder ihre Vorteile. Der hauptsächlichste Nachteil besteht darin, dass dem Los, dem Zufall, zu viel überlassen ist. Es ist möglich, dass die Männer, welche sich ganz vorzüglich in einen bestimmten Ausschuss eignen, durch das Los in eine und dieselbe Abteilung kommen; diese Abteilung darf aber nur einen aus ihrer Mitte wählen, die anderen vorzugsweise geeigneten Personen derselben Abteilung sind daher ausgeschlossen. In einer anderen Abteilung ist dagegen wohl gar keine geeignete Person für den bestimmten Ausschuss, und doch muss diese Abteilung ein Mitglied aus ihrer Mitte wählen.
Auf der anderen Seite liegt auch eben in dem Zufall wieder ein Vorzug. Ist nämlich eine Versammlung, wie die hiesige, in mehrere Parteien geteilt, davon die eine Partei in der entschiedenen Mehrheit ist, so würde diese, wenn die Ausschussmitglieder durch die ganze Versammlung gewählt würden, es ganz in der Hand haben, lauter Mitglieder der Mehrheit in die Ausschüsse zu wählen und die Mitglieder der weniger zahlreichen Partei ganz und gar von den Ausschüssen und sonach von der Mitwirkung an den Arbeiten auszuschließen. Werden aber die Ausschussmitglieder aus den durch das Los gebildeten Abteilungen gewählt, so kann es nicht leicht fehlen, dass die Partei, welche in der ganzen Versammlung in der Minderheit ist, doch in einer oder der anderen Abteilung die Mehrheit hat und daher Mitglieder ihrer Partei in die Ausschüsse bringen kann. Die minder zahlreiche Partei wird sich daher das Verlosen der Abteilungen nicht leicht nehmen lassen, und deshalb stimmte auch die linke Seite, wiewohl erfolglos, dagegen, als kürzlich bei der notwendig gewordenen Ergänzung der unvollzählig gewordenen Ausschüsse der Vorschlag gemacht wurde, dass die Ausschüsse selbst Kandidaten zu ihrer Ergänzung vorschlagen und dann aus den Vorgeschlagenen durch die ganze Versammlung selbst gewählt werden sollen.
Von den bestehenden Ausschüssen ist wohl der Verfassungsausschuss einer der wichtigsten. Seine Hauptaufgabe ist, die künftige Verfassung des deutschen Reichs zu beraten und zu entwerfen, doch werden auch andere Gegenstände und Fragen, welche das Verfassungsrecht betreffen, an ihn verwiesen. Da ich selbst in diesem Ausschuss bin, so kann ich über dessen Verhandlungen nähere Auskunft geben. (…)
Der Teil der Verfassung, welchen der Ausschuss zunächst vornahm, war die Feststellung der dem deutschen Volk zu gewährleistenden Grundrechte. Ich bin neuerer Zeit sehr zweifelhaft geworden, ob es klug war, diesen Teil zuerst vorzunehmen. Denn was hilft die Aufstellung von noch so vortrefflichen Grundrechten, wenn sie nicht durch eine einheitliche Verfassung Deutschlands gesichert und geschützt sind? Das Zustandekommen der einheitlichen Verfassung ist aber jetzt viel mehr erschwert als früher, weil in der dazwischen liegenden langen Zeit die Reaktion gegen die Einheit Deutschlands allenthalben rege geworden ist und der Partikularismus sich befestigt hat; war dagegen erst die Verfassung selbst festgestellt, so konnten die Grundrechte nicht ausbleiben, denn die Reaktion weiß wohl, dass sie erst die Einheit zerstören muss, ehe sie sich an die Freiheitsrechte wagen kann. Indessen damals glaubten wir, mit den Volksrechten anfangen zu müssen, und wir konnten nicht entfernt berechnen, dass die Beratung und Schlussfassung darüber eine so unendliche Zeit wegnehmen würden.
Schon bei Beratung der Grundrechte traten die grundsätzlichen Verschiedenheiten der Parteien oft stark genug hervor; man sieht dies schon an den Minderheitsgutachten, welche nicht nur von der linken Seite, sondern auch von der rechten Seite her gegen die Mehrheitsgutachten gestellt worden sind. Doch muss man so viel anerkennen, dass die Anträge des Ausschusses durchgängig von einem freisinnigen Geiste ausgehen, und dass, wenn auch die linke Seite noch manche Verbesserung wünscht. doch schon die Mehrheitsanträge so viel Freiheit gewähren werden, als sie bis jetzt wohl kaum in irgendeinem Land der Welt ist. (…)
1 Diese Fraktion wurde nach einem Umzug in „Café Milani“ umbenannt.
2 Joseph von Radowitz (1797-1853), preußischer Generalleutnant; Hermann von Rotenhan (1800-1858), bayerischer königlicher Kämmerer (Leiter der Finanzverwaltung); Ernst von Lasaulx (1805-1861), klassischer Philologe.
Natürlich hat sich durch die Verwicklungen der neusten Zeit die Stellung der Parteien in der Nat.-Vers. wesentlich geändert. Solange der Kampf bloß ein Kampf der alten, wenn auch etwas gemilderten Polizeiherrschaft gegen die Demokratie war, da war die ganze rechte Seite einig; es gab bloß zwei Hauptparteien, die Partei der Fürstenherrschaft und die der Volksherrschaft – die rechte und die linke. Nachdem aber die Volksfreiheit unterdrückt und der Sieg der Fürstengewalt gesichert ist, zerfällt die rechte Seite nach den beiden großen Dynastien in die österreichische und in die preußische. Die österreich. oder schwarzgelbe, welche nur eine Modifikation des alten deutschen Bundes, ein Direktorium an die Spitze Deutschlands und stillschweigend für Österreich die oberste Leitung des Direktoriums will, besteht natürlich nicht bloß aus Österreichern, sondern sehr viele Bayern und die ganz streng katholische Partei, selbst aus preuß. Gebietsteilen, haben sich ihr angeschlossen; ebenso besteht die preuß. oder schwarzweiße Partei nicht bloß aus Preußen, sondern alle, die für Kleindeutschland und für den preuß. Erbkaiser schwärmen, gehören dazu, namentlich die meisten Schleswig-Holsteiner, Hannoveraner und überhaupt Norddeutschen, aus Süddeutschland hauptsächlich die Mitglieder und Anhänger des Reichsministeriums. So gibt es jetzt eigentlich drei große Parteien in der Paulskirche, die schwarzgelbe österreichische oder Direktorialpartei, die schwarzweiße preußische oder Erbkaiserpartei und die schwarzrotgoldene, rein deutsche Partei oder die Linke, welche das Reichsoberhaupt nicht nach den Dynastien konstituieren wollte. Die drei Parteien halten sich in Schach, keine hat bis jetzt für sich allein die Majorität – und das ist das Unglück der Nat.-Vers. Nach den neusten Vorgängen ist es jetzt noch am wahrscheinlichsten, dass die Erbkaiserpartei eine Mehrheit bekommen wird. Weiterlesen
So wie sich nun die Linke veranlasst gesehen hat, sich zu einem Gesamtklub im Deutschen Hof zu vereinigen, so versammelt sich jetzt die gesamte österreichisch ultramontane Partei – ohne gerade einen geschlossenen Klub zu bilden – im Hotel Schröter, und die Erbkaiserpartei hat ihren gemeinschaftlichen Versammlungsort im Weidenbusch – ebenfalls ohne die einzelnen Klubs aufzulösen. Diese Weidenbuschgesellschaft bildete sich aus Schrecken über die ersten deutlichen Spuren der zwischen den Schwarzgelben und der Linken beabsichtigten Koalition, man wollte ebenfalls eine geschlossene kompakte Masse entgegensetzen. Man ließ im Weidenbusch die Mitglieder sich förmlich durch Namensunterschrift verbindlich machen, für den preuß. Erbkaiser zu stimmen. Nach den letzten Nachrichten hatten sie bereits 245 Unterschriften. Das ist aber noch nicht hinlänglich zur absoluten Majorität, wenn alle Abgeordnete hier sind, und zu dieser wichtigen Abstimmung werden sie alle hierhereilen. Etwa 40 Mitglieder dieser Weidenbuschgesellschaft, welche dem linken Zentrum angehören, haben sich unter Zell's Leitung vereinigt, die rechte Seite des Weidenbuschs etwas in Schach zu halten und ihnen, indem sie sie in der Oberhauptsfrage unterstützen, dagegen wieder Konzessionen bezüglich der Volksfreiheiten abzunötigen, auch überhaupt eine Art Vermittlung zwischen der Linken und den Erbkaiserlichen zu unterhalten. Diese Vermittlungspartei besteht aus dem erbkaiserlichen Teil des Württemberger Hofs (darunter vorzüglich Zell), aus dem s.g. Klein-Westendhall (den wegen der Oberhauptsfrage aus dem Westendhallklub ausgetretenen Mitgliedern, darunter vorzüglich Reh, Jucho, Gravenhorst) und aus dem Klub Landsberg, welcher jetzt weiter links geht als der Augsburger Hof, obgleich der Augsburger Hof eine Absplitterung des Württemb. Hofs, der Landsberg, aber eine Absplitterung des Casino ist.
Der bekannte Welcker'sche Antrag – darauf gerichtet, dass die Nat.-Vers. sofort in einer Abstimmung die ganze Verfassung endgültig annehmen und dem König von Preußen die erbliche Kaiserwürde übertragen solle – brachte neue Verwirrung in die Parteien. In der Paulskirche brachte dieser Antrag (Montag, den 12. März) die Wirkung einer zerplatzenden Bombe hervor. Alles kam in Aufruhr, man traute seinen eigenen Ohren nicht, das Erstaunen wollte kein Ende nehmen, Niemand hörte mehr auf die Fragen der Tagesordnung – die Sitzung wurde geschlossen. Der Sieg des preuß. Erbkaisertums schien mit diesem Augenblick entschieden. Welcker, der Führer eines Klubs, den er gestiftet hatte, um dem kleindeutschen Erbkaisertum entgegenzuarbeiten und um die großdeutsche Direktorial-Regierung durchzusetzen, Welcker selbst trug darauf an, dem König von Preußen die erbliche Kaiserkrone zu übertragen Anfangs glaubte man, es sei sein ganzer Klub, welcher durch ihn spreche, dann wäre allerdings die Majorität für den Preußenkaiser dagewesen; allein man erfuhr bald, dass sein Klub aufs höchste überrascht, ja aufgebracht über seinen Antrag sei. Noch am Abend vorher hatte Welcker in seinem Klub aufs eifrigste gegen das kleindeutsche Erbkaisertum sich ausgesprochen, und am anderen Morgen überraschte er seine Genossen mit diesem Antrag, ohne nur mit einem derselben vorher Rücksprache darüber genommen zu haben. (…)
Auf der Seite der Erbkaiserlichen verursachte dieser Antrag einen großen Siegestaumel; Welcker, der kürzlich noch so Geschmähte, wurde mit Lobeserhebungen überhäuft. Die österr. Partei war wie niedergeschmettert. Die Linke war weniger berührt davon; für ihre Grundsätze, für die völlige Einheit Deutschlands durch die Volksherrlichkeit war ohnehin keine Aussicht auf Sieg mehr gewesen, und ob das Haus Habsburg oder das Haus Hohenzollern Deutschland ruiniere, darauf konnte ihr weniger ankommen.
Welcker's Antrag wurde im Verfassungsausschuss beraten, die große Mehrheit desselben war für den Antrag und legte ein großes Gewicht darauf, dass derselbe sofort zur Beratung in der Paulskirche komme. Die linken, die österreichischen und die ultramontanen Mitglieder des Verf.-Aussch. waren gegen den Antrag; da wir aber bei weitem überstimmt waren, so stellte ich den Zusatzantrag: Wenn über die ganze Verfassung in einer Abstimmung entschieden würde, so sollten sie wenigstens in diese Abstimmung auch das Wahlgesetz, so wie es aus der ersten Lesung hervorgegangen, mit aufnehmen, denn die Grundsätze des Wahlgesetzes gehörten doch eigentlich der Sache nach mit zur Verfassung; auch sei es unbillig, dass sie in der Verfassung, die meistens im Sinne der Erbkaiserlichen ausgefallen sei, uns zumuteten, auf die Abstimmung über die einzelnen Paragraphen zu verzichten, während wir das Wahlgesetz, welches mehr in unserem Sinne ausgefallen sei, nochmals der Chance einer Abstimmung über die einzelnen Punkte unterwerfen sollten; sie würden wohl auch nicht verkennen, dass gerade die überstarke monarchische Gewalt, welche sie an die Spitze stellen wollten, umso mehr eine freie demokratische Grundlage im Wahlgesetz notwendig mache. Ich ließ zugleich durchblicken, dass, wenngleich ich und ein großer Teil der Linken dennoch gegen das Erbkaisertum stimmen würden, so werde es doch auch gewiss manche von der Linken und vom linken Zentrum geben, welche dann für die ganze Verfassung und für das Erbkaisertum stimmen würden, wenn auch zugleich das demokratische Wahlgesetz mit aufgenommen würde, die aber gewiss gegen das Erbkaisertum stimmen würden, wenn man ihm nicht die breite demokratische Grundlage gebe. Der Verf.-Ausschuss in seiner Mehrheit, und darunter auch Hr. Rießer, fanden das ganz billig und in Ordnung, und so wurde in dem Vorschlag des Verf.-Ausschusses auch das Wahlgesetz mitaufgenommen; nur die Modifikation brachte die rechte Seite des Ausschusses noch hinein, dass die Wahlen nicht durch Stimmzettel, sondern durch Erklärung zu Protokoll gegeben werden sollten; ich selbst, ob ich gleich grundsätzlich für die Öffentlichkeit der Wahlen bin, stimmte doch dagegen, dass diese Modifikation in den Vorschlag aufgenommen werde, denn wenn einmal die ganze Verfassung in Bausch und Bogen angenommen und keine einzelnen Punkte herausgezogen werden sollen, so ist es nicht nur unrecht, sondern selbst sehr unklug, wenn die rechte Seite selbst wieder an einzelnen Punkten zu mäkeln anfängt. Überdies werden sie dadurch gewiss wieder mehrere Stimmen vom linken Zentrum verlieren. Denn so wie die Rechte den überwiegend größten Wert auf die Spitze, auf das Oberhaupt legt, so legen wir bei weitem den größten Wert auf die Grundlage, auf das Wahlgesetz. (…)1
1 Die lebendigen Schilderungen Schülers belegen die heillose Zerstrittenheit des ersten deutschen Parlaments, auch nachdem es längst entmachtet war und die Entscheidungen woanders (vor allem in Berlin und Wien) getroffen wurden. Zwar wurde am 28. März 1849 noch die Frankfurter Reichsverfassung (inkl. Wahlgesetz), an der Schüler maßgeblich mitgearbeitet hatte, beschlossen und von den meisten deutschen Einzelstaaten angenommen, nicht aber von Preußen, Bayern, Hannover und Österreich, die den Abgeordneten aus ihren Ländern daraufhin befahlen, ihr Mandat niederzulegen. Am 30. Mai beschlossen die in Frankfurt verbliebenen Abgeordneten, durch die Abgänge waren die Linken nun in der Mehrheit, den Parlamentssitz nach Stuttgart zu verlegen, weil man den Einmarsch preußischer Truppen in Frankfurt fürchtete. Doch auch dieses etwa hundertköpfige „Rumpfparlament“, zunächst von der württembergischen Regierung geduldet, wurde am 18. Juni mit Waffengewalt aufgelöst, die meisten Abgeordneten flohen ins Schweizer Exil. Christian Schüler indessen war noch während seiner Anwesenheit in der Nationalversammlung in den Weimarer Landtag gewählt worden; er kehrte nun nach Thüringen und zu seiner Familie zurück, und trat dort sein Mandat an.
Mit dem Ziel, die Frankfurter Reichsverfassung zu verteidigen, hatte schon Anfang Mai der pfälzisch-badische Aufstand (siehe etwa den Franziska Anneke-Band oder den Carl Schurz-Band dieser Edition) begonnen, mit dessen endgültiger Niederschlagung am 19. Juni die Deutsche Revolution beendet war.
Christian Schüler war kein Publizist. Im Unterschied zu anderen frühen Demokratinnen und Demokraten hat er weder eigene Schriften noch eine Autobiografie hinterlassen. Aber seine privaten und öffentlichen Berichte über seine Abgeordnetentätigkeit in der ersten deutschen Nationalversammlung sind zugänglich – und wichtige Bausteine der deutschen Parlamentsgeschichte.
Sibylle Schüler/Frank Müller: Als Demokrat in der Paulskirche. Die Briefe und Berichte des Jenaer Abgeordneten Gottlieb Christian Schüler 1848/49, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Große Reihe, Band 9, Böhlau Verlag 2007.
Die öffentlichen Parlamentsberichte Schülers erschienen in den „Privilegirten Jenaischen Wochenblättern“ (Jahrgänge 1848 und 1849) und sind abrufbar in der „Elektronischen Zeitschriftenbibliothek“ (http://ezb.uni-regensburg.de).
Monografien zu Christian Schüler liegen nicht vor.
CHRISTIAN SCHÜLER

Abb.: Lithographie-Porträt von Schertle, Verlag Schmerber’sche
Buchhandlung, um 1850
Der Jurist und Advokat im Staatsdienst Christian Gottlieb Schüler war kein Rebell, aber ein „bürgerlicher“ Demokrat reinsten Wassers. Seine Parlamentsberichte aus Frankfurt machten den Jenaer Abgeordneten zu einem kritischen Chronisten des ersten gesamtdeutschen Parlaments – und dienen der historischen Forschung als wertvolle Quelle der deutschen Demokratiegeschichte. Als führendes Mitglied im Verfassungsausschuss war er maßgeblich am Verfassungsentwurf der Nationalversammlung beteiligt. Diese „Reichsverfassung“ diente den Müttern und Vätern unseres Grundgesetzes als eine Art Blaupause – und bildet bis heute dessen Kernbestand.
Am 27. März wird Gottlieb Christian Schüler in dem zum Herzogtum Sachsen-Meiningen gehörenden Salzungen geboren. Sein Vater, Johann Gottfried Schüler, ist Advokat, seine Mutter die Tochter eines Amtmannes.
Als Sohn einer lokal verwurzelten Bürgersfamilie folgt er dem Vorbild des Vaters. Nach dem Besuch des Lyzeums in Meiningen (1813-1817) studiert er Rechtswissenschaften an den Universitäten Jena und Heidelberg und schließt sich dort der Burschenschaftsbewegung an, für die das Studium als Grundlage politischen Handelns gilt.
Nach Abschluss des Studiums nimmt Schüler zu Beginn des Jahres 1820 seine Tätigkeit als Advokat in Salzungen auf.
Schüler tritt in den Staatsdienst ein, zunächst als Amtssekretär, dann als Landgerichtsassessor, später als Oberlandesgerichtsrat.
Schüler wird in den Landtag von Sachsen-Meiningen gewählt und gehört dort zur liberalen Opposition.
Trotz seines "oppositionellen" politischen Engagements wird Schüler zum Rat am Oberappellationsgericht in Jena ernannt (und wird dieses Amt 36 Jahre lang bis zu seinem Tod bekleiden). Wegen dieser Tätigkeit siedelt die Familie (Schüler ist seit 1824 verheiratet) nach Jena über, wo in der Folge die vier jüngsten seiner insgesamt 11 Kinder geboren werden.
„Als Beweis der Achtung“, welcher er sich seit seinem Eintritt in das höchste Gericht erworben habe, erhält Schüler von der juristischen Fakultät der Universität Jena die Ehrendoktorwürde. Das ermöglicht ihm nun zusätzlich eine Universitätslaufbahn. Als Honorarprofessor hält er von nun an Vorlesungen über Kriminal- und Prozessrecht.
Als die Revolution Thüringen erreicht, engagiert sich Schüler sofort. Im März leitet er eine Protestdeputation, die vor dem Weimarer Landtag die Märzforderungen vorträgt. Er stellt sich anschließend zur Wahl zur Frankfurter Nationalversammlung und wird am 28. April mit großer Mehrheit gewählt. Ab Mai liefert er seinen Wählern dann regelmäßig Berichte über das Geschehen in der Paulskirche.
Nach dem Scheitern der Revolution und der Auflösung der Nationalversammlung kehrt Schüler enttäuscht nach Jena zurück, bleibt aber weiterhin politisch aktiv. Von 1864 bis 1868 gehört er dem Gemeinderat der Stadt Jena an, seit 1866 als dessen Vorsitzender.
Als Rechtsprofessor, Gerichtsrat und Lokalpolitiker hochgeachtet – und 1870 zum Ehrenbürger der Stadt Jena ernannt – stirbt Christian Schüler am 1. Juli 1874.
Ina Hartwig
Gottlieb Christian Schüler war als einflussreicher Abgeordneter der demokratischen Fraktion „Deutscher Hof“ ein besonders bemerkenswerter Vertreter des ersten gesamtdeutschen Parlaments – sowohl in der Perspektive seiner Zeitgenossinnen und Zeitgenossen als auch unserer demokratieerfahrenen Gegenwart. Einerseits war Schüler radikal: radikal in seinem demokratischen Idealismus, der von der spontanen Überzeugungskraft der politischen Rede ausging und einen Parlamentarismus unter Bedingungen vorsah, die angesichts der Realität fast märchenhaft anmuten – damals wie heute. Die Korrespondenz an seine Ehefrau verfasste er während seiner Zeit in der Paulskirche in Form offener Briefe, um seine Arbeit als Abgeordneter möglichst transparent zu machen. An seiner radikalen politischen Kernforderung hielt Schüler konsequent fest: Die nationalstaatliche Einheit Deutschlands und die Schaffung einer politischen „Zentralgewalt“ hielt der Jenaer Jurist für unabdingbar, auch wenn sie mit einem Souveränitätsverlust für die Einzelstaaten einhergehen musste. Weiterlesen
Andererseits erwies sich Schüler in seiner Arbeit als Abgeordneter als pragmatisch, lotete Kompromisse aus und hielt nicht dogmatisch an Maximalforderungen fest, wenn sich diese als nicht mehrheitsfähig erwiesen. Schon in seiner Bewerbungsrede für die Wahl zur Nationalversammlung 1848 verwahrte er sich dagegen, wegen seiner liberalen demokratischen Ansichten auf die Republik als ideale Staatsform festgelegt zu sein („Ich werde mich an die Seite des entschiedenen Fortschritts anschließen, aber lasst Euch nicht ins Ohr blasen, ich sei ein Republikaner“).
Im persönlichen Umgang mit den politischen Gegnern schließlich scheint Schüler höchst wertschätzend, respektvoll und um Ausgleich bemüht gewesen zu sein. Mehr als einmal hob er in seinen Berichten aus dem Parlament die intellektuelle Brillanz von Abgeordneten hervor, die ihm politisch fernstanden. Aufrufen zum Verlassen des institutionellen Weges, zur Abspaltung oder gar zum gewaltsamen Aufstand zur Durchsetzung der eigenen politischen Ideale versperrte er sich auch, als seine Fraktion in der Paulskirche zunehmend unter Druck geriet.
Gottlieb Christian Schüler wurde 1798 in Salzungen, das damals zum Herzogtum Sachsen-Meiningen gehörte, als Sohn eines Advokaten und Enkel eines Amtsmannes geboren. Durch seine Herkunft war er mit der deutschen „Kleinstaaterei“ biografisch vertraut. Die sogenannten Ernestinischen Herzogtümer auf dem Territorium der heutigen Bundesländer Thüringen und Sachsen, die auf den Herzog und Kurfürsten Ernst von Sachsen-Wittenberg zurückgingen, waren seit dem 15. Jahrhundert durch Erbteilung in immer kleinere Staaten zerfallen, die politisch vergleichsweise wenig Gewicht hatten. Nach seiner Zeit auf dem Lyzeum in Meiningen begann Schüler 1816 ein juristisches Studium in Jena im benachbarten Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. 1818 wechselte er für ein Jahr an die Universität in Heidelberg – damals Teil des Großherzogtums Baden – wo er sein Studium ein Jahr später beendete. Nach Tätigkeiten als Advokat in seiner Geburtsstadt ging er 1827 in den Staatsdienst, arbeitete unter anderem für das Meininger Ministerium und seit 1838 am Oberappelationsgericht in Jena, einer gemeinsamen Institution aller Ernestinischen Herzogtümer in Thüringen. Hier war er bis zu seinem Tod im Jahr 1874 tätig, die 1841 verliehene Ehrendoktorwürde der Universität Jena ermöglichte ihm außerdem die Tätigkeit als Honorarprofessor.
Als Schüler den Wahlkreis Jena als Abgeordneter 1848 in der Paulskirche vertrat, war er also gesellschaftlich etabliert und mit 51 Jahren schon in einem fortgeschrittenen Alter. Dies bedeutete aber keinesfalls eine Mäßigung seiner radikalen demokratischen Ansichten. Der Schriftsteller Heinrich Laube, ebenfalls Abgeordneter, reiste im Mai gemeinsam mit Schüler nach Frankfurt und charakterisiert ihn bei der literarischen Verarbeitung der Zugfahrt folgendermaßen: „Der Professor neben mir, ein langer Mann mit langen Beinen, stieg zum Beispiel über alle Hindernisse so unbefangen hinweg, dass es ein Vergnügen war, solch einen Kontrast anzusehen zwischen grauem Haar und grüner Einsicht.“1
Die damals revolutionäre Idee eines vereinten Deutschlands hatte Schüler schon in jungen Jahren begeistert, als Burschenschaftler nahm er 1817 am ersten Wartburgfest teil, um mit Studenten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum einen Nationalstaat mit eigener Verfassung zu fordern. Dabei lag ihm jedoch nationaler Chauvinismus fern, wie seine späteren Reden in der Paulskirche belegen. So wandte er sich gegen „Eroberungs- und Unterdrückungskriege“ sowie explizit gegen die preußische Expansion in Polen oder die Österreichs in Italien: „Es ist gegen das deutsche Interesse, dass der deutsche Name mit Hass und Fluch beladen wird bei allen nach Freiheit und nationaler Selbständigkeit strebenden Völkern.“ Die Vorstellung, dass eine bestimmte Adelsdynastie als Souverän über Krieg und Frieden entschied und die dahinterstehenden Interessen nicht deckungsgleich mit den – von Schüler als einheitlich angenommenen – Interessen einer Nation sein könnten, war ihm unerträglich.
Grundsätzlich begegnete Schüler dem Adel mit großen Vorbehalten. In einem von Fürsten- und Königshäusern dominierten deutschen Nationalstaat machte er die Gefahr einer weitgehenden Unterdrückung, gar einer „Verschwörung gegen das Volk“ aus. Ein „Monarchenbund“ von sich gegenseitig unterstützenden Adelsgeschlechtern könnte schlechterdings einer weiterhin in Einzelstaaten fragmentierten Öffentlichkeit gegenüberstehen, so seine Befürchtung. In einer entsprechenden Atmosphäre hätten die von ihm als äußerst relevant angesehenen Bürgerrechte wohl kaum gedeihen können. Auch bei dieser Einschätzung konnte er sich auf die eigene Erfahrung stützen: So war er 1833 vom Wahlkollegium der Städte Meiningen, Wasungen und Salzungen zum Landtagsdeputierten gewählt worden und hatte hier der liberalen Opposition angehört. Nachdem sich die politische Lage im Fürstentum aber gedreht hatte und in eine repressive Richtung umgeschlagen war, wurde Schüler 1837 seitens des Oberlandesgerichts kurzerhand der Urlaub verwehrt, den er zur Wahrnehmung seiner Pflichten als Landtagsabgeordneter brauchte. Diese Erfahrung machte er ein zweites Mal, als er während seiner Zeit im Paulskirchenparlament auch zum Abgeordneten des Weimarer Landtages gewählt wurde. Hier wurde der Jurist sogar per Mehrheitsentscheid zum Präsidenten auserkoren; da der Großherzog die Personalie ablehnte, konnte er letztlich aber nur das Amt des Vizepräsidenten antreten. Die erneute Urlaubsverweigerung im Jahr 1850 beendete auch Schülers Tätigkeit im Weimarer Landtag.
Trotz der biografisch bedingten Skepsis gegenüber dynastisch bestimmten Souveränen trat Schüler in der Paulskirche nicht etwa mit der republikanischen Forderung auf, die Adelsherrschaft gänzlich zu beenden. Vielmehr plädierte er dafür, die einzelnen gekrönten Häupter in ihrer Funktion als Landesväter und -mütter zu belassen und lediglich ihre hoheitlichen Befugnisse zugunsten einer nationalstaatlichen „Zentralgewalt“ zu beschneiden. Diese wiederum sollte demokratisch legitimiert sein und von einem zivilen Präsidenten, keinesfalls aber von einem Kaiser geführt werden.
Sehr pragmatisch argumentierte der Jenaer mit der Kostenersparnis, die eine Aufgabe eines Teiles der Souveränität durch die deutschen Staaten mit sich bringen würde. So müssten zahlreiche Institutionen und Behörden nicht in jedem einzelnen Land bestehen – womöglich hatte Schüler bei dieser Überlegung das zentrale Oberappelationsgericht seiner thüringischen Heimat im Kopf –, nicht eine Vielzahl kleiner Armeen finanziert werden und nicht diverse Parallelstrukturen im Eisenbahn- und Postwesen konkurrieren. Der Handel wiederum ließe sich durch eine einheitliche Währung sowie die Normierung von Gewichts- und Maßeinheiten und dergleichen entscheidend vereinfachen, so Schüler. Den Widerstand einzelner Staaten gegen solche Maßnahmen antizipierte er mit der kühlen und nicht unrealistischen Prognose, dass die kleineren deutschen Fürstentümer ohnehin langfristig in einem der beiden großen deutschen Staaten, also Preußen oder Österreich, aufgehen und ihre politische Eigenständigkeit verlieren würden.
Schülers Vision des zukünftigen Deutschlands war generell stark föderalistisch geprägt und nahm Strukturen vorweg, die sich letztlich im demokratischen Deutschland der Weimarer Republik und später der Bundesrepublik Bahn brechen sollten. Die zentralistische Gegenposition, wie sie sich mit der Reichsgründung 1871 schließlich durchsetzte, beurteilte er schon als Paulskirchenabgeordneter hellsichtig als äußerst problematisch. Dabei störte er sich nicht nur daran, dass an der Spitze des Deutschen Reichs ein Kaiser stand, zumal aus dem Hause Hohenzollern. In der Paulskirche hatte er sich ausdrücklich vom Vorbild Frankreichs distanziert, denn auch eine stark zentralistische Republik bewertete er kritisch.
Nicht nur in dieser Hinsicht lesen sich Schülers Texte und Reden aus heutiger Perspektive fast modern. So beschränkte sich die Demokratie in seinem Verständnis nicht auf eine in der Verfassung verbriefte Wahl der Regierung durch das Volk. Er forderte sie auch als bürgerrechtlichen Ausgangspunkt und zivilgesellschaftliche Grundlage ein: „Es muss daher das demokratische Prinzip der Selbstregierung durch alle bürgerlichen Verhältnisse hindurchgehen. Das Individuum, die Vereine, die Gemeinden, die Provinzen müssen sich möglichst frei und von der höchsten Staatsgewalt ungehindert bewegen und sich in ihrer Eigentümlichkeit ausbilden können.“ Er machte bei sich selbst keine Ausnahme: Als er in seinem Jenaer Wahlbezirk durch die Stimmen der Mehrheit eines Wahlmännergremiums zum Paulskirchenabgeordneten bestimmt wurde, bemühte er sich, dies durch nachträgliche Urwahlen bestätigen zu lassen.
Schüler verband seine Forderung nach Legitimation durch eine möglichst direkte Demokratie mit einer Selbstverpflichtung zu weitgehender Transparenz – womit er sich wiederum problemlos in die Debatten unserer Tage einschalten könnte. In regelmäßigen Berichten, die auf seinen Wunsch über die Presse Verbreitung fanden, schrieb er seinen Wählern sowie seiner Familie von seiner Arbeit in der Paulskirche. Die Texte richteten sich an eine Leserschaft, für die die parlamentarische Tätigkeit etwas Neues und Erklärungswürdiges war. Schüler beschrieb die sich herausbildenden Parteien und umriss ihr inhaltliches Profil, erklärte die parlamentarischen Prozesse und fasste die Debatten zusammen. Die Begeisterung des seine frischen Eindrücke wiedergebenden Verfassers wirkt dabei bis heute ansteckend.
Als Mitglied des Verfassungsausschusses wirkte Gottlieb Christian Schüler an zentraler Stelle des jungen Parlaments. Seine Berichte hatten daher nicht nur für die Zeitgenossen Nachrichtenwert, sondern dienen der historischen Forschung bis heute als wertvolle Quellen der deutschen Demokratiegeschichte. Als Angehöriger der linken Minderheit konnte der Jenaer Jurist zwar viele seiner auf umfassende Bürgerrechte abzielenden Forderungen nicht durchsetzen, äußerte sich im Ergebnis aber sehr positiv über die Arbeit des Ausschusses: „Doch muss man so viel anerkennen, dass die Anträge des Ausschusses durchgängig von einem freisinnigen Geiste ausgehen, und dass, wenn auch die linke Seite noch manche Verbesserung wünscht, doch schon die Mehrheitsanträge so viel Freiheit gewähren werden, als sie bis jetzt wohl kaum in irgendeinem Land der Welt ist.“
Schüler gehörte dem Parlament bis zum Schluss an und vollzog auch den Umzug von Frankfurt nach Stuttgart in der Hoffnung auf eine Wirkmächtigkeit des „Rumpfparlaments“. Nach der endgültigen Auflösung der ersten demokratisch gewählten Volksvertretung Deutschlands kehrte er nach Jena zurück. Hier trug ihm sein radikal-demokratisches Engagement vor dem Hintergrund der veränderten politischen Großwetterlage zwar eine gesellschaftliche Randstellung ein, von Restriktionen blieb er aber weitgehend verschont. Keinesfalls ergab sich die Notwendigkeit zum Gang ins Exil, mit der sich andere „48er“ konfrontiert sahen. Tatschlich betätigte sich Schüler einige Jahre später erneut politisch. 1860 trat er dem Deutschen Nationalverein bei, wenngleich er die sich bald abzeichnende Befürwortung der kleindeutschen Lösung unter preußischer Führung durch diese Sammlungsbewegung sehr skeptisch sah. 1864 bis 1868 gehörte er schließlich dem Jenaer Gemeinderat an, seit 1866 als Vorsitzender. Spätestens mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft war Schüler in seiner Heimatstadt vollständig rehabilitiert, ohne dass er von seinen politischen Überzeugungen zurückgetreten wäre.
Auch wenn Gottlieb Christian Schüler trotz seiner historischen Bedeutung nicht zu den bekanntesten Abgeordneten der Paulskirche gehört, ist die Auseinandersetzung mit seinen Texten und Redemanuskripten absolut lohnenswert. Seine idealistische und gleichzeitig unvoreingenommene Herangehensweise an den Parlamentarismus ist besonders heute, in einer Zeit also, in der die Demokratie für viele zu einer nebensächlichen Gewohnheit avanciert ist, inspirierend und nicht nur historisch aufschlussreich.
Die Transparenz, die Schüler mit seinen Briefen für seine Wähler in Thüringen herstellte, ist in der heutigen parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik weitgehend Standard. Die Debatten des Deutschen Bundestags können im Livestream verfolgt werden, eine vielstimmige Presselandschaft kommentiert das politische Geschehen, und die Parlamente stellen zahlreiche Dokumente zu ihrer eigenen Tätigkeit zum digitalen Abruf bereit.
Folgt man den Schlagzeilen der deutschen Hauptstadtpresse, könnte man meinen, die relevanten politischen Entscheidungen würden allein in Berlin getroffen. Doch die Realität ist im Jahr 2024 eine andere und sehr viel näher an Schülers föderalistischem Ideal. Die Länderparlamente, Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen und Stadträte verhandeln zentrale politische Fragen, die sich oftmals viel unmittelbarer auf den Alltag der Menschen auswirken als die Entscheidungen der Bundespolitik. In Frankfurt etwa tagt heute keine 200 Meter von der Paulskirche entfernt das Stadtparlament im Rathaus Römer und debattiert Fragen wie den zukünftigen Standort der städtischen Bühnen, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die städtebauliche Gestalt neuer Wohnquartiere oder die Verteilung der städtischen Steuereinnahmen bei den jährlichen Haushaltsdebatten. Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sowie der einzelnen Ausschüsse finden öffentlich statt, wie in anderen deutschen Städten und Gemeinden auch. Bürgerinnen und Bürger können die politischen Debatten mit geringem Aufwand selbst verfolgen und die Arbeit ihrer gewählten Volksvertreterinnen und -vertreter kontrollieren. Wenn die Lektüre dieses Buches den einen oder die andere durch das historische Beispiel motiviert, dieses heute selbstverständliche Recht gelegentlich wahrzunehmen, wäre das eine gute Nachricht für die parlamentarische Demokratie.
1 Laube, Heinrich: Das erste deutsche Parlament. Erster Band. Leipzig 1849, S. 7.
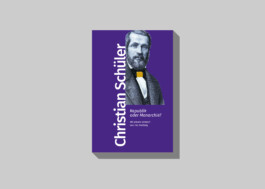
Christian Schüler
Republik oder Monarchie?
Erschienen am 10.10.2024
Taschenbuch mit Klappen, 192 Seiten
€ (D) 14,– / € (A) 14,40
ISBN 978-3-462-50014-1
An meine lieben Mitbürger.
Wenn auch ich nach der hohen Ehre strebe, von meinen lieben Mitbürgern als Abgeordneter zu der konstituierenden Nationalversammlung gewählt zu werden, so kann mich nur meine heiße Liebe zu meinem deutschen Vaterland, mein sehnlichster Wunsch, zu dessen Einheit, Freiheit, Ruhm und Glück nach meinen schwachen Kräften mitzuwirken, dazu veranlassen; für mich persönlich ist es nur mit den größten Aufopferungen verbunden. Aber kein Opfer soll mir zu groß, keine Last zu schwer sein, wenn es mein geliebtes Vaterland gilt.
Deshalb lege auch ich meinen Mitbürgern mein politisches Glaubensbekenntnis vor. Weiterlesen
Man pflegt dabei gewöhnlich mit einer Antwort auf die Frage zu beginnen, ob man für eine Republik oder für konstitutionelle Monarchie sei. Das sind aber, dünkt mich, nicht die eigentlichen Gegensätze, um welche es sich zunächst dreht. Die erste Frage ist vielmehr die:
Soll Deutschland ein einheitlicher Staat werden mit gänzlicher Auflösung der 38 Einzelstaaten, aus denen es jetzt besteht,
oder
Soll vielmehr Deutschland ein aus den 38 Einzelstaaten zusammengesetzter Bundesstaat werden?
Erst dann, wenn man sich für einen ganz einheitlichen Staat erklärt hätte, würde die weitere Unterfrage entstehen:
Soll die Regierungsform dieses einheitlichen. Staates eine monarchische oder eine republikanische werden?
Handelte es sich um die Frage: Republik oder Monarchie? im Allgemeinen, so würde ich auch dann der Meinung sein, die erbliche Monarchie, jedoch auf breitester volkstümlicher Grundlage, sei der Republik vorzuziehen, schon deshalb, weil die fortgeerbte Liebe und Anhänglichkeit an die regierende Familie dem Staat eine Festigkeit und Haltbarkeit gibt, welche die Republik, die einen solchen bleibenden und persönlichen Repräsentanten der Staatseinheit nicht hat, häufig entbehrt.
Handelte es sich aber mehr um die Frage, soll Deutschland ein aus 34 Monarchien und 4 freien Städten zusammengesetzter Bundesstaat werden? so muss ich gestehen, dass ich eine solche Zerstückelung Deutschlands in viele unter sich selbst ungleiche und den natürlichen Stammesunterschieden nicht entsprechende Monarchien niemals gutheißen würde, wenn sie erst neu vorgenommen werden sollte, wenn sie nicht schon bestünde. Diese Zerstückelung halte-ich für die Ursache alles unser Nationalunglücks, unserer Schwäche dem Ausland gegenüber, unserer Unfreiheit, Klein- und Engherzigkeit im Innern. Aber sollen denn deshalb unsere 34 Fürsten sofort abgesetzt werden? Das wollen wir nicht, das können wir nicht. Die deutschen Völker haben sich daran gewöhnt, sie hängen an ihren Fürstenhäusern. Ein versuchter plötzlicher Umsturz des Bestehenden würde zu den Schrecken des Bürgerkriegs, zur gänzlichen Zerrüttung Deutschlands führen, eine gänzliche Vernichtung der jetzigen Verhältnisse würde zugleich die Elemente unserer Bildung vernichten. Man mache keine gefährlichen Experimente und springe nicht in ein Extrem über. Unsere Einzelstaaten haben noch zu viel Lebensfähigkeit. So lange aber eine Einrichtung noch nicht abgestorben ist, muss man sie nicht begraben wollen.
Aber möglichst unschädlich machen muss man diese Zerstückelung. Man muss, ohne die Einzelstaaten aufzulösen, das ganze Deutschland mit dem Geist der Einheit zu durchdringen, sein Volksleben und seine Interessen innigst miteinander zu verschmelzen suchen. Das geschieht durch eine volkstümliche und nur unter dem Einfluss des Volksgeistes stehende Zentralbehörde, welche die höchste Gewalt in Deutschland ausübt und welcher die Einzelstaaten unterworfen sind. An der Spitze soll nicht ein erblicher Kaiser stehen, sondern ein auf Zeit gewählter Präsident. Denn was man auch gegen eine wiederkehrende Wahl des Oberhauptes mit Recht sagen mag, so ist diese Einrichtung doch notwendig, solange Deutschland aus monarchischen Einzelstaaten besteht; wenn das monarchische Element in der Mitte ist, so muss oben drüber wieder ein volkstümliches stehen; stände die zweifache monarchische Gewalt übereinander, so würde durch ihre Verbindung die Freiheit Deutschlands erdrückt werden. Auch ist nicht außer Berücksichtigung zu lassen, dass Deutschland an 34 fürstlichen Civillisten1 schon schwer genug zu tragen hat und nicht gern noch eine kaiserliche obendrein auf sich nehmen wird.
Zur ausschließlichen Kompetenz der Zentralgewalt muss gehören:
das Recht über Krieg und Frieden, das Recht der Gesandtschaften, der Bündnisse, das Heerwesen, die Kriegsflotte,
die Gesetzgebung in bürgerlichen und peinlichen2 Sachen und im Gerichtswesen, Handelsgesetzgebung,
Herstellung einer Einheit in Münze, Maß, Gewicht,
Anordnung aller Einrichtungen, welche als für ganz Deutschland gemeinsam angesehen werden müssen, Posten, Eisenbahnen usw.
Auch muss die Zentralgewalt auf Abstellung von Missbräuchen in den Einzelstaaten und auf Ersparnisse im Haushalt derselben hinwirken können. Sie muss ein höchstes Gericht für Streitigkeiten der Einzelstaaten untereinander sowie der Fürsten und der Völker gegeneinander errichten.
Ist so eine Einheit Deutschlands hergestellt, so wird sich das Nationalbewusstsein heben und kräftigen, ein großer und freier Geist, ein Geist der Bruderliebe und des Patriotismus wird an die Stelle der Engherzigkeit, des Philistertums und des Egoismus treten. Der friedliche und ruhige Weg zu allen künftigen Verbesserungen wird angebahnt sein.
Für die politische Gestaltung Deutschlands auf diese Grundlage hin werde ich kämpfen aus allen Kräften, so lange es zu kämpfen gilt, solange die Sache der konstituierenden Nationalversammlung noch nicht entschieden ist. Hat sich aber einmal die Nation durch die Mehrheit ihrer Vertreter für eine bestimmte Regierungsform entschieden, so geht mir dann der Wille der Nation über alle Theorie, und die Regierungsform soll mir die liebste sein, welche die Nationalversammlung beschlossen hat.
In Beziehung auf die Einzelheiten der Zusammensetzung der Zentralgewalt habe ich zwar auch bestimmte Ansichten, allein ich möchte mich darüber nicht gern auf bindende Weise aussprechen, sondern muss bitten. meinem Urteil noch Spielraum zu gewähren und mir zu gestatten, den Belehrungen und Eindrücken, welche die Diskussion hervorbringt, zugänglich bleiben zu können.
Als Volksrechte, welche durch die konstituierende Nationalversammlung jedenfalls fest und unter den Schutz der Zentralgewalt gestellt werden müssen, bezeichne ich:
Sicherstellung der Person und des Eigentums.
Volle Pressefreiheit ohne das System der Kautionen und Konzessionen.
Rechtliche Gleichstellung aller Religionsparteien, Unabhängigkeit der Kirche vom Staat.
Allgemeines deutsches Staatsbürgerrecht und Freizügigkeit.
Allgemeine deutsche Volksbewaffnung, möglichste Verminderung der stehenden Heere.
Aufhebung der inneren Landes- wie Schifffahrtszölle.
Aufhebung der auf den notwendigen Lebensbedürfnissen haftenden Steuern, der Salz-, Fleisch-, Malzsteuern usw. Einführung einer Einkommenssteuer, welche die Ärmeren erleichtert und mehr auf die Reicheren fällt.
Aufhebung der den Landmann und den Gewerbetreibenden drückenden Lasten.
Freie Gemeindeverfassung.
Freies Vereins- und Versammlungsrecht.
Aufhebung der auf Geburt, Rang und Stand ruhenden Vorrechte; gleiche Berechtigung zu Staats- und Gemeindeämtern.
Hebung der Schulen und des Lehrerstandes.
Volkstümliches Recht, volkstümliche Gerichtsverfassung mit Mündlichkeit und Öffentlichkeit; in Strafsachen mit Schwurgerichten,
dadurch zugleich Verminderung der Beamtenheere.
Sorge für das geistige und körperliche Wohl der arbeitenden Klassen.
Mitbürger, ich habe unter Euch gelebt seit vielen Jahren. Meinen Charakter kennt Ihr. Ich habe die Sache der Freiheit ergriffen, als es noch mit großer Gefahr für mich verknüpft war; ich habe mein ganzes Leben lang die Sache der Wahrheit, der Freiheit und des Rechts nicht einen Augenblick verleugnet, ich habe dafür, wenn auch in engeren Kreisen, gesprochen und gekämpft ohne Menschenfurcht und Scheu. Der Sache des deutschen Volkes gebe ich mich hin mit voller Aufopferung und Selbstverleugnung. Durch langjährige Erfahrung kenne ich die Mängel unseres Staats- und Rechtszustandes, die Bedürfnisse unseres Volkes. Den Fragen der Gesetzgebung und eines volkstümlichen Rechtes habe ich seit langer Zeit mein Nachdenken gewidmet. Ich bin im Bewusstsein der Zeit und glaube frei zu sein von den Vorurteilen und der Anschauungsweise der Bürokratie.
Nur durch offenes und entschiedenes Eingehen in den Geist der Zeit, nur durch Förderung der Sache des Fortschritts und der Volksfreiheit können Revolutionen vermieden werden, durch halbe Maßregeln oder durch reaktionäre Bewegungen werden sie herbeigeführt. Ich werde mich an die Seite des entschiedenen Fortschritts anschließen, aber lasst Euch nicht ins Ohr blasen, ich sei ein Republikaner.
So gestattet mir denn, durch Eure Wahl unmittelbar teilzunehmen an der Herbeiführung einer schönen Zeit, einer herrlichen Zukunft! Ich werde es für die höchste Ehre und das größte Glück meines Lebens halten.
Jena, am heiligen Ostermorgen 1848.
C. Schüler
1 Damit wird der jährliche Betrag bezeichnet, der einem Monarchen für die Unterhaltung sämtlicher Gebäude sowie für seine Angehörigen und Bediensteten aus der Staatskasse gewährt wird.
2 Der Begriff „peinlich“ (von lat. Poena = Strafe) meint in diesem Zusammenhang Leibes- und Lebensstrafen (etwa Gefängnis-, Zuchthaus- oder Todesstrafen).
Frankf. Dienstags d. 16 Mai 1848
Bestes Mutterchen
Heute Nachmittag, 3 Uhr, werden wir eine Sitzung haben, um über die förmliche Eröffnung des Parlaments zu beraten. Gestern wohnte ich einer sehr interessanten Sitzung des Fünfziger Ausschusses bei.1 Weiterlesen
Ich habe gestern mehr Bekanntschaften gemacht als während des ganzen Vorparlaments. Es hat sich unter den bis jetzt hier anwesenden Abgeordneten schon ein sehr guter Geist der Eintracht, des Zusammenhaltens, der Kraft und der Entschiedenheit eingestellt, und ich sehe jetzt schon der Zukunft mit viel mehr Zuversicht und Hoffnung entgegen als noch vor wenigen Tagen. Ich glaube, dass schon wenig Tage nach Eröffnung der Nationalversammlung durch die Festigkeit u. Kraft derselben, durch rasches u. entschlossenes Handeln, sich die Zuversicht u. das Vertrauen in Deutschland wieder herstellen werden, und dadurch wird hoffentlich zugleich die allgemeine Geschäftsstockung, welche uns im gegenwärtigen Augenblick durch die gänzliche Brotlosigkeit der Arbeiter die größten Gefahren zu bereiten droht, ihr Ende erreichen.
In meinem Stübchen habe ich mich ganz wohnlich eingerichtet, und es ist mir, als hätte ich schon lange da gewohnt. Wahrscheinlich wird die förmliche u. feierliche Eröffnung der Nationalversammlung schon nächsten Donnerstag, übermorgen, vor sich gehen. Dann wirds alle Tage was Neues geben. (…)
Am 18. Mai. Noch immer habe ich keinen Brief von zu Hause. Es laufen zwar häufig Briefe an mich ein, aber wenn ich sie erbreche, sind sie immer nur Selbstempfehlungen hiesiger Tuch-, Galanterie-, Modewaren-, Zigarren- u. anderer Händler. Auch haben sich wieder zwei Bediente u. ein Sekretär bei mir angemeldet, und die Handwerksburschen aus Jena u. Weimar bemühen sich drei Tage hoch, um die Landsmannschaft aufzusuchen u. sich ein Reisegeld zu erbitten. Es gibt jetzt jeden Abend Straßenkrawall hier, täglich werden welche arretiert, welche die Republik ausrufen. Auch die umliegenden Ortschaften sind sehr republikanisch. Die Regierungen tragen aber auch nach Möglichkeit dazu bei, das Volk aufzureizen und misstrauisch zu machen. So jetzt wieder der König v. Preußen. Der hiesige Gasthof: zum König v. Preußen, hat seinen Namen umgeändert in: Deutscher Hof. Die linke Seite des Parlaments wird dort heute eine Vorberatung halten über die Wahl eines Präsidenten; die rechte Seite wird für Gagern2 sein, die linke für Robert Blum3, ich glaube, dass die rechte Seite wenigstens in der Präsidentenfrage die entschiedene Majorität haben wird. – Die Stadt gewinnt ein festliches Ansehen. Die seit sechs Wochen aufbewahrten schwarz-rot-goldenen Fahnen flattern plötzlich wieder aus allen Fenstern.
Am 19. Mai. Gestern Nachm., 4 Uhr, ist die Nationalversammlung feierlich eröffnet worden unter Glockengeläute u. Kanonen-Donner. Die erste Sitzung ging mit Formalien dahin. Gestern Abend bis 11 Uhr waren noch vorbereitende Zusammenkünfte wegen der Wahl eines provisorischen Präsidenten. Die linke Seite besteht nicht auf Robert Blum, sondern wird, um eine Vermittlung mit der rechten Seite herbeizuführen, Soiron4 ihre Stimme geben, u. man glaubt, die rechte Seite werde sich dem anschließen. Zum Zeitunglesen habe ich hier noch nicht kommen können, habe aber erzählen hören, im Frkf. Journal habe von einer Zusammenkunft von Weimarern u. Jenensern auf der Oelmühle gestanden. Wie ist es damit? Schreibe mir doch das Nähere darüber. Hat es nur gestern in unserem Garten auch so schön geregnet wie hier? Die Luft hat sich aufs wohltätigste abgekühlt.
Ich schließe nunmehr diesen Brief, ohne dass ich bis jetzt irgendeine Nachricht von zu Hause hätte. Schreibe ja recht bald. Grüße alle, alle vielmals von mir, besonders auch die Weimarischen u. Meininger Jungen5, an die ich nicht besonders schreiben kann, u. gib mir Nachricht, wie es ihnen geht. Hoffentlich seid ihr noch alle gesund, namentlich auch Hermann6 u. Bernhard7.
Lebt wohl einsteilen. Um 8 Uhr muss ich schon wieder in die Versammlung.
Euer treuer Vater
1 Der Fünfziger-Ausschuss sollte auf Beschluss des Vorparlaments den Bundestag bis zum Zusammentritt der Nationalversammlung unterstützen und überwachen.
2 Heinrich von Gagern (1799-1880) war seit März 1848 Ministerpräsident der hessischen Märzregierung.
3 Siehe den Robert Blum-Band dieser Edition.
4 Alexander von Soiron (1806-1855), Advokat aus Mannheim, war zuvor Präsident des Fünfziger-Ausschusses.
5 Gemeint sind Schülers Söhne Fritz (geb. 1829) und Rudolph (geb. 1832), die in Weimar das Gymnasium besuchen, sowie Ludwig (geb. 1831) und Richard (geb. 1824), die in Meiningen zur Schule gehen.
6 Hermann Schüler (geb. 1825), der älteste Sohn, Pharmazie- und Philosophiestudent in Jena.
7 Bernhard Schüler (geb. 1846), der jüngste Sohn.
Schon seit längerer Zeit fühlte ich die Verpflichtung und das Bedürfnis, meinen Mitbürgern, in deren ehrenvollem Auftrag ich mich hier befinde, öftere Mitteilungen über den Gang der Verhandlungen der konstituierenden National-Versammlung zu machen, teils weil ich ihnen Rechenschaft schuldig bin, teils aber auch in meinem eigenen Interesse, um falschen Auffassungen und Missdeutungen meiner Abstimmungen zu begegnen. Weiterlesen
Ich stand jedoch anfänglich an, die Jenaischen Wochenblätter zu diesen Mitteilungen zu benutzen, indem diese nur in Jena, nicht aber in den übrigen Städten und Ortschaften meines Wahlbezirks gelesen werden. Da sich mir jedoch ein anderes Organ nicht darbietet, die Redaktion der Jen. Wochenbl. aber mit dankenswerter Bereitwilligkeit mir ihre Vermittlung zugesagt hat, so habe ich dieses Anerbieten ergriffen, indem es doch besser ist, ich mache einem Teil meiner Wähler meine Mitteilung als gar niemandem, und indem ja diese Blätter auch den Bewohnern der übrigen Ortschaften des Wahlbezirks zugänglich sind, wenn sie sich dafür interessieren.
Ich werde natürlich nicht das nochmals mitteilen, was in allen Zeitungen und in den stenographischen Berichten steht, aber ich möchte meine Mitbürger ein wenig hinter die Kulissen sehen lassen, sie ein wenig mit dem Parteigetriebe bekannt machen, welches nicht jedem offen vorliegt und doch zum Verständnis der Verhandlungen so wichtig ist. Ich beginne mit der Schilderung der einzelnen Parteien und deren Schattierungen.
Sogleich nach dem Zusammentreten der Nationalversammlung war zu bemerken, dass sich dieselbe in zwei Parteien teile, welche sich auch schon im Vorparlament und im Fünfziger-Ausschuss herausgestellt hatten; die eine Partei, die linke Seite genannt, bestand etwa aus einem Drittel, die andere, die rechte Seite, aus etwa zwei Dritteln der Mitglieder der Versammlung. Man versuchte anfänglich von der rechten Seite her, dieser Partei den Namen der konstitutionell-monarchischen beizulegen und die linke Seite die republikanische Partei zu nennen, allein diese Benennungen haben keinen Eingang gefunden, denn sie sind ganz unrichtig; es handelt sich bei der Parteistellung gar nicht um die theoretische Frage über Republik oder konstitutionelle Monarchie, sondern um das mehr oder weniger entschiedene Ergreifen derjenigen Maßregeln, welche durch die gegenwärtige ganz eigentümliche und verwickelte Lage Deutschlands geboten sind, es gibt auch auf der linken Seite viele, welche an sich für die konstitutionelle Monarchie sind, und es gibt dagegen auch auf der rechten Seite Männer, welche erklären, sie hielten an sich und der Theorie nach die Republik für die bessere Staatsform. Republikaner in dem Sinne, dass sie die jetzt bestehenden Monarchien in den einzelnen deutschen Ländern sogleich ganz aufheben wollten, gibt es auch auf der äußersten Linken fast gar nicht. Am wenigsten sind die Mitglieder der linken Seite mit denen zu verwechseln, welche Aufruhr und Unordnung hervorrufen wollen, sie wollen vielmehr Ordnung und Gesetzlichkeit dauernd befestigen, und sie unterwerfen sich aufrichtig den Beschlüssen der Mehrheit, wenn ihnen diese auch nicht angenehm sind.
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Seiten der Nationalversammlung ist vielmehr der, dass die linke Seite die errungene Freiheit des Volks in ihrer vollen Ausdehnung und die Einheit Deutschland gegenüber den Sonderbestrebungen der mächtigeren deutschen Monarchen rasch und entschieden gesetzlich feststellen, dass sie die höchste Autorität in Deutschland in die Hände der Nationalversammlung und der Zentralgewalt legen will, um Ruhe und Ordnung herstellen und zugleich den allenthalben auftauchenden Reaktionsgelüsten kräftig entgegentreten zu können, damit sie sich in dem Stand erhalte, die zu beschließende Verfassung ungehindert von dem Widerstreben der Einzel-Regierungen einführen zu können. Die rechte Seite dagegen will mehr die bestehenden Zustände aufrechterhalten, sie will sich um die laufenden Vorgänge in Deutschland so wenig als möglich kümmern, sondern in Ruhe die Verfassung ausarbeiten und dann über deren Einführung eine Vereinbarung mit den deutschen Fürsten treffen.
Beide Hauptparteien waren natürlich im Anfange nicht organisiert, erst allmählig fanden sich die Gleichgesinnten mehr zusammen. Man versuchte, für die Parteien Programme (politische Glaubensbekenntnisse) aufzustellen, die die Mitglieder unterschreiben sollten, man fand aber bald, dass sich die Verschiedenheiten nicht in bestimmte Formeln fassen ließen; bei verschiedenen Fragen gestalteten sich die Parteien wieder anders, es musste mehr dem Gefühl jedes Einzelnen anheimgestellt werden, zu welcher Partei er eigentlich gehöre.
Seit Beschließung des Gesetzes über die provisorische Zentralgewalt gestalteten sich die Parteien bestimmter, man sonderte sich in einzelne Klubs ab, welche sich mehr und mehr abschlossen, die einzelnen Klubs nahmen Statuten an, welche aber mehr die Organisation, die Disziplin und Taktik der Klubs betrafen, von Aufstellung bestimmt formulierter Glaubensbekenntnisse sah man mehr und mehr ab. Doch sind natürlich den Mitgliedern die Ansichten und Grundsätze des Klubs bekannt, und wer gegen die Grundsätze des Klubs spricht oder abstimmt, muss natürlich aus dem Klub austreten.
Gegenwärtig bestehen, von der linken nach der rechten Seite zugerechnet, folgende Klubs:
1) Der Klub im Donnersberg1, sonst im Holländischen Hof oder Hotel Schröter, dieser Klub bildet die äußerste Linke, er nennt sich radikal-demokratisch, seine Mitglieder sind entschiedene Republikaner, ohne jedoch in den Einzelstaaten Deutschlands die erbliche Fürstenwürde gegen den Willen der Bevölkerung aufheben zu wollen. Bezüglich der völkerrechtlichen Verhältnisse stellen sie das Prinzip der Humanität, der Gerechtigkeit, der freien Selbstbestimmung jedes Volkes oben an und verdammen alle Eroberungskriege. Auf das Prinzip der Nationalität legen ihre Wortführer wohl zu wenig Gewicht. Der Klub besteht aus etwa 40 Mitgliedern. Ruge 2 und Zitz 3 gelten als die Führer, obwohl Zitz in der Nationalversammlung wenig hervortritt. Es sind ausgezeichnete Männer und Redner von Geist und Feuer in diesem Klub, darunter mögen nur genannt werden: Schmidt aus Löwenberg in Schlesien, Zimmermannaus Stuttgart (bekannt durch seine Geschichte des Bauernkriegs), Hagen aus Heidelberg, Simon aus Trier, Wesendonck aus Düsseldorf, Kollaczek aus Schlesien. Auch Schaffrath und Günther aus Sachsen, Wiesner aus Wien, Brentano etc. gehören diesem Klub an4.
2) Der Klub zum Deutschen Hof; er wird gewöhnlich gemeint, wenn man von der linken Seite ohne weiteren Beisatz spricht. Dieser Klub, welchem ich selbst angehöre, will die durch die Revolution erlangte oder erstrebte Volksfreiheit in ihrer vollen Ausdehnung und in allen ihren Konsequenzen; in Beziehung auf die Verfassung der Einzelstaaten geht er davon aus, dass die Revolution (wie es in der Paulskirche ausgedrückt wurde) vor den Thronen stehen geblieben ist, dass also die Einzelstaaten ihre Fürsten behalten wollten, dass aber Adel und Hofschranzenwesen, Pomp und Etikette, Beamtenherrschaft und Vielregieren keineswegs dem deutschen Volke besonders angenehme Dinge sind und soweit als möglich aufgehoben oder beschränkt werden müssen, dass möglichste Einfachheit und Sparsamkeit im Staatswesen einzuführen ist. Während aber in den Einzelstaaten das Bestehen der erblichen Monarchie unangetastet bleiben soll, ist der Klub darin einverstanden, dass der Gesamtstaat Deutschland keinen Obermonarchen, keinen Kaiser, erhalten, sondern eine den demokratischen Prinzipien entsprechende Verfassung bekommen soll, denn wie auch das einzelne Klubmitglied über Monarchie oder Republik an sich denken mag, so stimmen sie doch darin überein, dass, solange die Untermonarchien bestehen, eine so ganz eigentümliche Verbindung zwischen einem Obermonarchen und 34 Untermonarchen, die sich gegenseitig stützen und tragen, die ihre Kräfte gegen die Freiheitsideen vereinigen würden, einen unerträglichen Druck hervorbringen müsste, schlimmer als der alte Bundestag, welcher nur in neuer Gestalt mit einem Oberpolizeidirektor an der Spitze, dadurch auferstehen würde. Auch an die Kosten einer kaiserlichen Civilliste und eines kaiserlichen Hofstaates neben den schon bestehenden 34 Civillisten darf gedacht werden, denn wenn gleich eine gute Regierungsform niemals zu teuer erkauft werden kann, so ist doch jeder Groschen zu bedauern, welcher aufgewendet wird, um eine schlechte Regierungsform herzustellen. Der Deutsche Hof legt viel mehr Gewicht auf das Prinzip der Nationalität und auf die Einheit Deutschlands als der Donnersberg, er achtet aber auch bei anderen Nationen ihre Freiheit und Selbstständigkeit und verabscheut jeden Eroberungs- und Unterdrückungskrieg. Sein deutscher Patriotismus verleitet ihn nicht zur Ungerechtigkeit gegen andere Völker.
Der Deutsche Hof ist das Stammhaus der ganzen linken Seite, die übrigen Fraktionen haben sich allmählig von ihm abgespalten; aber sie betrachten den Deutschen Hof fortwährend als das Mutterhaus und haben freien Zutritt zu seinen Klubsitzungen. Sollen gemeinschaftliche Beratungen aller Schattierungen der linken Seite sein, so kommen sie im Deutschen Hof zusammen. Die Mitglieder des Deutschen Hofs stehen mit den Mitgliedern des Donnersbergs und der Westendhall in den persönlich freundschaftlichsten Verhältnissen, sie verteidigen und schützen sich gegenseitig gegen die Bedrückungen und Anfeindungen der rechten Seite. Der Deutsche Hof hält gute Manneszucht, die Unordnungen und Unterbrechungen in den Sitzungen der Nationalversammlung, welche so oft von der linken Seite ausgehen, fallen nicht dem Deutschen Hof zur Last, sondern fast ausschließlich dem Donnersberg, welcher keineswegs gut diszipliniert ist. Da jedoch die Mitglieder der verschiedenen Klubs der linken Seite in der Paulskirche vermischt untereinander sitzen, so müssen wir es mit auf uns nehmen, wenn der Donnersberg Unordnungen anfängt. Unter den Mitgliedern des Deutschen Hofs ist viel gesunder, frischer, freier und mutiger Sinn.
Der Klub zum Deutschen Hof hat über 70 Mitglieder. Blum5und Vogt sind die Hauptredner. Auch Itzstein gehört zu diesem Klub, aber er kommt nicht häufig in die Klubsitzungen und spricht noch seltener darin. Eins der ausgezeichnetsten Mitglieder ist Löwe aus Calve. Auch Nauwerck aus Berlin, Rösler aus Oels etc. verdienen genannt zu werden.6 Die meisten Sachsen, fast alle Rheinbaiern, viele Württemberger, Schlesier, Österreicher etc. gehören diesem Klub an.
3) der Klub in Westendhall (weshalb die Mitglieder gewöhnlich Westindier genannt werden). Es ist dies eine Schattierung der reinen linken Seite; er stimmt in seinen Grundsätzen und in seiner Abstimmung ganz mit dem Deutschen Hof zusammen, nur könnte man sagen, dass die Westindier die Sachen etwas mehr staatsmännisch, fast diplomatisch behandeln gegenüber der naiven Treuherzigkeit der meisten Mitglieder des Deutschen Hofs, welche mehr Volksmänner als Staatsmänner sind. Westendhall birgt daher auch mehr künftig mögliche Minister in seinem Schoße als der Deutsche Hof. Auch persönlich sind die Westindier uns eng befreundet, und wir haben bereits die vollständige Vereinigung beider Klubs versucht. Nur an einigen Zufälligkeiten und an wenigen Personen ist es gescheitert. Bei allen wichtigen Angelegenheiten beschicken und besprechen wir uns. Dagegen sind die Westindier in etwas gespanntem Verhältnis zu dem Württemberger Hof. Die Führer der Westendhall gehörten nämlich früher selbst zum Klub des Württemberger Hofs, den sie erst gestiftet hatten, sie traten aber dort aus, weil der Württemberger Hof durch Eintritt vieler Mitglieder aus dem Zentrum immer mehr zu einem linken Zentrum als zu einer Schattierung der reinen linken Seite wurde. Westendhall besteht aus 36 Mitglieder. Als die hauptsächlichsten müssen genannt werden: Raveaux, die beiden Simon aus Breslau. Rappard, Schoder, Venedey, Vischer aus Tübingen, Reh aus Darmstadt, Jucho aus Frankfurt u. A. 7
4) Der Klub im Württemberger Hof, das linke Zentrum. Dieser Klub nimmt in Übereinstimmung mit der reinen linken Seite das Prinzip der Volkssouveränität an und will, dass die künftige Reichsverfassung dieses Prinzip gewährleiste. Er erkennt die Nationalversammlung für selbstständig konstituierend, unabhängig von der Zustimmung der deutschen Fürsten. Er will die Selbstständigkeit der einzelnen deutschen Staaten so weit, aber auch nur so weit beschränkt haben, als zur Herstellung einer kräftigen Einheit nötig ist. Stimmen aber auch hiernach die ausgesprochenen Grundsätze des Württemberger Hofs mit denen der reinen linken Seite im Wesentlichen zusammen, so weicht er doch in seinen Abstimmungen häufig von uns ab. Der Württemberger Hof hat es sich nämlich zur besonderen Aufgabe gemacht, ein vermittelndes Element zu sein und von den Prinzipien so viel nachzugeben, als es die praktischen Rücksichten verlangen, er ist daher weder warm noch kalt. Bei persönlichen Fragen nimmt er meistens die Partei für die rechte Seite gegen die linke, und hilft uns mit tyrannisieren. Einige Mal, wo wir gemeinschaftliche Maßregeln verabredet hatten, hat er uns bei der Ausführung im Stich gelassen. Es ist daher bei der Linken im Allgemeinen keine günstige Stimmung für den Württemberger Hof, und manche meinen, sie wollten lieber mit offenen und entschiedenen Gegnern zu tun haben als mit den halben und unzuverlässigen Freunden.
Der Württemberger Hof hat 66 Mitglieder. Darunter gehören Mittermaier, Biedermann, Rießer, Clausen, von Hermann, Widenmann, Zacharia, Stenzel, auch die Exminister Heckscher, Robert Mohl, Fallati gehörten zum Württemberger Hof.8 Die Linke im Frack nennt sie Arnold Ruge.
5) Der Klub in der Mainlust. Es hat sich erst ganz kürzlich gebildet dadurch, dass seine Mitglieder, welche früher zum Casino gehörten, dort austraten und auf der Mainlust einen eigenen Klub bildeten. Der Grund ihres Austritts aus dem Casino lag darin, dass sie etwas mehr nach links neigten, namentlich verlangten sie, das Casino solle bestimmt den Grundsatz anerkennen, dass die Nationalversammlung die Reichsverfassung selbstständig und nicht erst durch Vereinbarung mit den Fürsten einführen könne, was jedoch das Casino nicht tat. Mainlust hat 30-40 Mitglieder, darunter sind besonders Lette aus Berlin und Fuchs aus Breslau zu nennen9. Auch Eisenmann10, welcher jetzt, seitdem er die Reaktion sieht, bedeutend mehr nach links neigt, ist aus dem Casino ausgetreten, hat sich aber noch nicht entschieden, ob er zur Mainlust oder zum Württemberger Hof treten will.
6) Der Klub im Casino, früher am Hirschgraben, das rechte Zentrum und die rechte Seite. Es ist mir nicht gut möglich, die politischen Grundsätze, welche diesen Klub zusammenhalten, anzugeben, denn es scheinen die verschiedenartigsten politischen Richtungen in demselben vertreten zu sein; nur eins scheinen die Mitglieder dieses Klubs gemeinschaftlich zu haben, die Gespensterfurcht vor der Republik und die Feindseligkeit gegen die linke Seite. Man kann die Mitglieder dieses Klubs etwa in drei Klassen teilen:
a) Professoren; in dieser Klasse findet man viel guten Willen, viel doktrinäre Schulweisheit, dagegen geringen politischen Takt, große Scheu vor kühnen und eingreifenden Maßregeln, Verkennung der politischen Lage Deutschlands und der Forderungen der neuen Zeit. Sie meinen, sie könnten die Revolution in der Studierstube beendigen, indem sie eine Verfassung ausarbeiten wie ein gelehrtes Werk. Viele scheinen es sich ordentlich zur Ehre anzurechnen, dass sie jetzt noch dieselbe politische Theorie haben wir vor Jahren, dass die freie frische Luft der Neuzeit sie nicht durchdrungen, in ihnen keine neuen Keime und Blüten entwickelt hat. Diese Klasse steht dem linken Zentrum noch am nächsten, sie meint es mit der Freiheit, wenngleich sie dieselbe etwas beschränkt versteht, ehrlich. Viele sind für eine strenge Einheit Deutschlands, welche sie durch einen Kaiser befestigen zu können glauben, andere sind etwas mehr partikularistisch. Als Wortführer dieser Professoren des rechten Centrums können angeführt werden: Dahlmann, Waiz, Beseler11
b) Beamte; sie klammern sich mehr an den Partikularismus an, weil in den Einzelstaaten die Beamtenherrschaft nun einmal befestigt und von der Reichseinheit wenig Heil für sie zu hoffen ist. Hierher gehören die Großherzogl. Badischen Reaktionäre Welcker, Matthy und die Exminister Beckerath, Bassermann, Schmerling etc.12 Diese Klasse steht wohl etwas weiter rechts als die eben genannte Klasse der Professoren.
c) Die Adeligen; sie stehen noch weiter rechts und grenzen an die äußerste Rechte. Die Hauptwortführer — Graf Schwerin, Graf Wartensleben, Fürst Lichnowsky, v. Vincke, v. Auerswald 13 – sind Verfechter des Stockpreußentums und daher entschiedene Partikularisten; sie wollen der Nationalversammlung und der Zentralgewalt – falls nicht etwa der König von Preußen deutscher Kaiser wird – so wenig als möglich Macht geben und alle Gewalt in den Händen der Fürsten der einzelnen deutschen Staaten lassen. Die Nationalversammlung soll daher nicht konstituierend sein, sondern über die Gesamtverfassung mit den Fürsten unterhandeln. Dass diese Klasse überhaupt das historische Recht und das Privilegienwesen vertritt, soweit es heutzutage noch möglich ist, braucht nicht erst erwähnt zu werden.
Das Casino treibt den deutschen Patriotismus häufig bis zur Ungerechtigkeit und Unterdrückung anderer Völker. Viele scheinen zu glauben, die Macht und Ehre Deutschlands werde dadurch erhöht, dass die Fürsten der einzelnen deutschen Staaten, Österreich, Preußen etc., auch große außerdeutsche Besitzungen haben und Eroberungen machen, da doch dadurch die Einheit und Macht Deutschlands mehr untergraben und die Politik dieser Fürsten eine undeutsche wird, auch solche außerdeutschen Länder unter der Herrschaft deutscher Fürsten nur Werkzeuge der Reaktion sind.
Das Casino ist der Zahl seiner Mitglieder nach der stärkste Klub; er zählte vor dem Austritt der Mainlüstlinge gegen 170 Mitglieder. (Die Fortsetzung folgt.)
1 Die Fraktionen (Klubs) wurden benannt nach den Lokalen, in denen sie sich üblicherweise trafen.
2 Arnold Ruge (1802-1880); Philosoph, zog sich schon bald enttäuscht aus der Nationalversammlung zurück. Siehe den Arnold Ruge-Band dieser Edition.
3 Franz Zitz (1803-1877), Jurist, schied im März 1849 ebenfalls aus dem Parlament aus, weil es ihm zu gemäßigt war, und beteiligte sich als Anführer des rheinhessischen Freikorps am pfälzisch-badischen Aufstand. Nach dessen Niederschlagung flüchtete er in die Schweiz und emigrierte dann in die USA.
4 Franz Schmidt (1818-1853), „deutsch-katholischer“ Theologe; Wilhelm Zimmermann (1807-1878), protestantischer Theologe und Historiker; Karl Hagen (1810-1868), Historiker; Ludwig Simon (1819-1872), Jurist; Hugo Wesendonck (1817-1900), Jurist; Adolph Kollaczek (1821-1889), Lehrer; Wilhelm Schaffrath (1814-1893), Jurist; Georg Günther (1808-1872), Journalist; Adolph Wiesner (1806-1867), Jurist und Journalist; Lorenz Brentano (1813-1891), Jurist.
5 Robert Blum (1807-1848), Publizist und Verleger, einer der führenden und populärsten Demokraten, wurde nach der Niederschlagung des Oktoberaufstands in Wien 1848 zum Tode verurteilt und hingerichtet (siehe den Robert Blum-Band dieser Edition).
6 Carl Vogt (1817-1895), Naturwissenschaftler; Adam von Itzstein (1775-1855), einer der Führer der liberalen Opposition; Wilhelm Löwe (1814-1886), Mediziner, Vizepräsident der Frankfurter Nationalversammlung; Carl Nauwerck (1810-1891), Orientalist und Journalist; Gustav Adolph Rösler (1818-1855), Lehrer und Publizist.
7 Franz Raveaux (1810-1851), Publizist und Karnevalist; Ludwig Simon (1819-1872), Jurist; Heinrich Simon (1805-1860), Jurist; Conrad von Rappard (1805-1881), Jurist; Jacob Venedey (1805-1871), Jurist und Publizist; Friedrich Vischer ((1807-1887), Literaturprofessor; Theodor Reh ((1801-1868), Jurist; Friedrich Jucho ((1805-1884), Rechtsanwalt und Notar.
8 Gabriel Riesser ((1806-1863), Notar in Hamburg; Henrik Clausen (1793-1877), Theologe; Friedrich von Hermann (1795-1868), Nationalökonom; Christian Wiedenmann (1802-1976), Advokat in Düsseldorf; Heinrich Zacharia (1806-1875), Professor der Rechte; Gustav Stenzel (1792-1854), Historiker; Johann Heckscher (1797-1865), Jurist; Robert von Mohl (1799-1875), Staatswissenschaftler; Johannes Fallati (1809-1855), Nationalökonom;
9 Wilhelm Lette (1799-1868), Jurist; Carl Fuchs (1801-1855), Jurist.
10 Gottfried Eisenmann (1795-1867), medizinischer Publizist.
11 Friedrich Christoph Dahlmann (1785-1860), Historiker und Staatswissenschaftler; Georg Waitz (1813-1886), Rechtshistoriker, Mediävist; Wilhelm Beseler (1806-1884), Rechtswissenschaftler.
12 Carl Theodor Welcker (1790-1869), Rechtswissenschaftler; Karl Mathy (1807-1868), Journalist; Hermann von Beckerath (1801-1870), Bankier; Friedrich Daniel Bassermann (1811-1855), Unternehmer; Anton von Schmerling (1805-1893), Jurist.
13 Graf Maximilian von Schwerin-Putzar (1804-1872); Alexander von Wartensleben-Schwirsen (1807-1883); Fürst Felix von Lichnowsky (1814-1848); Georg Freiherr von Vincke (1811-1875); Hans von Auerswald (1792-1848).
7) Der Klub im steinernen Haus, die äußerste Rechte.1 Ich bin nicht so tief in die Geheimnisse dieses Klubs eingeweiht, um ihre politischen Grundsätze genau angeben zu können; nach den Personen zu schließen aber scheinen sie möglichst vollständige Wiederherstellung der alten Zustände, Reaktion gegen Freiheit und Einheit Deutschlands zum Ziel zu haben. Nur das Verhältnis der Kirche zum Staat wollen sie total umändern. Kommt es auf Unterdrückung fremder Völker zu Gunsten Österreichs oder Preußens an, so sind sie eroberungssüchtig, aber von Befreiungskriegen (wie in Schleswig-Holstein) scheinen sie keine Freunde zu sein. Ihre Zahl mag gegen 40 betragen; es gehören dazu: v. Radowitz, v. Rotenhan, v. Lasaulx,2 viele Ultramontanen, Bayern etc. Weiterlesen
Es gibt jedoch auch noch viele Mitglieder der Nationalversammlung, welche sich keiner bestimmten Partei angeschlossen haben, sondern sich einzeln auf eigene Faust herumtreiben. Sie werden gewöhnlich Stegreifritter oder Strandläufer genannt. Es sind deren wohl immer noch 120 oder mehr.
Man wird beim Zusammenzählen finden, dass die linke Seite und das linke Zentrum zusammengenommen die Hälfte sämtlicher Klubmitglieder ausmachen.
Schließt sich daher bei einer Abstimmung das linke Zentrum der linken Seite an, so halten sie der rechten Seite gerade die Waage; die Strandläufer geben dann den Ausschlag. Gewöhnlich stimmen sie auf irgendeine Autorität hin mit der rechten Seite; allein da man sich nicht auf sie verlassen und sich mit ihnen nicht verständigen kann, so kann man die Majorität nicht gut vorausberechnen.
Die Klubs haben ihre großen Vorteile, doch sind sie auch nicht ohne Nachteil. Der hauptsächlichste Nachteil besteht darin, dass die einzelnen Klubmitglieder sich durch die Klubsitzungen und Beratungen häufig so in ihren einseitigen Parteiansichten befestigen und versteifen, dass sie schon mit einer ganz bestimmten gefassten Entschließung in die Paulskirche kommen und sich durch die beste Diskussion und die vernünftigsten Gründe nicht mehr belehren lassen. Es sind jedoch die Vorteile weit überwiegend. Sie liegen besonders darin, dass in den Klubsitzungen die Gegenstände erst aufs Ernstlichste beraten und auf allen Seiten beleuchtet werden, so dass man nicht ganz unvorbereitet in die Sitzungen der Paulskirche kommt. Zugleich haben die Klubs festgelegt, dass, eilige Fälle ausgenommen, keins ihrer Mitglieder einen Antrag bei der Nationalversammlung stellen darf, ohne ihn erst dem Klub vorzulegen und dessen Meinung darüber einzuholen; findet dann der Antrag bei der eigenen Partei keine Unterstützung, oder wird man durch die dagegen vorgebrachten Gründe belehrt, dass der Antrag nicht gut ist, so bringt man ihn gar nicht in die Nationalversammlung. Auf solche Weise sollen nur Anträge an die Nat.-Vers. kommen, welche vorher beraten und erwogen sind und wenigstens die Richtung einer bestimmten Partei vertreten, und es soll dem Andrang ganz unbegründeter, zeitraubender, von niemand unterstützter Anträge gewehrt werden. Leider aber kann man dadurch die Strandläufer nicht abhalten, die Versammlung immer noch mit einer Sintflut von nutzlosen Anträgen zu überschwemmen. (…).
Auch wird in den Klubs, besonders vor einem entscheidenden Kampf, der Feldzugsplan entworfen, es werden die hauptsächlichsten Redner der Partei ausgesucht und ihre Reihenfolge bestimmt; man verständigt sich darüber, welche Gründe hauptsächlich geltend gemacht werden sollen und welche Gründe man klugerweise lieber nicht vorbringt; die Unruhigen und Hitzigen werden ermahnt, sich zu mäßigen, sich nicht durch Heftigkeit eine Blöße zu geben oder die Gegner zu reizen.
Bei wichtigen Gegenständen halten auch mehrere Klubs derselben Hauptrichtung gemeinschaftliche Beratungen, und kürzlich ist namentlich bei Gelegenheit der Frage über Sistierung (Aufhebung) des dänischen Waffenstillstandes zwischen Westendhall, dem Deutschen Hof und dem Donnersberg verabredet worden, wöchentlich regelmäßig einmal eine gemeinschaftliche Sitzung zu halten.
Natürlich lernt man schon durch die Klubversammlungen seine eigenen Parteigenossen näher kennen und tritt in freundschaftlichere Beziehungen zu ihnen, als es in Beziehung auf die Mitglieder anderer Parteien der Fall ist; doch ist so viel anzuerkennen, dass der Privatverkehr aller Reichstagsglieder untereinander, von welcher Farbe sie auch sein mögen, ein freundlicher und unbefangener ist. Es hat sich ein eigener Reichstagston gebildet, welcher etwas Kameradschaftliches hat und aus welchem das Komplimentenwesen verbannt ist; niemand redet den anderen mit einem Titel an, sondern bloß mit dem Familiennamen. Kommen in gemeinschaftlichen Speisehäusern, in Weinhäusern, auf kleinen Ausflügen in der Umgebung Männer der verschiedenen Parteien zusammen, so schließen sie sich aneinander an, streiten und kämpfen über ihre Parteiansichten und über die laufenden Tagesfragen, ohne dass ich je eine persönliche Feindseligkeit daraus hätte erwachsen sehen, ja, gerade die Offenheit und Entschiedenheit, mit welcher jeder seine Parteimeinung ausspricht, bringt den offenen und zutraulichen Ton hervor, ein Friede dagegen, den man künstlich dadurch herbeiführen will, dass man über die Differenzpunkte, die einem am meisten am Herzen liegen, nicht miteinander spricht, ist ein fauler und schlechter Friede, welcher zu Heuchelei, zu Spannung, zu innerlicher Verbitterung oder doch zu Leerheit der Unterhaltung führt. Oft, wenn der Sturm in der Paulskirche am heftigsten getobt hat, sieht man unmittelbar darauf außer der Paulskirche die entschiedensten politischen Gegner sich ruhig und unbefangen über die Vorfälle unterhalten; natürlich gibt es aber auch auf den beiden äußersten Seiten einzelne, welche in einseitiger Parteileidenschaft so verbissen und verbittert sind, dass es ihnen nicht möglich ist, mit Männern von anderen Parteien gesellig zu verkehren. Vielfach spricht sich der Wunsch aus, dass wir einen gemeinschaftlichen Versammlungspunkt haben möchten. Manche von der rechten Seite, welche Anfangs eine solche Gespensterfurcht vor den „Republikanern“ hatten, dass sie jeden, der zur linken Seite gehörte, für einen blutdürstigen Wüterich, für einen zweiten Danton oder Marat, hielten, äußerten bei näherer Bekanntschaft unverhohlen ihre Freude darüber, dass sie unter uns so viele gutmütige Menschen, welche mitunter auch wirklich einen Anflug von Menschenverstand hätten, kennenlernten, und sie baten um häufigere gemeinschaftliche Zusammenkünfte, um ihr anfängliches Misstrauen zu überwinden. Es ist auch wirklich merkwürdig, wie manche, welche auf der Rednerbühne von einer ungemessenen Heftigkeit befallen werden, im gewöhnlichen Privatleben die besten und friedfertigsten Menschen sind, so dass man sie durchaus unrichtig beurteilt, wenn man sie nirgends anders sieht als auf der Tribüne.
Vielleicht gestattet es mir die Zeit, später einige der bekanntesten Persönlichkeiten näher zu schildern.
Der Verfassungsausschuss.
Da die Beratungen in großen Versammlungen immer schwerfällig und zeitraubend sind, da zu näherer Beurteilung mancher Beratungsgegenstände spezielle Fachkenntnisse gehören, welche nicht jedes Mitglied der Versammlung hat, da manche Fragen ein genaueres Durchstudieren von Urkunden, Akten, Rechnungen u. dergl. erfordern, so ist es in allen Ständeversammlungen und Parlamenten gebräuchlich, dass wichtigere Gegenstände erst durch dazu niedergesetzte Ausschüsse vorbereitet werden, ehe sie an die ganze Versammlung selbst gebracht werden. So ist es natürlich auch hier in der Nationalversammlung; es sind Ausschüsse niedergesetzt für Entwerfung der künftigen Reichsverfassung, für die bürgerliche und peinliche Gesetzgebung, für Geschäftsordnung, für die völkerrechtlichen Angelegenheiten, für volkswirtschaftlichen Gegenstände, für Prüfung der Wahlurkunden, für Militärangelegenheiten und Volksbewaffnung, für die Kriegsmarine usw. Diese Ausschüsse werden in der Regel so gebildet: Die ganze Nationalversammlung wird durch das Los in 15 Abteilungen geteilt, jede dieser Abteilungen wählt dann aus ihrer Mitte durch Stimmzettel mit absoluter Stimmenmehrheit ein Mitglied in den zu bildenden Ausschuss; jeder Ausschuss besteht sonach regelmäßig aus 15 Mitgliedern. Nur in den Verfassungsausschuss und in den Ausschuss für volkswirtschaftliche Fragen hat man wegen der Wichtigkeit dieser Gegenstände und wegen der vielen diesen Ausschüssen überwiesenen Arbeiten aus jeder Abteilung zwei Mitglieder gewählt, so dass jeder dieser beiden Ausschüsse aus 30 Mitgliedern besteht, mithin aus mehr Personen als manche Ständeversammlung kleiner Länder.
Diese Art, die Ausschussmitglieder nach Abteilungen zu wählen, hat große Nachteile, aber auch wieder ihre Vorteile. Der hauptsächlichste Nachteil besteht darin, dass dem Los, dem Zufall, zu viel überlassen ist. Es ist möglich, dass die Männer, welche sich ganz vorzüglich in einen bestimmten Ausschuss eignen, durch das Los in eine und dieselbe Abteilung kommen; diese Abteilung darf aber nur einen aus ihrer Mitte wählen, die anderen vorzugsweise geeigneten Personen derselben Abteilung sind daher ausgeschlossen. In einer anderen Abteilung ist dagegen wohl gar keine geeignete Person für den bestimmten Ausschuss, und doch muss diese Abteilung ein Mitglied aus ihrer Mitte wählen.
Auf der anderen Seite liegt auch eben in dem Zufall wieder ein Vorzug. Ist nämlich eine Versammlung, wie die hiesige, in mehrere Parteien geteilt, davon die eine Partei in der entschiedenen Mehrheit ist, so würde diese, wenn die Ausschussmitglieder durch die ganze Versammlung gewählt würden, es ganz in der Hand haben, lauter Mitglieder der Mehrheit in die Ausschüsse zu wählen und die Mitglieder der weniger zahlreichen Partei ganz und gar von den Ausschüssen und sonach von der Mitwirkung an den Arbeiten auszuschließen. Werden aber die Ausschussmitglieder aus den durch das Los gebildeten Abteilungen gewählt, so kann es nicht leicht fehlen, dass die Partei, welche in der ganzen Versammlung in der Minderheit ist, doch in einer oder der anderen Abteilung die Mehrheit hat und daher Mitglieder ihrer Partei in die Ausschüsse bringen kann. Die minder zahlreiche Partei wird sich daher das Verlosen der Abteilungen nicht leicht nehmen lassen, und deshalb stimmte auch die linke Seite, wiewohl erfolglos, dagegen, als kürzlich bei der notwendig gewordenen Ergänzung der unvollzählig gewordenen Ausschüsse der Vorschlag gemacht wurde, dass die Ausschüsse selbst Kandidaten zu ihrer Ergänzung vorschlagen und dann aus den Vorgeschlagenen durch die ganze Versammlung selbst gewählt werden sollen.
Von den bestehenden Ausschüssen ist wohl der Verfassungsausschuss einer der wichtigsten. Seine Hauptaufgabe ist, die künftige Verfassung des deutschen Reichs zu beraten und zu entwerfen, doch werden auch andere Gegenstände und Fragen, welche das Verfassungsrecht betreffen, an ihn verwiesen. Da ich selbst in diesem Ausschuss bin, so kann ich über dessen Verhandlungen nähere Auskunft geben. (…)
Der Teil der Verfassung, welchen der Ausschuss zunächst vornahm, war die Feststellung der dem deutschen Volk zu gewährleistenden Grundrechte. Ich bin neuerer Zeit sehr zweifelhaft geworden, ob es klug war, diesen Teil zuerst vorzunehmen. Denn was hilft die Aufstellung von noch so vortrefflichen Grundrechten, wenn sie nicht durch eine einheitliche Verfassung Deutschlands gesichert und geschützt sind? Das Zustandekommen der einheitlichen Verfassung ist aber jetzt viel mehr erschwert als früher, weil in der dazwischen liegenden langen Zeit die Reaktion gegen die Einheit Deutschlands allenthalben rege geworden ist und der Partikularismus sich befestigt hat; war dagegen erst die Verfassung selbst festgestellt, so konnten die Grundrechte nicht ausbleiben, denn die Reaktion weiß wohl, dass sie erst die Einheit zerstören muss, ehe sie sich an die Freiheitsrechte wagen kann. Indessen damals glaubten wir, mit den Volksrechten anfangen zu müssen, und wir konnten nicht entfernt berechnen, dass die Beratung und Schlussfassung darüber eine so unendliche Zeit wegnehmen würden.
Schon bei Beratung der Grundrechte traten die grundsätzlichen Verschiedenheiten der Parteien oft stark genug hervor; man sieht dies schon an den Minderheitsgutachten, welche nicht nur von der linken Seite, sondern auch von der rechten Seite her gegen die Mehrheitsgutachten gestellt worden sind. Doch muss man so viel anerkennen, dass die Anträge des Ausschusses durchgängig von einem freisinnigen Geiste ausgehen, und dass, wenn auch die linke Seite noch manche Verbesserung wünscht. doch schon die Mehrheitsanträge so viel Freiheit gewähren werden, als sie bis jetzt wohl kaum in irgendeinem Land der Welt ist. (…)
1 Diese Fraktion wurde nach einem Umzug in „Café Milani“ umbenannt.
2 Joseph von Radowitz (1797-1853), preußischer Generalleutnant; Hermann von Rotenhan (1800-1858), bayerischer königlicher Kämmerer (Leiter der Finanzverwaltung); Ernst von Lasaulx (1805-1861), klassischer Philologe.
Natürlich hat sich durch die Verwicklungen der neusten Zeit die Stellung der Parteien in der Nat.-Vers. wesentlich geändert. Solange der Kampf bloß ein Kampf der alten, wenn auch etwas gemilderten Polizeiherrschaft gegen die Demokratie war, da war die ganze rechte Seite einig; es gab bloß zwei Hauptparteien, die Partei der Fürstenherrschaft und die der Volksherrschaft – die rechte und die linke. Nachdem aber die Volksfreiheit unterdrückt und der Sieg der Fürstengewalt gesichert ist, zerfällt die rechte Seite nach den beiden großen Dynastien in die österreichische und in die preußische. Die österreich. oder schwarzgelbe, welche nur eine Modifikation des alten deutschen Bundes, ein Direktorium an die Spitze Deutschlands und stillschweigend für Österreich die oberste Leitung des Direktoriums will, besteht natürlich nicht bloß aus Österreichern, sondern sehr viele Bayern und die ganz streng katholische Partei, selbst aus preuß. Gebietsteilen, haben sich ihr angeschlossen; ebenso besteht die preuß. oder schwarzweiße Partei nicht bloß aus Preußen, sondern alle, die für Kleindeutschland und für den preuß. Erbkaiser schwärmen, gehören dazu, namentlich die meisten Schleswig-Holsteiner, Hannoveraner und überhaupt Norddeutschen, aus Süddeutschland hauptsächlich die Mitglieder und Anhänger des Reichsministeriums. So gibt es jetzt eigentlich drei große Parteien in der Paulskirche, die schwarzgelbe österreichische oder Direktorialpartei, die schwarzweiße preußische oder Erbkaiserpartei und die schwarzrotgoldene, rein deutsche Partei oder die Linke, welche das Reichsoberhaupt nicht nach den Dynastien konstituieren wollte. Die drei Parteien halten sich in Schach, keine hat bis jetzt für sich allein die Majorität – und das ist das Unglück der Nat.-Vers. Nach den neusten Vorgängen ist es jetzt noch am wahrscheinlichsten, dass die Erbkaiserpartei eine Mehrheit bekommen wird. Weiterlesen
So wie sich nun die Linke veranlasst gesehen hat, sich zu einem Gesamtklub im Deutschen Hof zu vereinigen, so versammelt sich jetzt die gesamte österreichisch ultramontane Partei – ohne gerade einen geschlossenen Klub zu bilden – im Hotel Schröter, und die Erbkaiserpartei hat ihren gemeinschaftlichen Versammlungsort im Weidenbusch – ebenfalls ohne die einzelnen Klubs aufzulösen. Diese Weidenbuschgesellschaft bildete sich aus Schrecken über die ersten deutlichen Spuren der zwischen den Schwarzgelben und der Linken beabsichtigten Koalition, man wollte ebenfalls eine geschlossene kompakte Masse entgegensetzen. Man ließ im Weidenbusch die Mitglieder sich förmlich durch Namensunterschrift verbindlich machen, für den preuß. Erbkaiser zu stimmen. Nach den letzten Nachrichten hatten sie bereits 245 Unterschriften. Das ist aber noch nicht hinlänglich zur absoluten Majorität, wenn alle Abgeordnete hier sind, und zu dieser wichtigen Abstimmung werden sie alle hierhereilen. Etwa 40 Mitglieder dieser Weidenbuschgesellschaft, welche dem linken Zentrum angehören, haben sich unter Zell's Leitung vereinigt, die rechte Seite des Weidenbuschs etwas in Schach zu halten und ihnen, indem sie sie in der Oberhauptsfrage unterstützen, dagegen wieder Konzessionen bezüglich der Volksfreiheiten abzunötigen, auch überhaupt eine Art Vermittlung zwischen der Linken und den Erbkaiserlichen zu unterhalten. Diese Vermittlungspartei besteht aus dem erbkaiserlichen Teil des Württemberger Hofs (darunter vorzüglich Zell), aus dem s.g. Klein-Westendhall (den wegen der Oberhauptsfrage aus dem Westendhallklub ausgetretenen Mitgliedern, darunter vorzüglich Reh, Jucho, Gravenhorst) und aus dem Klub Landsberg, welcher jetzt weiter links geht als der Augsburger Hof, obgleich der Augsburger Hof eine Absplitterung des Württemb. Hofs, der Landsberg, aber eine Absplitterung des Casino ist.
Der bekannte Welcker'sche Antrag – darauf gerichtet, dass die Nat.-Vers. sofort in einer Abstimmung die ganze Verfassung endgültig annehmen und dem König von Preußen die erbliche Kaiserwürde übertragen solle – brachte neue Verwirrung in die Parteien. In der Paulskirche brachte dieser Antrag (Montag, den 12. März) die Wirkung einer zerplatzenden Bombe hervor. Alles kam in Aufruhr, man traute seinen eigenen Ohren nicht, das Erstaunen wollte kein Ende nehmen, Niemand hörte mehr auf die Fragen der Tagesordnung – die Sitzung wurde geschlossen. Der Sieg des preuß. Erbkaisertums schien mit diesem Augenblick entschieden. Welcker, der Führer eines Klubs, den er gestiftet hatte, um dem kleindeutschen Erbkaisertum entgegenzuarbeiten und um die großdeutsche Direktorial-Regierung durchzusetzen, Welcker selbst trug darauf an, dem König von Preußen die erbliche Kaiserkrone zu übertragen Anfangs glaubte man, es sei sein ganzer Klub, welcher durch ihn spreche, dann wäre allerdings die Majorität für den Preußenkaiser dagewesen; allein man erfuhr bald, dass sein Klub aufs höchste überrascht, ja aufgebracht über seinen Antrag sei. Noch am Abend vorher hatte Welcker in seinem Klub aufs eifrigste gegen das kleindeutsche Erbkaisertum sich ausgesprochen, und am anderen Morgen überraschte er seine Genossen mit diesem Antrag, ohne nur mit einem derselben vorher Rücksprache darüber genommen zu haben. (…)
Auf der Seite der Erbkaiserlichen verursachte dieser Antrag einen großen Siegestaumel; Welcker, der kürzlich noch so Geschmähte, wurde mit Lobeserhebungen überhäuft. Die österr. Partei war wie niedergeschmettert. Die Linke war weniger berührt davon; für ihre Grundsätze, für die völlige Einheit Deutschlands durch die Volksherrlichkeit war ohnehin keine Aussicht auf Sieg mehr gewesen, und ob das Haus Habsburg oder das Haus Hohenzollern Deutschland ruiniere, darauf konnte ihr weniger ankommen.
Welcker's Antrag wurde im Verfassungsausschuss beraten, die große Mehrheit desselben war für den Antrag und legte ein großes Gewicht darauf, dass derselbe sofort zur Beratung in der Paulskirche komme. Die linken, die österreichischen und die ultramontanen Mitglieder des Verf.-Aussch. waren gegen den Antrag; da wir aber bei weitem überstimmt waren, so stellte ich den Zusatzantrag: Wenn über die ganze Verfassung in einer Abstimmung entschieden würde, so sollten sie wenigstens in diese Abstimmung auch das Wahlgesetz, so wie es aus der ersten Lesung hervorgegangen, mit aufnehmen, denn die Grundsätze des Wahlgesetzes gehörten doch eigentlich der Sache nach mit zur Verfassung; auch sei es unbillig, dass sie in der Verfassung, die meistens im Sinne der Erbkaiserlichen ausgefallen sei, uns zumuteten, auf die Abstimmung über die einzelnen Paragraphen zu verzichten, während wir das Wahlgesetz, welches mehr in unserem Sinne ausgefallen sei, nochmals der Chance einer Abstimmung über die einzelnen Punkte unterwerfen sollten; sie würden wohl auch nicht verkennen, dass gerade die überstarke monarchische Gewalt, welche sie an die Spitze stellen wollten, umso mehr eine freie demokratische Grundlage im Wahlgesetz notwendig mache. Ich ließ zugleich durchblicken, dass, wenngleich ich und ein großer Teil der Linken dennoch gegen das Erbkaisertum stimmen würden, so werde es doch auch gewiss manche von der Linken und vom linken Zentrum geben, welche dann für die ganze Verfassung und für das Erbkaisertum stimmen würden, wenn auch zugleich das demokratische Wahlgesetz mit aufgenommen würde, die aber gewiss gegen das Erbkaisertum stimmen würden, wenn man ihm nicht die breite demokratische Grundlage gebe. Der Verf.-Ausschuss in seiner Mehrheit, und darunter auch Hr. Rießer, fanden das ganz billig und in Ordnung, und so wurde in dem Vorschlag des Verf.-Ausschusses auch das Wahlgesetz mitaufgenommen; nur die Modifikation brachte die rechte Seite des Ausschusses noch hinein, dass die Wahlen nicht durch Stimmzettel, sondern durch Erklärung zu Protokoll gegeben werden sollten; ich selbst, ob ich gleich grundsätzlich für die Öffentlichkeit der Wahlen bin, stimmte doch dagegen, dass diese Modifikation in den Vorschlag aufgenommen werde, denn wenn einmal die ganze Verfassung in Bausch und Bogen angenommen und keine einzelnen Punkte herausgezogen werden sollen, so ist es nicht nur unrecht, sondern selbst sehr unklug, wenn die rechte Seite selbst wieder an einzelnen Punkten zu mäkeln anfängt. Überdies werden sie dadurch gewiss wieder mehrere Stimmen vom linken Zentrum verlieren. Denn so wie die Rechte den überwiegend größten Wert auf die Spitze, auf das Oberhaupt legt, so legen wir bei weitem den größten Wert auf die Grundlage, auf das Wahlgesetz. (…)1
1 Die lebendigen Schilderungen Schülers belegen die heillose Zerstrittenheit des ersten deutschen Parlaments, auch nachdem es längst entmachtet war und die Entscheidungen woanders (vor allem in Berlin und Wien) getroffen wurden. Zwar wurde am 28. März 1849 noch die Frankfurter Reichsverfassung (inkl. Wahlgesetz), an der Schüler maßgeblich mitgearbeitet hatte, beschlossen und von den meisten deutschen Einzelstaaten angenommen, nicht aber von Preußen, Bayern, Hannover und Österreich, die den Abgeordneten aus ihren Ländern daraufhin befahlen, ihr Mandat niederzulegen. Am 30. Mai beschlossen die in Frankfurt verbliebenen Abgeordneten, durch die Abgänge waren die Linken nun in der Mehrheit, den Parlamentssitz nach Stuttgart zu verlegen, weil man den Einmarsch preußischer Truppen in Frankfurt fürchtete. Doch auch dieses etwa hundertköpfige „Rumpfparlament“, zunächst von der württembergischen Regierung geduldet, wurde am 18. Juni mit Waffengewalt aufgelöst, die meisten Abgeordneten flohen ins Schweizer Exil. Christian Schüler indessen war noch während seiner Anwesenheit in der Nationalversammlung in den Weimarer Landtag gewählt worden; er kehrte nun nach Thüringen und zu seiner Familie zurück, und trat dort sein Mandat an.
Mit dem Ziel, die Frankfurter Reichsverfassung zu verteidigen, hatte schon Anfang Mai der pfälzisch-badische Aufstand (siehe etwa den Franziska Anneke-Band oder den Carl Schurz-Band dieser Edition) begonnen, mit dessen endgültiger Niederschlagung am 19. Juni die Deutsche Revolution beendet war.
Christian Schüler war kein Publizist. Im Unterschied zu anderen frühen Demokratinnen und Demokraten hat er weder eigene Schriften noch eine Autobiografie hinterlassen. Aber seine privaten und öffentlichen Berichte über seine Abgeordnetentätigkeit in der ersten deutschen Nationalversammlung sind zugänglich – und wichtige Bausteine der deutschen Parlamentsgeschichte.
Sibylle Schüler/Frank Müller: Als Demokrat in der Paulskirche. Die Briefe und Berichte des Jenaer Abgeordneten Gottlieb Christian Schüler 1848/49, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Große Reihe, Band 9, Böhlau Verlag 2007.
Die öffentlichen Parlamentsberichte Schülers erschienen in den „Privilegirten Jenaischen Wochenblättern“ (Jahrgänge 1848 und 1849) und sind abrufbar in der „Elektronischen Zeitschriftenbibliothek“ (http://ezb.uni-regensburg.de).
Monografien zu Christian Schüler liegen nicht vor.
Wir nutzen Cookies und ähnliche Technologien, um Geräteinformationen zu speichern und auszuwerten. Mit deiner Zustimmung verarbeiten wir Daten wie Surfverhalten oder eindeutige IDs. Ohne Zustimmung können einige Funktionen eingeschränkt sein.