
EMMA HERWEGH
Abb.: DISTL – Dichter:innen und Stadtmuseum , Fotograf Andreas Zimmermann
Als einzige Frau an der Seite von 850 Freiheitskämpfern zieht die dreißigjährige Emma Herwegh im Frühjahr 1848 in den Kampf. Die in Paris von Exilanten gegründete „Deutsche Demokratische Gesellschaft“, zu deren politischem Präsidenten ihr Mann, Georg Herwegh, gewählt wurde, hatte eine „Legion“ gegründet und marschiert über Straßburg nach Deutschland, um den badischen Aufständischen um Friedrich Hecker zur Hilfe zu eilen und im Großherzogtum Baden – wie es kurz zuvor, im Februar 1848, in Paris geschehen war – die demokratische Republik auszurufen.
Das Unternehmen scheitert in einer vernichtenden Niederlage im Rheintal bei Dossenbach, in Sichtweite der Schweizer Alpen. Emma und Georg Herwegh können knapp entkommen, müssen jedoch – als nunmehr steckbrieflich gesuchte „Verräter“ – wie schon die Jahre zuvor als politisch Verbannte im Exil verbringen. Von dort aus kämpfen sie „blitzeschleudernd“ weiter, mit Wort und Tat, für ein freiheitliches und demokratisches Deutschland und Europa.
Emma Charlotte Siegmund wird am 10. Mai 1817 als Tochter einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie in Berlin geboren und verbringt dort eine „großbürgerlich“ unbeschwerte Kindheit.
Im November 1841 lernt sie den Dichter und Revolutionär Georg Herwegh kennen, der auf einer vielumjubelten Lesereise durch die deutschen Länder auch in Berlin Station macht. Nur eine Woche später gibt das Paar seine Verlobung bekannt.
Nachdem Georgs Texte auf den Index geraten und er aus Preußen und Sachsen ausgewiesen wird, weicht er in die Schweiz aus, wo das Paar im Februar 1843 heiratet. Noch im gleichen Jahr siedeln die Herweghs nach Paris über und beziehen eine Wohnung in unmittelbarer Nachbarschaft zu den befreundeten und ebenfalls gerade frisch verheirateten Karl und Jenny Marx.
Während der Revolution von 1848/49 unterstützt Emma ihren Mann aktiv und zieht mit ihm und einem „Freiheitsheer“ aus deutschen Exilanten in Paris nach Baden, um sich dem dortigen demokratischen Aufstand anzuschließen.
Nach dem Scheitern der Revolution flüchtet das Paar ins Exil in die Schweiz, wo Emma und Georg ihre politischen Aktivitäten fortsetzen.
Eine Amnestie erlaubt allen politisch Verbannten die Rückkehr nach Deutschland. Die Herweghs lassen sich in Baden-Baden nieder.
Georg stirbt im Alter von nur 58 Jahren an einer Lungenentzündung. Emma lässt ihn, auf seinen Wunsch hin, in der Schweiz, in „republikanischer Erde“, begraben.
Mit 87 Jahren stirbt Emma Herwegh in Parin, wo sie ihren Lebensabend verbracht hat. Ihrem Wunsch gemäß wird sie an der Seite ihres Mannes im Schweizer Liestal beigesetzt.
Elke Heidenreich
Der erste Eindruck, wenn man ihre Schriften und Briefe liest: Was für eine fabelhafte Person! Wie kühn, wie leidenschaftlich, wie unbestechlich, wie klug, wie emanzipiert! Und dann liest man weiter und liest auch über sie und wird skeptischer: Wie besessen! Wie anstrengend! Wie starrsinnig!
Was denn nun? Soll man für Emma Herwegh schwärmen, soll man sie verdammen, oder liegt es irgendwo in der Mitte? „Emma – Herweghs verfluchtes Weib“ nennt Michail Krausnick eine Schrift über sie und zitiert damit einen württembergischen Soldaten, der Emma auf der Flucht verfolgt hatte. „Die Freiheit der Emma Herwegh“ heißt Dirk Kurbjuweits Roman. Sie beschäftigt die Gemüter.
Ich habe siebzehn Jahre in Baden-Baden gewohnt, wo auch die Herweghs ab 1866 im Stadtteil Lichtenthal gelebt haben und wo Herwegh 1875 starb. In dieser Stadt war ihr Andenken immer lebendig, und lange glaubte ich, die irritierend erschütternden Zeilen seien von ihr: Weiterlesen
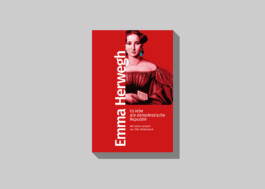
Emma Herwegh
Es lebe die demokratische Republik
Erschienen am 09.02.2023
Taschenbuch mit Klappen, 176 Seiten
€ (D) 14,– / € (A) 14,40
ISBN 978-3-462-50001-1
Was für eine Frau, dachte ich, und weiß jetzt: Es sind Verse ihres Mannes Georg Herwegh, dem und dessen politischen Ideen sie quasi ihr ganzes Leben gewidmet hat, ihr Leben und ihre Kraft, von der sie offensichtlich mehr hatte als er, der Poet und Revolutionär. Wäre er auch ohne Emma so weit gegangen, wie er ging, hätte er ohne sie so viel Verfolgung, so viel Exil auf sich genommen, so wenig künstlerische Entfaltung erfahren, er, der doch eigentlich Dichter war, wenn auch mit einem flammenden Herzen für die noch zu erkämpfende Demokratie? Hätte er ohne Emma auch so leidenschaftlich weitergemacht?
Auch Emma hätte ein anderes Leben haben können als das unruhige an der Seite eines Revolutionärs. Aber es scheint, als habe sie ein Leben auf der Flucht, mit lauter Männern, zu Pferde, Pistolen im Hafter, illegal über Grenzen, geradezu geliebt. Wie hat das alles angefangen?
Sie kommt als Emma Siegmund, geboren im Mai 1817, aus reichem, bürgerlichem Haus. Der Vater ist Hoflieferant für feine Seide und andere Stoffe, hat ein Modewarengeschäft in Berlin, ein großes prächtiges Haus in der Nähe des Schlosses. Man hat Geld, Bildung, Kontakte in Salons. Emma lernt Sprachen, kennt sich in der Literatur aus, sie zeichnet, sie komponiert, sie reitet und schwimmt nachts im See, benimmt sich überhaupt oft unerhört und nicht wie eine Dame aus bester Gesellschaft: Konflikte mit der Mutter sind vorprogrammiert. Sie schreibt Tagebuch, sowohl leidenschaftlich, was die Sehnsucht nach einem anderen Leben, als auch gelangweilt, was eben das tägliche Bürgerleben betrifft. Sie teilt ordentlich aus, nennt die Männer in ihrer Umgebung „Beamtenseelen, Menschenware, niederträchtige Gesellschaft, Schufte, Philister, liberales Pack, Schöngeister, Windbeutel, Esel, entmarkte Gesellen, Höflinge, Speichellecker“. Heiratsanträge lehnt sie durchweg ab. Ohnehin wäre sie viel lieber ein Mann und schreibt in ihr Mädchentagebuch: „Es gibt Stunden, Tage, wo ich alles hingeben möchte, ein Mann zu sein. Alles, damit ich so auftreten könnte, wie’s die innere Stimme mich heischt und der Frauenrock mir verbietet.“
In ihre Jungmädchenzeit fallen die französische Juli-Revolution von 1830, nach der König Karl X. abdankte und ins britische Exil flüchtete, der Novemberaufstand in Polen für nationale Einheit und Unabhängigkeit und das Hambacher Fest 1832, auf dem Demokratie, Freiheit und eine vereinte deutsche Nation gefordert wurden, die es nicht gab. Der Funke glomm, in ganz Europa.
Emma ist begeistert von den Freiheitskämpfen der Polen, hat und unterstützt Freunde dort, verachtet den russischen Zaren und den preußischen König, und in ihrem Tagebuch schreibt sie 1841: „Wie aber, wenn eine Zeit käme, wo jeder Mensch königlich dächte, wo die Gesamtbildung eine so allgewaltige wäre, dass der Mensch im Andern nur den Bruder sähe, wo nur Verdienste anerkannt würden, wo der Geist des Göttlichen sich in jeder Brust offenbart hätte; bedürfte es dann jener Könige noch?“
Sie sehnt sich nach Veränderung, aber mehr noch: nach Liebe. Und die junge Emma, nun schon 25 Jahre alt und fast übers Heiratsalter hinaus, wartet. Worauf? Sie weiß es selber nicht. Auf ein Ereignis, auf einen frischen Wind, auf die große Liebe. Und dann liest sie die Gedichte des jungen Georg Herwegh, „Gedichte eines Lebendigen“, und da sind sie, diese Zeilen:
„Wir haben lang genug geliebt,
und wollen endlich hassen.“
Das ist es! Sie soll ausgerufen haben: „Das ist die Antwort auf meine Seele!“ Raus aus dem sanften behüteten Bürgerleben, rein ins Abenteuer einer anderen Welt, einer anderen Denkart! Sofort verliebt sie sich in den Schreiber dieser Zeilen, will ihn kennenlernen, lernt ihn kennen, ihn, der eine Art Popstar auf Lesereise ist: Am 6. November 1842 kommt er auf ihre Initiative in ihr Elternaus in Berlin, und die Verlobung passiert genau sieben Tage danach, am 13 November. Es heißt, sie sei diejenige gewesen, die den Antrag gestellt habe. Denkbar ist es. Denn die traditionelle Frauenrolle und die Zurückhaltung der Frau galten für Emma Siegmund so wenig wie dann für Emma Herwegh. Sie war emanzipiert, ehe es diesen Gedanken überhaupt gab. Ihre feste Überzeugung: Eine Frau ist in nichts weniger wert als ein Mann. Herwegh schrieb nach der Begegnung mit ihr an einen Freund: „Das Mädchen ist noch rabiater als ich und ein Republikaner von der ersten Sorte.“ Das zeigt sich in einem Brief Emmas an ihn, kurz nach der Verlobung, im Dezember 1842, wo sie schreibt: „Wir wollen vereint Blitze in die Welt schleudern, ach, und ich will ihnen beweisen, was eine Frau tun kann, wenn sie ihr eigen Ich beiseite setzt.“ Und ab jetzt gerät Emma in einen Liebes- und Lebensstrudel, der nicht mehr abreißt.
Die Umstände ihrer Hochzeit im Februar 1843 (der russische Anarchist Bakunin fungierte als Trauzeuge) sind abenteuerlich, alles ist abenteuerlich an diesem Leben, und man fragt sich, wie diese Frau überhaupt die drei Kinder Horace, Camille und Marcel bekommen und aufziehen konnte, bei den dauernden Ortswechseln, den strapaziösen Reisen mit einem Haufen schlecht ausgerüsteter, gesuchter und verfolgter Revolutionäre, immer sie vorneweg als einzige Frau, ein Leben für Georg, gegen den König, für die Revolution, in wechselnden, immer elender werdenden Wohnungen, auf Gewaltmärschen, mit Krankheit und Verfolgung. Und sogar ihren Witz verliert sie dabei nie und schreibt einmal an ihren Mann: „Im Übrigen ist die Erde rund, und wenn man so sukzessive von einem Ort zum andern ausgewiesen wird, so muss man endlich doch wieder nach Hause kommen.“
Georg macht manchmal schlapp, Emma nie. Alexander Herzen schreibt in seinen Erinnerungen „Mein Leben“: „Sie war in ihrer Art nicht dumm und verfügte über weit mehr Kräfte und Energie als er.“ Schweizer Zeitungen berichteten, Emma spränge auf Wirtshaustische, rauche Zigarren und hielte flammende Reden.
Und flammend ist ja auch die hier vorliegende Schrift, auf deren Titel sie nicht ihren Namen nennt, sondern als Autorin angibt: „Von einer Hochverräterin.“ Denn als solche wurde sie mittlerweile streckbrieflich gesucht. Es ist eine Trotz-Schrift über den misslungenen Feldzug demokratischer Freiheitskämpfer von Paris nach Deutschland, ein Misslingen, für das Herweghs „Deutsche Demokratische Gesellschaft“ selbst nichts konnte. Da kam vieles zusammen, und Emma wollte klarstellen, was.
Es gab Vorwürfe gegen ihren Mann, er sei feige gewesen und verantwortungslos und habe die Legion ins Scheitern geführt. Emma schreibt: „Herwegh hatte bei allem, was er getan, nie einen persönlichen Zweck, nie etwas anderes als das eine, große Ziel: die Freiheit aller vor Augen gehabt, und diesem sich zu nähern sorglos seinen Weg verfolgt, unbekümmert um das Lob oder den Tadel, der ihn treffen könnte.“
Schon seinetwegen musste sie diese flammende Rechtfertigungsschrift einer Republikanerin unter die Leute bringen, was nicht ganz einfach war. Der Aufsatz sollte zunächst bei Zacharias Carl Löwenthal in Frankfurt erscheinen, aber der will es nicht drucken, weil zu viele Schmähungen gegen einen seiner persönlichen Freunde darin seien. Auch die vielen Majestätsbeleidigungen machen es nicht leicht, einen Verleger zu finden – schließlich wird einiges gestrichen und die Schrift kann 1849 erscheinen, bei Arthur Levysohn in Grünberg, Schlesien, und: Sie wird sofort verboten. Wenn man den Text heute liest, ahnt man, welche Strapazen die Verfasserin auf sich genommen hat, wieviel Mut und Überzeugung es sie gekostet haben mag, an diesem gefährlichen Zug der Kämpfer für die Demokratie durch feindlich gesonnenes Land teilgenommen zu haben. Das tapfere Häuflein der Freiheitskämpfer war nicht nur durch Polizei und Soldaten bedroht, sondern zermürbt durch tagelange Gewaltmärsche in Schnee, Regen, Matsch, auf Geröllpfaden, hungernd, verzweifelt. Emma muss als eine Art Anführerin immer wieder Mut gemacht und angetrieben haben – mit unvorstellbarer Energie und Disziplin. Das ist zu bewundern. Es gab durchaus auch andere Frauen, die in dieser Zeit Vorkämpferinnen für Emanzipation und Demokratie wurden, zum Beispiel die Schriftstellerin Fanny Lewald, die Frauenrechtlerin Louise Aston, die dichtete: „Freiem Leben, freiem Lieben / bin ich immer treu geblieben“, oder Louise Otto, die den Allgemeinen Deutschen Frauenverein gründete. Aber keine personifizierte sich mit der Sache der politischen Revolution so bedingungslos wie Emma Herwegh.
Und es fällt auch auf, dass sie nie national, sondern immer europäisch denkt – die Demokratie ist ihr ein „großes, weltbefreundendes Ereignis“, sie will sie nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Aber sie muss auch starrköpfig gewesen sein und nicht eingesehen haben, wann die Sache verloren war. Am Ende ging es nur noch darum, das Leben zu retten, das eigene und das einiger hundert Männer. Genau besehen ist ihre Schrift, durch die ein frischer, zorniger Wind weht, der Versuch einer Rechtfertigung für ihren Mann Georg Herwegh und sein Scheitern. Und dabei mag die Liebe zu ihm eine sehr viel geringere Rolle gespielt haben als ihr unverbrüchlicher Glaube an die Idee der Revolution. Denn schon 1843, noch vor der Hochzeit, hatte sie in einem Brief an Herwegh geschrieben: „Was die Leute Liebe nennen, ist mir lächerlicher, skizzenhafter Seelenkitzel. Man sieht ja, was daraus wird, Kinder höchstens, für die Menschheit aber nichts, keine Tat, keine Selbstverleugnung, nichts als eitle Sichwiederspiegelung des jämmerlichen Subjekts, was man nicht gering genug anschlagen kann, wenn es gilt, Opfer zu bringen in rechtem Sinne des Wortes.“ Andererseits, in einem Brief nur zwei Wochen später: „Nur in der Liebe fühle ich mich ganz fertig und gestählt zu Größtem.“
Dirk Kurbjuweit lässt sie in seinem Roman „Die Freiheit der Emma Herwegh“ dem jungen Frank Wedekind in ihrer Dachkammer in Paris ihr Leben erzählen und sagen: „Was meinen Sie, was eine Frau tun musste, die in der Politik wirken wollte? (..) Sie musste den richtigen Mann heiraten, das war damals so, nur über die Liebe konnte man sich emanzipieren, und jetzt ist es nicht viel anders. Ich konnte politisch wirken, weil ich einen politischen Mann hatte.“ Ein Romantext, aber vielleicht sehr nah an der Wahrheit, und die Gespräche mit dem jungen Wedekind gab es ja tatsächlich. Und sie erzählt Wedekind auch, sie sei recht apart, aber nicht besonders schön gewesen: Sie habe seidenweiches Haar gehabt, ideale Lippen, eine schmale Stirn, eine feine Nase, aber alles habe nicht so ganz zueinander gepasst. In ihrer Ehe mit Georg gab es Betrug (vermutlich auf beiden Seiten), Eifersucht, sogar eine zeitweise Trennung, ehe man wieder zueinander fand, aber es gab niemals Zweifel an der gemeinsamen politischen Mission und am festen Glauben an die Revolution für die Demokratie.
Mut und Leidenschaft sind dieser Frau nicht abzusprechen, Augenmaß mitunter schon. Alexander Herzen, anfangs Freund und Mitkämpfer, später Gegner (unter anderem auch wegen der heftigen Affäre, die Georg Herwegh mit Herzens Frau hatte!), schreibt in seinen Erinnerungen:
„Die äußerlich veranlagte, bewegliche Emma hatte nicht das Bedürfnis nach intensiver innerlicher Arbeit, die offensichtlich nur Schmerzen verursachte. Sie gehörte zu jenen unkomplizierten Zweitakt-Naturen, die mit ihrem Entweder-Oder jeden gordischen Knoten, ganz gleich ob von links oder von rechts, zerhauen, nur um irgendwie davon loszukommen und aufs neue weiterzueilen – wohin? Das wissen sie selber nicht.“
Vielleicht. Aber Emma Herwegh war und blieb radikal, auch die deutsche Einigung unter preußischer Führung 1871 konnte sie nicht beeindrucken. In ihrer Schrift heißt es: „Es wird eine ewige Schmach in der Geschichte bleiben, dass sich in jenen Tagen, wie das Heil der ganzen Menschheit an dem einen Wort ‚Republik‘ hing, kein Mann gefunden, der genug Kopf und Herz besessen hätte, dieses eine Wort zu sagen.“
In ihrer Republik gab es keine Könige oder Kaiser. Ihr Leben lang erfüllte sie die selbstgewählte Rolle als Gefährtin und Mitstreiterin eines revolutionären Helden. Barbara Rettenmund und Jeanette Voirol kratzen an diesem Bild und schreiben in ihrem Buch über Emma Herwegh: „Bei genauerer Betrachtung finden wir jedoch weder Held noch Gefährtin.“
Ja, vieles an Emmas Rigorosität mag irritieren. Aber gilt nicht noch heute, was sie in dieser Schrift so formuliert, als käme frischer Wind zu einem gerade geöffneten Fenster herein? „Dass zu einer neuen Welt vor allem neuer Stoff gehört, neue breite Weltanschauungen, Urmenschen, wenn man sich so ausdrücken darf, um den alten Egoismus, der alten Torheit und zivilisierten Barbarei dem Wesen, nicht nur dem Schein nach den Garaus zu machen – daran denken die Wenigsten, geschweige, dass sie fähig oder Willens wären, sich selbst mit umzuschaffen – und ohne das gehts nicht ehrlich vorwärts.“
Als Georg Herwegh 1875 starb, ließ sie ihn in der Schweiz begraben, in freier Erde, und dort liegt sie auch. Sie überlebte ihn um fast 30 Jahre.
Und sie ist ihren demokratischen Idealen bis an ihr Lebensende im März 1904 in Paris treu geblieben. Erlebt hat sie die Demokratie nicht mehr, es gab in Deutschland noch immer einen Kaiser, und abgesehen vom kurzen Zwischenspiel der Weimarer Republik wurde erst rund hundert Jahre nach den Ereignissen des Jahres 1848 die Demokratie in Deutschland verfassungsmäßige Wirklichkeit: nämlich 1949. Und wir wissen, dass sie noch immer nicht selbstverständlich, dass sie erschütterbar ist, dass sie immer aufs Neue verteidigt werden muss. Schon Georg Herwegh schrieb in einem Resümee der damaligen Ereignisse: „Ohne Republik keine schöpferische Entwicklung des Volkes, ohne Republik kein Wohlstand des Volkes, ohne Republik keine Einheitskraft im Innern und nach Außen, ohne Republik keine Freiheit und keine Freiheit für die Dauer.“
In einem brüchig gewordenen und gefährdeten Europa gelten diese Worte wie eh und je.
Es geht mir mit Deiner Prosa wie mit Deinen Versen, sie sind mir beide der Schlüssel zu meiner eigenen Natur, und tausend Dinge, die noch unbewusst in mir lagen, weckt der heimatliche Klang Deiner Stimme gleich gereift ins Leben. (…), wir bedürfen beide einander durch und durch, und keine Macht soll uns um eine Faser der Seligkeit betrügen, die uns miteinander, und in der Tatkraft durcheinander, werden muss. Schleud're Deine Blitze, denke an nichts, als an das eine, Dein Mädchen liebt die Gewitter, wenn sie rechter Art sind, und wird mitten in dem Feuer nur noch gestählter werden. Du liebst Deutschland, das weiß ich, wie entrüstet Du auch sein magst, oder vielmehr Deine Entrüstung zeigt es – nur was wir lieben, kann uns zur Verzweiflung bringen. Bin ich nur erst mit Dir, mich dünkt, ich könnte die Welt dann erobern, unsere Liebe scheint mir alles möglich machen zu können. (…) Sei auf nichts stolz, als auf Deines Mädchens Liebe, darauf aber kannst Du nicht stolz genug sein, und auf ihre Gesinnung, was Eins ist. Freiheit, Liebe, trenn' es, wer es kann, bei mir ist's Eins.
(Brief von Emma an Georg Herwegh, in: Brautbriefe, herausgegeben von Marcel Herwegh, Manuskript in der Handschrift Emma Herweghs, Herwegh-Archiv, Liestal, S 119.
Die Flucht
Wir liefen während mehrerer Stunden bergauf, bergab, fortwährend verfolgt, bis wir endlich das kleine Dorf K. erreichten, das drei Stunden von Rheinfelden gelegen. – Viele der Unseren hatten dieselbe Richtung eingeschlagen wie wir, und kamen mit uns zugleich in K. an. Auf diejenigen, welche man nicht mit der Hand erreichen konnte, hatte man fortwährend abgefeuert, es war eben die vollständige Hetzjagd. Wir klopfen an die erste Bauernhütte, und flehen um ein Asyl, sei es auch noch so schlecht. Wenn Ihr ein Schälchen Café wollt, war die Antwort, das können wir Euch geben, denn Ihr seid gewiss durstig, aber beherbergen können wir Euch nicht, Ihr müsst halt ins Saatfeld gehen. Weiterlesen
Schöner Trost! Während wir wohl eine halbe Stunde mitten im Korn versteckt liegen, sprengt ein Schwadron Ulanen nach der andern immer dicht am Acker vorbei, um Herwegh ausfindig zu machen. „Wenn wir ihn finden, solls ihm schlecht gehen, an dem andern Lumpenpack ist uns nichts gelegen“, so fluchten diese rohen Schwaben vor sich hin. Nach einer Weile wird es still. Ich hebe den Kopf aus dem Korn, um die nächste Umgebung zu sondieren und um zu sehen, ob wir ohne Gefahr weiter wandern können – aber vor uns lag nichts als eine weite, heiße Ebene, so recht behaglich, und von allen Seiten von der Sonne beschienen, und eh wir die passiert und das ferne Gebirge erreicht hatten, konnten wir tausendmal in die Hände unsrer Feinde fallen. Wagen wir‘s dennoch, rief ich endlich Herwegh zu, sicher sind wir ja hier eben so wenig als irgendwo, und soweit ich sehen kann, ist nirgends ein Soldat.
Eben als wir das Feld verließen, sprang ein Bauer auf uns zu. Im ersten Augenblick glaubten wir uns verraten, aber er kam uns freundlich näher und bot uns ein Obdach in seinem Hause an. Wir folgten ihm so schnell als nur irgend möglich, aber mich trugen meine Füße kaum, und als wir seine Wohnung erreicht, sanken mir fast die Kniee zusammen. Sein Weib und seine Tochter empfingen uns schon auf der Schwelle und sannen nach, wie uns am besten zu helfen wäre.
Folgt mir auf den Boden, sagte endlich der Bauer, dessen Namen ich verschweige, um ihn als Dank für diesen unvergesslichen Dienst, nicht der Gefahr preiszugeben – und wechselt schnell Eure Kleider, und wenn das geschehen, schicke ich Euch beide ins Feld arbeiten, bis der Abend kommt und bessern Rat schafft. Der Mann holte für Herwegh, die Frau für mich alte Bauerkleider, und so wollten wir gerade die unsern abstreifen, als wir aus der Ferne Pferdegetrappel hörten. Das sind die Württemberger, schrie unser Wirt, wenn die Euch hier finden, sind wir alle verloren. Bleibt indes ruhig hier, ich will hinuntersteigen, und wenn Ihr mich mit vielem Lärm die Treppe heraufkommen und an der Bodentür schließen hört, so nehmt es als Zeichen, dass sie mir folgen, und sucht Euch schnell hinter den Fässern oder sonst wo zu verbergen.
Die Ulanen sprangen heran, umzingelten das Haus und riefen dem Bauer, der sie auf der Schwelle der Wohnung empfing, zu: „Wenn Ihr den Herwegh und sein verfluchtes Weib, dass ihm in Manneskleidern folgt, bei Euch versteckt, und wir finden sie, so werden sie auf der Stelle massakriert, und Euch zünden wir das Haus über dem Kopfe an.“
Eine herrliche Aussicht für uns, die wir jedes Wort hörten. Geräuschlos und schnell suchen wir uns hinter einigen Fässern, die in einem finstern Winkel aufgetürmt lagen, zu verschanzen, da zerbricht Herwegh im kritischen Moment, wo nur die lautloseste Stille uns Sicherheit bieten konnte, mit fürchterlichem Lärmen den Boden eines kleinen Fasses das vorgeschoben lag und er übersehen hatte, und wir geraten Beide trotz der verzweifelten Lage, in solches Lachen, dass ich noch heute nicht begreife, wie uns das nicht den Hals gekostet. Jetzt fing das Examen an, aber unser Bauer leugnet standhaft, und protestiert so energisch gegen den Verdacht, als werde er sich dazu hergeben, Rebellen zu retten, dass die Soldaten gläubig weiter reiten und ihm nur noch zurufen: „Wir kommen bald zurück, werden uns dann einquartieren und Haussuchung bei Euch halten.“ Durch diesen Aufschub gewannen wir die nötige Zeit zu unsrer Rettung. Herwegh ließ sich, um ganz unkenntlich zu werden, den Bart scheren und zog alte Bauernkleider an, ich fuhr ebenfalls in ein Paar abgetragene, zerrissene Lumpen hinein, und so erreichten wir – jeder eine Mistgabel auf der Schulter – glücklich das Feld.
Drei volle Stunden arbeiteten wir dort – Herwegh am einen, ich am andern Ende des Ackers. Währenddessen nahm das Schießen im fernen Wald kein Ende. Es galt den Fliehenden, die statt sich in großer Anzahl und bewaffnet zu retten, in kleinen Rotten, zu zweien, dreien flüchteten, sich stundenlang unter dem Laub versteckt hielten, dann wieder plötzlich von den Soldaten aufgescheucht, weiter gehetzt wurden. — Uns war‘s, als solle uns das Herz zerspringen, und doch war unsere Lage nicht besser, nicht sicherer als die der andern. Bei jedem Büchsenschuss fuhren wir auf und sahen uns schweigend an. Sprechen durften wir nicht miteinander, um bei den Bauersleuten der benachbarten Äcker nicht Verdacht zu erregen, oder die Augen der Kavallerie auf uns zu ziehen, die während des ganzen Nachmittags immer durch die Felder und dicht an uns vorbei sprengte, um, wie der württemberg. General D. später einem unserer gefangenen Freunde sagte: „die verfluchte Bestie, den Herwegh aufzufinden“. Die Freude sollte ihnen aber nicht werden. Nach Sonnenuntergang, als die Bauern heimzogen und es still um uns her wurde, trug uns unser guter Wirt Wein und Brot aufs Feld, hieß uns die Hauptstraße nach Rheinfelden langsam ihm folgen, die er mit einem leeren Wagen mit zwei Ochsen bespannt schnell voranfuhr.
Kaum hatten wir die Schwelle seines Hauses verlassen, als die verheißene Einquartierung wirklich angerückt war. Mit Entsetzen erzählte uns der Bauer, wie die Württemberger nicht den kleinsten Winkel undurchsucht gelassen, und selbst jedes Fass mit ihren Bajonetten durchstochen hätten. Was wär aus Euch geworden, und aus uns, fügte er hinzu, wenn Sie Euch dort gefunden? Darauf verließ er uns, und eine halbe Stunde später kam er uns mit seinem Wagen und in Begleitung eines anderen Mannes (den ich ebenfalls nicht nennen will) entgegen, der uns an dem Württembergischen Posten auf der Rheinfelderbrücke vorbeiführen sollte. Hätte man uns dort angehalten, so würde er uns für seine Taglöhner ausgegeben haben. Aber die Schwaben merkten nichts, obschon wir ihnen mit unseren Heugabeln dicht an der Nase vorbeizogen, und so erreichten wir glücklich das Schweizergebiet, auf dem eine große Zahl der Unseren schon viele Stunden vor uns ein sicheres Asyl gefunden hatten.
Mehrere waren bei Hüningen, andere auf Schiffen herübergekommen, wobei sich die württembergischen Soldaten noch nichtswürdig genug benommen hatten. Als das letzte Boot nämlich mit etwa zwölf Flüchtigen das freie Ufer glücklich erreicht hatte, und die Mannschaft schon ausgestiegen war, entdeckten die Soldaten die ihnen entgangene Beute. Und was taten sie? Nach echter Heldenart drückten sie, noch eh eine Sekunde verstrich, ihre scharfgeladenen Büchsen auf die unbewaffnete Schar ab, und ruhten nicht eher, bis wenigstens einer getroffen zu Boden sank. Glücklicherweise hatte die Kugel ihm nur den Schenkel gestreift, so dass er nach einigen Wochen wieder geheilt war. Wie steigerte sich ihre Wut, als sie wenige Tage später unsern Aufenthalt ausgekundschaftet hatten, erfahren mussten, dass ihnen der kostbarste Fang (denn 1000 Gulden sind für einen schwäbischen Soldaten eine Welt) so unwiederbringlich entgangen war. Um kein Mittel unversucht zu lassen, schickten sie einen der Offiziere nach Rheinfelden ab, um durch Bestechung zu erlangen, was ihrem Verstand nicht geglückt war – aber unser Wirt war ein guter Schweizer, der sich trotz der 2000 Gulden, die man ihm bot, wenn er sich dazu verstehen wolle, Herwegh und seine Frau bei Nacht hinüberschaffen zu helfen, zu keinem Schurkenstreich gebrauchen ließ. Mit Entrüstung wies er das Anerbieten des Offiziers zurück und dem Herrn selbst die Tür, der ihm im Fortgehen noch zurief: Hätten wir Herwegh gefangen, so wäre er ohne Verhör füsiliert worden und die Frau zeitlebens an Ketten gekommen!!!
Ich will mich hier aller weiteren Betrachtungen enthalten, aber wissen möchte ich wohl, wer besagtem Offizier diese außerordentliche Vollmacht erteilt! Übrigens wiederholten sich dergleichen Vorschläge, Herwegh gegen irgendeine bald größere, bald kleinere Summe auszuliefern, während der letzten Tage unseres Aufenthalts so häufig, dass unser Wirt selbst ängstlich, uns vielleicht nicht genügende Sicherheit bieten zu können, Herwegh riet, diesen Ort zu verlassen, an den uns ohnehin nichts mehr fesselte.
Für die Flüchtlinge war nach Kräften gesorgt – an ein gemeinsames Wirken im Moment war nicht zu denken, und so kehrten wir nach Frankreich zurück.
Möchte dies Exil kein langes sein!
Hiermit schließe ich meinen Bericht.
Der Leser mag entschuldigen, wenn ich seine Aufmerksamkeit und Geduld so lange in Anspruch genommen habe. Ich durfte jedoch keine, selbst die scheinbar geringfügigste Einzelheit übergehen, ohne mich nicht zugleich von dem Ziel zu entfernen, das ich mir, wie ich dies bereits im Vorwort ausgesprochen, gesteckt hatte: das größere Publikum über die wahren Intentionen der deutschen, demokratischen Legion zu unterrichten und den Verleumdungen, zu deren Hauptzielscheibe sich deutsche Patrioten Herwegh ausersehen, durch die ungeschminkte Wahrheit die einzig würdige, einzig vernichtende Waffe entgegenzusetzen. Für seine Freunde, für alle, die ihn nur einmal recht erkannt, bedürfte es keiner Ehrenerklärung, keines schriftlichen Dokuments. – Sein ganzes früheres Leben war ihnen der schlagendste Beweis für die Niederträchtigkeit seiner Ankläger, obschon ich es nicht verhehle, dass es mir ihrer selbst wegen lieb gewesen wäre, wenn Einer oder der Andere sich berufen gefühlt hätte, laut auszusprechen, wovon er innerlich – ich weiß es – unerschütterlich überzeugt geblieben. Für die sogenannten Freunde, zu denen ich alle diejenigen rechne, die, wenn auch leicht zu überreden, Herwegh dennoch lieber in der öffentlichen Meinung steigen als fallen sehen, weil sie mehr schwach als schlecht, mehr beschränkt als boshaft sind, hätte auch ein weniger detaillierter Bericht genügt, damit war meine Aufgabe aber noch keineswegs gelöst.
Ich konnte mich erst dann zufrieden stellen, wenn es mir gelungen war, dieser würdigen Schar liberaler und konservativer freiwilliger und bezahlter Schurken, die sich an jede reine, edle Natur wie Vampire beharrlich festklammern, bis sie ihr den letzten Lebenstropfen ausgesogen – ihr Opfer lebendig und unversehrt zu entreißen.
Hierzu bedurft es nur einer einfachen, treuen Erzählung des Erlebten, und die bis in die kleinsten Details geben zu können, war niemand befähigter als ich, die Herwegh vom Anfang bis zum Schluss der Expedition keinen Augenblick aus den Augen verloren und Zeuge jedes Wortes gewesen war, das er gesprochen hatte.
Sehr möglich, dass die Aussage dieses oder jenes Gefangenen in einzelnen Punkten von der meinigen abweichen wird. Nicht jeder Mensch kann wahr sein. Manchem versagt das Gedächtnis den Dienst, andern wieder spielt die Eitelkeit einen Streich, und diejenigen, die während ihres ganzen Lebens mit allem Industrie getrieben, werden ihr bisheriges Handwerk auch jetzt nicht verleugnen können und sich nicht scheuen, selbst ihr Märtyrertum auf Kosten derer auszubeuten, die nur dem glücklicheren Zufall ein besseres Los verdanken.
An räudigen Schafen hat es, davon bin ich nachträglich mehr als je überzeugt, auch in unserer Schar nicht gefehlt, eben so wenig an solchen, die zu gleicher Zeit den doppelten Lohn eines Kämpfers für und gegen die Freiheit bezogen haben. Wie wäre sonst – nämlich ohne den Verrat im eigenen Lager – das plötzliche Verschwinden mehrerer Chefs wenige Stunden vor dem Gefecht zu erklären, wie der zehnstündige Marsch für drei Stunden Wegs, und wie endlich die Annahme des Kampfes selbst, die bei einem ordentlichen, militärischen Kommando so leicht hätte vermieden werden können?
Aber dieser Kampf bei Dossenbach, den ich, wie ich die Sachen heute kenne, für einen im Plan der Intrige durch Verrat herbeigeführten ansehe, musste sein, wenn nicht jede Handhabe zu irgendeiner Verdächtigung Herweghs wegfallen sollte, jede Gelegenheit, ihn entweder physisch oder moralisch zu töten. Wäre ihm die Flucht auf neutrales Gebiet geglückt, die, scheuen wir uns nicht, das Kind beim Namen zu nennen, nicht erst nach dem Gefecht bei Niederdossenbach, sondern bereits anderthalb Tage zuvor anfing, als der einzige ehrenvolle Ausweg, der uns nach der Nachricht von der Niederlage unserer Freunde vor Freiburg übrigblieb — was hätte man Herwegh dann vorwerfen können? Vielleicht dass er weder eitel noch wahnsinnig genug gewesen, sich einzubilden, mit einer schlechtbewaffneten Schar von 650 Mann, die Republik in Baden gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen zu können, nachdem alle andern Freicorps bereits geschlagen waren. Oder dass er einen ehrenvollen Rückzug einem sinnlosen Kampf vorgezogen – sonst nichts. Und was wirft man ihm heute vor, nachdem er den vielfachen Verfolgungen nur durch ein Wunder entgangen ist — Feigheit! Und weshalb?
Erstens weil er aus reinem Ehrgefühl und in der Hoffnung, durch seine Gegenwart wenigstens dasjenige, was der guten Sache entgegensteht, abwenden zu können, alles auf die Karte gesetzt hatte, den ungeschicktesten Führern geduldig nachgefolgt war, die, ich sage es frei heraus, denn es ist meine feste Überzeugung, ihn während der ganzen Expedition nur als glänzendes Aushängeschild benutzen wollten.
Zweitens, weil er unbewaffnet war, und mit dem militärischen Kommando nichts zu tun hatte, wenigstens das Recht für sich in Anspruch nehmen zu dürfen glaubte, das man jedem General zuerkennt, ohne deshalb seinen Mut in Frage zu stellen, nämlich: sich nicht persönlich herumbalgen zu müssen. Fäuste waren es ja nicht, an denen es uns fehlte! Und endlich Drittens, weil ohne Herweghs Geistesgegenwart die Kämpfenden, mit denen er vom Anfang bis zum Schluss des Gefechtes einen regelmäßigen, ununterbrochenen Verkehr unterhielt (denn er hatte mit der ihm während des ganzen Zuges gegebenen Bedeckung, die Stellung wenige Schritte vom Kampfplatz unverrückt beibehalten) nicht einmal das wenige Pulver rechtzeitig bekommen hätten, das als einziger Reichtum auf meinem Wagen verpackt lag und an das keiner der Herren Chefs dachte. Bei dieser Gelegenheit will ich es nicht versäumen, den Herren Mitarbeitern und Redakteuren der verschiedenen gelehrten und ungelehrten Blätter, wie der deutschen Hofrats-, der Baseler und Karlsruher Zeitung (diese letzte hat sich hartnäckig geweigert, jeden berichtigenden Artikel, welcher von Seiten der Gefangenen an sie gesandt, aufzunehmen), meinen Dank auszusprechen, für die lobenswerte Bereitwilligkeit, mit welcher sie auf guten Glauben ohne den Schatten eines Beweises, denn woher könnten sie ihn haben, da keiner existiert, allem ihre Spalten geöffnet, was Herweghs guten Ruf schänden und, wenn es wahr gewesen, ihm mit vollem Recht jede Wirksamkeit in Deutschland hätte abschneiden müssen. Ob jene Herren Skribenten glauben, heute weniger verächtlich zu sein, wo sie, weil der Liberalismus allein rentiert, ihr Schergenamt mit dem Wahlspruch: „Alles für das Volk, Alles durch das Volk“ versehen, als gestern, wo sie Herwegh „Mit Gott für König und Vaterland“ wegen seines Radikalismus verfolgt haben?
Es gibt ein junges, demokratisches Deutschland! Ein Deutschland, das mit der alten Welt und ihren Sünden abgeschlossen hat, das nicht eher die Waffen niederlegen wird, bis Polen, bis Böhmen, bis Italien, bis ganz Europa frei, der letzte Kerker geöffnet, die letzte Kette gesprengt ist. Diesem Deutschland allein übergebe ich diese Schrift, denn dies allein hat eine Stätte für jede gute, freie Natur, dies allein ist im Stande, seine wahren Kinder von seinen Stiefkindern zu unterscheiden, und wird das schreiende Unrecht, was jenen geschieht, dereinst zu sühnen wissen. So viel Kämpfe ihm auch noch bevorstehen mögen, so viel seiner besten Kinder auch noch als Opfer des Despotismus fallen werden, ehe es Sieger bleibt – es weiß, dass es später oder früher siegen muss, und kann stolz mit jenem edlen Republikaner, den man hier vor einigen Tagen zu den Galeeren verdammte, ausrufen:
a moi l’avenir.
Vive la République démocratique
et sociale.
Es sieht düster aus, geehrte Frau, die Freiheit verhüllt ihr Haupt, und mich zieht es heimwärts, nach der Heimat, wohin ich mich seit 14 Jahren sehne, nach dem Westen Amerikas.
Dass die privilegierten Volksverräter in Frankfurt einen provisorischen Kaiser, aus dem Geschlechte, welches nur hervorbrachte, fabrizierten, einen Unverantwortlichen, an die Beschlüsse der Versammlung nicht gebundenen, dass man also die Reden und Taten des Wiener Kongresses, das ganze Lügen- und Komödienspiel von 1813/15 neu auflegte, das wissen Sie bereits. Weiterlesen
1 Nach der Niederlage in Kandern war Hecker zunächst in die Schweiz geflohen. Überall sonst in Europa drohte ihm die Verhaftung. Also beschloss er, in die USA zu emigrieren und setzte am 20. September 1847 von Le Havre aus nach New York über.
Aber dass in Ungarn und Österreich die Republikaner bei den Wahlen unterlegen sind, dass die Wiener Barrikadenhelden, dass der ganze Michel in lautem Hallo dem Reichsverweser (Fäulnis! Fäulnis!) zujubelt, dass unsere feuerspeienden „Manifeste“ und „Ansprachen an die deutsche Nation“ zwar mit Jubel beklatscht worden, aber dann die Patschhände in den Schoß fielen, dass mit einem Wort beim Volk der Geist zwar willig aber das Fleisch immer schwächer wird, das alles, was uns das Herz zerschneidet, das wissen Sie nicht; und es ist gut, dass Sie‘s nicht wissen. Wer nicht ein sich selbst betrügender Enthusiast oder ein kurzsichtiger Narr ist, der sieht es klar, dass Deutschland im besten Zuge ist, statt 34-mal 35-mal monarchisch zu werden. Unglückseliges Volk, armes Vaterland. Kommt nicht ein Anstoß von außen, ziehen nicht rote Hosen über den Rhein, so erhebt sich das Volk nicht. Eine große Zeit ist über ein kleines Geschlecht hingerauscht, und der Weltgeist schüttelt zürnend seine Schwingen und wendet den Blick ab von der verächtlichen Rasse.
Wenn es wahr ist, was man sagt, dass nämlich der reichsverwesende „Hannes“, „nur unter Verantwortlichkeit annehme“ (also liberaler tut als die Schwätzer), wenn er ferner pfiffig genug wäre, zu erklären, dass er während seiner (provisorischen) Wirksamkeit (Wirksamkeit scheint eigentlich Würgsamkeit geschrieben werden zu müssen) keine Zivilliste beziehen wollte, und lässt er gar noch eine Amnestie vom Stapel, dann sollen Sie sehen, wie der linke und der rechte Michel in überschwänglicher Rührung sich zusammenschneuzen und alles zusammenschmilzt bis auf den Bauch, der als christlich-germanisches Grundstock-Vermögen übrigbleiben muss. Es ist eigentlich traurig, Kassandra in Hosen zu sein, allein ich habe so manches richtig vorausgesehen, und mache mir keine Illusionen mehr.
Grüßen Sie Herwegh und sagen Sie ihm, dass wenn das Spätjahr noch das Volk von heute findet, er nichts Besseres tun kann, als mit den Choctaws, Comanches, Sacs- und For-Indianern Büffel jagen, und das Glück zu genießen, die Zivilisation gründlich loszuwerden; ich gehe mit. Nun leben Sie wohl und bedenken Sie, dass es in schlechten Zeiten zwei Schätze gibt, die uns alles bevölkern, der Zweifel an allem (die Negation) und die Fantasie (die Position).
Ihr Hecker.
Hecker ist diesen Morgen vermutlich unter Segel gegangen, begleitet von seiner ganzen Familie, Gritzner1 (dem Alten), Wesendonck und einer Menge anderer Flüchtlinge. Ich hätte ihn gern nur auf eine Stunde gesprochen, und, wenn es von meinem Willen abgehangen, die Reise nach Havre deshalb gemacht. Da das nicht möglich war, hab‘ ich ihm ein schriftliches Lebewohl gesagt, das dicht vor der Einschiffung noch in seine Hände gelangt sein muss, und hab‘ als Vertreter für Dich bei ihm, und als Beweis, dass er in den Herzen der Besten fortlebt, ihm Deine beiden Gedichte beigelegt, leider ohne den Schluss. Ich glaubte ihm eine freudige Genugtuung dadurch zu geben für die vielen bitteren Enttäuschungen des letzten Jahres und auch in deinem Sinne zu handeln. Ein Brief von ihm, den er an den alten Gritzner von Havre aus geschrieben und in dem er ihn zur Mitfahrt auffordert, war ein sprechendes und schmerzliches Bild der Eindrücke, welche die letzten Tage und vor allem der Umgang mit den Demokraten in ihm aufgefrischt hat. – Er ist voll von Schmerz und Zorn und sagt unter anderem: ich sehne mich in mein mühevolles Leben zurück und will das letzte Kleid, an dem noch der Staub dieser wirklich sehr alten Welt klebt, in den Ozean werfen. – Dann in Betreff der Demokraten, mit denen er in Straßburg zusammengetroffen, sagt er: „Da hört ich nichts als Verräter, Spion, schlechter Kerl, Hundsfott, und das macht, wenn nicht menschenfeindlich, doch menschenscheu.“ Mit Entzücken schreibt er dann weiter von seiner Frau, von seinem herrlichen Weib, das nur mit Mühe dem Gefängnis entgangen, in das sie zu führen, der Befehl schon in den Händen des bayrischen Offiziers war. Weiterlesen
1 Maximilian Gritzner, Beteiligter am Wiener Aufstand.
2 Johannes Ronge, katholischer Priester, gilt als Begründer des „Deutschkatholizismus“. Er nahm 1848 am Frankfurter Vorparlament teil und zählte dort zum radikal-demokratischen Flügel.
So viel von Hecker – nun ein Wort von Häfner, dem Redakteur des Konstitutionellen in Wien, der bei der Dresdner Geschichte die rechte Hand von Bakunin gewesen ist, und mir mit Bestimmtheit versichert hat, dass an ein Ausliefern nicht zu denken. Vor der Hand ist Bakunin in Dresden und wird zu mehrjähriger Zuchthausstrafe verdammt werden, die aber für ihn nur pro forma existiert. Er wird eben einer Kommission für Strafarbeit überwiesen, die mit ihm sehr gelinde umgehen, und wo er alle möglichen Freiheiten innerhalb des Gefängnisses genießen wird.
Dieser Häfner hat mir noch allerhand Lustiges erzählt, wie der Bürgermeister Bakunin gebeten, die Häuser zu verschonen, und dieser ruhig und Zigarren stopfend ihm geantwortet: „Was da, die Häuser sind jetzt nur vorhanden, um niedergebrannt zu werden.“
Ronge2) ist dieser Tage auch bei mir gewesen und wird Dich vermutlich in der Schweiz treffen, wohin er gestern abgereist ist, um mit Karl Fröbel eine Hochschule für Frauen zu deren Emanzipation zu errichten. Ein kleiner Mann, untersetzt, mit etwas schiefer, ausgerenkter, rechter Hüfte, glattem gutgeschnittenem, sehr gewöhnlichem Gesicht, wohlgepflegtem Bart, kurzen fetten Händen mit geschmacklosen Ringen besetzt, ohne Geist und mit vieler Bonhomie. Ich fragte ihn, was er mit diesen Frauenvereinen bezwecke und brachte ihn durch meinen Humor, mit dem ich die Sache aufnahm, dermaßen aus dem Text, dass ich‘s ihm unmöglich machte, seinen Ernst zu behaupten. Die soziale und religiöse Frage soll durch diese Vereine praktisch verschmolzen ins Leben treten, durch die höhere Erziehung der Frauen auf die Elementarschulen armer Kinder, ferner auf die Mägde gewirkt werden und durch diese dann wieder zurück auf die Kinder u.s.w. u.s.w. Bis dahin, sagte er, gab‘s in Deutschland nur zweierlei Frauen: Köchinnen und … Hier stockte er; ich half ihm weiter, indem ich das Wort „Kurtisanen“ aussprach und hinzufügte: Herr Ronge, Sie können ganz frei sprechen, es gibt ja nichts, was sich natürlich gesagt nicht vor und mit unbefangenen Menschen besprechen ließe. – Also Kurtisanen und Köchinnen: Nun, was soll geschehen? „Sehen Sie, Frau Herwegh, durch diese Hochschulen soll nun“ — „ach, ich verstehe“, fiel ich ihm in‘s Wort, „soll dies vermittelt werden, dass ferner alle Köchinnen Kurtisanen werden, und alle Kurtisanen kochen können, was allerdings sehr zweckmäßig wäre.“ – Mit all diesem Zeug, denn welcher ehrliche Mensch kann heutzutage solchen Unsinn ernst behandeln, hatte ich unsern sozialen Beichtiger dermaßen aus dem Text gebracht, dass er selbst in lautes Gelächter ausbrach und sich mit dem festen Bewusstsein entfernte, an mir keinen Adepten gewonnen zu haben. „Die Liebe“, Herr Ronge“, hatt‘ ich ihm auch gesagt, „ist der einzige Hebel zur Emanzipation der Frau; wen die nicht befreit, dem werden Sie nicht helfen, Herr Ronge“ – dadurch hatt‘ ich ihn ganz gewonnen. „Da haben wir’s ja“, erwiderte er enchantiert, „da ist‘s ja ausgesprochen“, und so hatt‘ ich ihn so weit gebracht, mich in die Mysterien seines großartigen Planes einzuweihen, und schon glaubte er, mich bekehrt zu haben, als ich ihm sagte: Ja, Sie können doch aber nicht hoffen, die 11000 heiligen Jungfrauen durch die Liebe zu bekehren? „Lachen Sie nur, Frau Herwegh, ich lasse mich nicht irre machen; an meinen Früchten sollt Ihr mich erkennen.“ Ich wünschte ihm Glück und wir schieden. Im Oktober will er hier zurückkehren, um auf die französischen Frauen zu wirken. Er versteht nämlich keine Silbe französisch!
Zur Geschichte der deutschen demokratischen Legion au Paris. Von einer Hochverräterin, Druck und Verlag von W. Levysohn, Grünberg 1849.
Briefe von und an Georg Herwegh, herausgegeben von Marcel Herwegh, Albert Langen’s Verlag, München 1898.
Es leben die demokratische Republik. Mit einem Vorwort von Elke Heidenreich, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023.
Michael Krausnick: EMMA – Herweghs verfluchtes Weib: Nicht Magd mit den Knechten, CreateSpace Independent Publishing Platform 2015.
Dirk Kurbjuweit: Die Freiheit der Emma Herwegh. Roman, Karl Hanser Verlag, München 2017.
EMMA HERWEGH

Abb.: DISTL – Dichter:innen und Stadtmuseum , Fotograf Andreas Zimmermann
Als einzige Frau an der Seite von 850 Freiheitskämpfern zieht die dreißigjährige Emma Herwegh im Frühjahr 1848 in den Kampf. Die in Paris von Exilanten gegründete „Deutsche Demokratische Gesellschaft“, zu deren politischem Präsidenten ihr Mann, Georg Herwegh, gewählt wurde, hatte eine „Legion“ gegründet und marschiert über Straßburg nach Deutschland, um den badischen Aufständischen um Friedrich Hecker zur Hilfe zu eilen und im Großherzogtum Baden – wie es kurz zuvor, im Februar 1848, in Paris geschehen war – die demokratische Republik auszurufen.
Das Unternehmen scheitert in einer vernichtenden Niederlage im Rheintal bei Dossenbach, in Sichtweite der Schweizer Alpen. Emma und Georg Herwegh können knapp entkommen, müssen jedoch – als nunmehr steckbrieflich gesuchte „Verräter“ – wie schon die Jahre zuvor als politisch Verbannte im Exil verbringen. Von dort aus kämpfen sie „blitzeschleudernd“ weiter, mit Wort und Tat, für ein freiheitliches und demokratisches Deutschland und Europa.
Emma Charlotte Siegmund wird am 10. Mai 1817 als Tochter einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie in Berlin geboren und verbringt dort eine „großbürgerlich“ unbeschwerte Kindheit.
Im November 1841 lernt sie den Dichter und Revolutionär Georg Herwegh kennen, der auf einer vielumjubelten Lesereise durch die deutschen Länder auch in Berlin Station macht. Nur eine Woche später gibt das Paar seine Verlobung bekannt.
Nachdem Georgs Texte auf den Index geraten und er aus Preußen und Sachsen ausgewiesen wird, weicht er in die Schweiz aus, wo das Paar im Februar 1843 heiratet. Noch im gleichen Jahr siedeln die Herweghs nach Paris über und beziehen eine Wohnung in unmittelbarer Nachbarschaft zu den befreundeten und ebenfalls gerade frisch verheirateten Karl und Jenny Marx.
Während der Revolution von 1848/49 unterstützt Emma ihren Mann aktiv und zieht mit ihm und einem „Freiheitsheer“ aus deutschen Exilanten in Paris nach Baden, um sich dem dortigen demokratischen Aufstand anzuschließen.
Nach dem Scheitern der Revolution flüchtet das Paar ins Exil in die Schweiz, wo Emma und Georg ihre politischen Aktivitäten fortsetzen.
Eine Amnestie erlaubt allen politisch Verbannten die Rückkehr nach Deutschland. Die Herweghs lassen sich in Baden-Baden nieder.
Georg stirbt im Alter von nur 58 Jahren an einer Lungenentzündung. Emma lässt ihn, auf seinen Wunsch hin, in der Schweiz, in „republikanischer Erde“, begraben.
Mit 87 Jahren stirbt Emma Herwegh in Parin, wo sie ihren Lebensabend verbracht hat. Ihrem Wunsch gemäß wird sie an der Seite ihres Mannes im Schweizer Liestal beigesetzt.
Vorwort von Elke Heidenreich
Der erste Eindruck, wenn man ihre Schriften und Briefe liest: Was für eine fabelhafte Person! Wie kühn, wie leidenschaftlich, wie unbestechlich, wie klug, wie emanzipiert! Und dann liest man weiter und liest auch über sie und wird skeptischer: Wie besessen! Wie anstrengend! Wie starrsinnig!
Was denn nun? Soll man für Emma Herwegh schwärmen, soll man sie verdammen, oder liegt es irgendwo in der Mitte? „Emma – Herweghs verfluchtes Weib“ nennt Michail Krausnick eine Schrift über sie und zitiert damit einen württembergischen Soldaten, der Emma auf der Flucht verfolgt hatte. „Die Freiheit der Emma Herwegh“ heißt Dirk Kurbjuweits Roman. Sie beschäftigt die Gemüter.
Ich habe siebzehn Jahre in Baden-Baden gewohnt, wo auch die Herweghs ab 1866 im Stadtteil Lichtenthal gelebt haben und wo Herwegh 1875 starb. In dieser Stadt war ihr Andenken immer lebendig, und lange glaubte ich, die irritierend erschütternden Zeilen seien von ihr: Weiterlesen
Was für eine Frau, dachte ich, und weiß jetzt: Es sind Verse ihres Mannes Georg Herwegh, dem und dessen politischen Ideen sie quasi ihr ganzes Leben gewidmet hat, ihr Leben und ihre Kraft, von der sie offensichtlich mehr hatte als er, der Poet und Revolutionär. Wäre er auch ohne Emma so weit gegangen, wie er ging, hätte er ohne sie so viel Verfolgung, so viel Exil auf sich genommen, so wenig künstlerische Entfaltung erfahren, er, der doch eigentlich Dichter war, wenn auch mit einem flammenden Herzen für die noch zu erkämpfende Demokratie? Hätte er ohne Emma auch so leidenschaftlich weitergemacht?
Auch Emma hätte ein anderes Leben haben können als das unruhige an der Seite eines Revolutionärs. Aber es scheint, als habe sie ein Leben auf der Flucht, mit lauter Männern, zu Pferde, Pistolen im Hafter, illegal über Grenzen, geradezu geliebt. Wie hat das alles angefangen?
Sie kommt als Emma Siegmund, geboren im Mai 1817, aus reichem, bürgerlichem Haus. Der Vater ist Hoflieferant für feine Seide und andere Stoffe, hat ein Modewarengeschäft in Berlin, ein großes prächtiges Haus in der Nähe des Schlosses. Man hat Geld, Bildung, Kontakte in Salons. Emma lernt Sprachen, kennt sich in der Literatur aus, sie zeichnet, sie komponiert, sie reitet und schwimmt nachts im See, benimmt sich überhaupt oft unerhört und nicht wie eine Dame aus bester Gesellschaft: Konflikte mit der Mutter sind vorprogrammiert. Sie schreibt Tagebuch, sowohl leidenschaftlich, was die Sehnsucht nach einem anderen Leben, als auch gelangweilt, was eben das tägliche Bürgerleben betrifft. Sie teilt ordentlich aus, nennt die Männer in ihrer Umgebung „Beamtenseelen, Menschenware, niederträchtige Gesellschaft, Schufte, Philister, liberales Pack, Schöngeister, Windbeutel, Esel, entmarkte Gesellen, Höflinge, Speichellecker“. Heiratsanträge lehnt sie durchweg ab. Ohnehin wäre sie viel lieber ein Mann und schreibt in ihr Mädchentagebuch: „Es gibt Stunden, Tage, wo ich alles hingeben möchte, ein Mann zu sein. Alles, damit ich so auftreten könnte, wie’s die innere Stimme mich heischt und der Frauenrock mir verbietet.“
In ihre Jungmädchenzeit fallen die französische Juli-Revolution von 1830, nach der König Karl X. abdankte und ins britische Exil flüchtete, der Novemberaufstand in Polen für nationale Einheit und Unabhängigkeit und das Hambacher Fest 1832, auf dem Demokratie, Freiheit und eine vereinte deutsche Nation gefordert wurden, die es nicht gab. Der Funke glomm, in ganz Europa.
Emma ist begeistert von den Freiheitskämpfen der Polen, hat und unterstützt Freunde dort, verachtet den russischen Zaren und den preußischen König, und in ihrem Tagebuch schreibt sie 1841: „Wie aber, wenn eine Zeit käme, wo jeder Mensch königlich dächte, wo die Gesamtbildung eine so allgewaltige wäre, dass der Mensch im Andern nur den Bruder sähe, wo nur Verdienste anerkannt würden, wo der Geist des Göttlichen sich in jeder Brust offenbart hätte; bedürfte es dann jener Könige noch?“
Sie sehnt sich nach Veränderung, aber mehr noch: nach Liebe. Und die junge Emma, nun schon 25 Jahre alt und fast übers Heiratsalter hinaus, wartet. Worauf? Sie weiß es selber nicht. Auf ein Ereignis, auf einen frischen Wind, auf die große Liebe. Und dann liest sie die Gedichte des jungen Georg Herwegh, „Gedichte eines Lebendigen“, und da sind sie, diese Zeilen:
„Wir haben lang genug geliebt,
und wollen endlich hassen.“
Das ist es! Sie soll ausgerufen haben: „Das ist die Antwort auf meine Seele!“ Raus aus dem sanften behüteten Bürgerleben, rein ins Abenteuer einer anderen Welt, einer anderen Denkart! Sofort verliebt sie sich in den Schreiber dieser Zeilen, will ihn kennenlernen, lernt ihn kennen, ihn, der eine Art Popstar auf Lesereise ist: Am 6. November 1842 kommt er auf ihre Initiative in ihr Elternaus in Berlin, und die Verlobung passiert genau sieben Tage danach, am 13 November. Es heißt, sie sei diejenige gewesen, die den Antrag gestellt habe. Denkbar ist es. Denn die traditionelle Frauenrolle und die Zurückhaltung der Frau galten für Emma Siegmund so wenig wie dann für Emma Herwegh. Sie war emanzipiert, ehe es diesen Gedanken überhaupt gab. Ihre feste Überzeugung: Eine Frau ist in nichts weniger wert als ein Mann. Herwegh schrieb nach der Begegnung mit ihr an einen Freund: „Das Mädchen ist noch rabiater als ich und ein Republikaner von der ersten Sorte.“ Das zeigt sich in einem Brief Emmas an ihn, kurz nach der Verlobung, im Dezember 1842, wo sie schreibt: „Wir wollen vereint Blitze in die Welt schleudern, ach, und ich will ihnen beweisen, was eine Frau tun kann, wenn sie ihr eigen Ich beiseite setzt.“ Und ab jetzt gerät Emma in einen Liebes- und Lebensstrudel, der nicht mehr abreißt.
Die Umstände ihrer Hochzeit im Februar 1843 (der russische Anarchist Bakunin fungierte als Trauzeuge) sind abenteuerlich, alles ist abenteuerlich an diesem Leben, und man fragt sich, wie diese Frau überhaupt die drei Kinder Horace, Camille und Marcel bekommen und aufziehen konnte, bei den dauernden Ortswechseln, den strapaziösen Reisen mit einem Haufen schlecht ausgerüsteter, gesuchter und verfolgter Revolutionäre, immer sie vorneweg als einzige Frau, ein Leben für Georg, gegen den König, für die Revolution, in wechselnden, immer elender werdenden Wohnungen, auf Gewaltmärschen, mit Krankheit und Verfolgung. Und sogar ihren Witz verliert sie dabei nie und schreibt einmal an ihren Mann: „Im Übrigen ist die Erde rund, und wenn man so sukzessive von einem Ort zum andern ausgewiesen wird, so muss man endlich doch wieder nach Hause kommen.“
Georg macht manchmal schlapp, Emma nie. Alexander Herzen schreibt in seinen Erinnerungen „Mein Leben“: „Sie war in ihrer Art nicht dumm und verfügte über weit mehr Kräfte und Energie als er.“ Schweizer Zeitungen berichteten, Emma spränge auf Wirtshaustische, rauche Zigarren und hielte flammende Reden.
Und flammend ist ja auch die hier vorliegende Schrift, auf deren Titel sie nicht ihren Namen nennt, sondern als Autorin angibt: „Von einer Hochverräterin.“ Denn als solche wurde sie mittlerweile streckbrieflich gesucht. Es ist eine Trotz-Schrift über den misslungenen Feldzug demokratischer Freiheitskämpfer von Paris nach Deutschland, ein Misslingen, für das Herweghs „Deutsche Demokratische Gesellschaft“ selbst nichts konnte. Da kam vieles zusammen, und Emma wollte klarstellen, was.
Es gab Vorwürfe gegen ihren Mann, er sei feige gewesen und verantwortungslos und habe die Legion ins Scheitern geführt. Emma schreibt: „Herwegh hatte bei allem, was er getan, nie einen persönlichen Zweck, nie etwas anderes als das eine, große Ziel: die Freiheit aller vor Augen gehabt, und diesem sich zu nähern sorglos seinen Weg verfolgt, unbekümmert um das Lob oder den Tadel, der ihn treffen könnte.“
Schon seinetwegen musste sie diese flammende Rechtfertigungsschrift einer Republikanerin unter die Leute bringen, was nicht ganz einfach war. Der Aufsatz sollte zunächst bei Zacharias Carl Löwenthal in Frankfurt erscheinen, aber der will es nicht drucken, weil zu viele Schmähungen gegen einen seiner persönlichen Freunde darin seien. Auch die vielen Majestätsbeleidigungen machen es nicht leicht, einen Verleger zu finden – schließlich wird einiges gestrichen und die Schrift kann 1849 erscheinen, bei Arthur Levysohn in Grünberg, Schlesien, und: Sie wird sofort verboten. Wenn man den Text heute liest, ahnt man, welche Strapazen die Verfasserin auf sich genommen hat, wieviel Mut und Überzeugung es sie gekostet haben mag, an diesem gefährlichen Zug der Kämpfer für die Demokratie durch feindlich gesonnenes Land teilgenommen zu haben. Das tapfere Häuflein der Freiheitskämpfer war nicht nur durch Polizei und Soldaten bedroht, sondern zermürbt durch tagelange Gewaltmärsche in Schnee, Regen, Matsch, auf Geröllpfaden, hungernd, verzweifelt. Emma muss als eine Art Anführerin immer wieder Mut gemacht und angetrieben haben – mit unvorstellbarer Energie und Disziplin. Das ist zu bewundern. Es gab durchaus auch andere Frauen, die in dieser Zeit Vorkämpferinnen für Emanzipation und Demokratie wurden, zum Beispiel die Schriftstellerin Fanny Lewald, die Frauenrechtlerin Louise Aston, die dichtete: „Freiem Leben, freiem Lieben / bin ich immer treu geblieben“, oder Louise Otto, die den Allgemeinen Deutschen Frauenverein gründete. Aber keine personifizierte sich mit der Sache der politischen Revolution so bedingungslos wie Emma Herwegh.
Und es fällt auch auf, dass sie nie national, sondern immer europäisch denkt – die Demokratie ist ihr ein „großes, weltbefreundendes Ereignis“, sie will sie nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Aber sie muss auch starrköpfig gewesen sein und nicht eingesehen haben, wann die Sache verloren war. Am Ende ging es nur noch darum, das Leben zu retten, das eigene und das einiger hundert Männer. Genau besehen ist ihre Schrift, durch die ein frischer, zorniger Wind weht, der Versuch einer Rechtfertigung für ihren Mann Georg Herwegh und sein Scheitern. Und dabei mag die Liebe zu ihm eine sehr viel geringere Rolle gespielt haben als ihr unverbrüchlicher Glaube an die Idee der Revolution. Denn schon 1843, noch vor der Hochzeit, hatte sie in einem Brief an Herwegh geschrieben: „Was die Leute Liebe nennen, ist mir lächerlicher, skizzenhafter Seelenkitzel. Man sieht ja, was daraus wird, Kinder höchstens, für die Menschheit aber nichts, keine Tat, keine Selbstverleugnung, nichts als eitle Sichwiederspiegelung des jämmerlichen Subjekts, was man nicht gering genug anschlagen kann, wenn es gilt, Opfer zu bringen in rechtem Sinne des Wortes.“ Andererseits, in einem Brief nur zwei Wochen später: „Nur in der Liebe fühle ich mich ganz fertig und gestählt zu Größtem.“
Dirk Kurbjuweit lässt sie in seinem Roman „Die Freiheit der Emma Herwegh“ dem jungen Frank Wedekind in ihrer Dachkammer in Paris ihr Leben erzählen und sagen: „Was meinen Sie, was eine Frau tun musste, die in der Politik wirken wollte? (..) Sie musste den richtigen Mann heiraten, das war damals so, nur über die Liebe konnte man sich emanzipieren, und jetzt ist es nicht viel anders. Ich konnte politisch wirken, weil ich einen politischen Mann hatte.“ Ein Romantext, aber vielleicht sehr nah an der Wahrheit, und die Gespräche mit dem jungen Wedekind gab es ja tatsächlich. Und sie erzählt Wedekind auch, sie sei recht apart, aber nicht besonders schön gewesen: Sie habe seidenweiches Haar gehabt, ideale Lippen, eine schmale Stirn, eine feine Nase, aber alles habe nicht so ganz zueinander gepasst. In ihrer Ehe mit Georg gab es Betrug (vermutlich auf beiden Seiten), Eifersucht, sogar eine zeitweise Trennung, ehe man wieder zueinander fand, aber es gab niemals Zweifel an der gemeinsamen politischen Mission und am festen Glauben an die Revolution für die Demokratie.
Mut und Leidenschaft sind dieser Frau nicht abzusprechen, Augenmaß mitunter schon. Alexander Herzen, anfangs Freund und Mitkämpfer, später Gegner (unter anderem auch wegen der heftigen Affäre, die Georg Herwegh mit Herzens Frau hatte!), schreibt in seinen Erinnerungen:
„Die äußerlich veranlagte, bewegliche Emma hatte nicht das Bedürfnis nach intensiver innerlicher Arbeit, die offensichtlich nur Schmerzen verursachte. Sie gehörte zu jenen unkomplizierten Zweitakt-Naturen, die mit ihrem Entweder-Oder jeden gordischen Knoten, ganz gleich ob von links oder von rechts, zerhauen, nur um irgendwie davon loszukommen und aufs neue weiterzueilen – wohin? Das wissen sie selber nicht.“
Vielleicht. Aber Emma Herwegh war und blieb radikal, auch die deutsche Einigung unter preußischer Führung 1871 konnte sie nicht beeindrucken. In ihrer Schrift heißt es: „Es wird eine ewige Schmach in der Geschichte bleiben, dass sich in jenen Tagen, wie das Heil der ganzen Menschheit an dem einen Wort ‚Republik‘ hing, kein Mann gefunden, der genug Kopf und Herz besessen hätte, dieses eine Wort zu sagen.“
In ihrer Republik gab es keine Könige oder Kaiser. Ihr Leben lang erfüllte sie die selbstgewählte Rolle als Gefährtin und Mitstreiterin eines revolutionären Helden. Barbara Rettenmund und Jeanette Voirol kratzen an diesem Bild und schreiben in ihrem Buch über Emma Herwegh: „Bei genauerer Betrachtung finden wir jedoch weder Held noch Gefährtin.“
Ja, vieles an Emmas Rigorosität mag irritieren. Aber gilt nicht noch heute, was sie in dieser Schrift so formuliert, als käme frischer Wind zu einem gerade geöffneten Fenster herein? „Dass zu einer neuen Welt vor allem neuer Stoff gehört, neue breite Weltanschauungen, Urmenschen, wenn man sich so ausdrücken darf, um den alten Egoismus, der alten Torheit und zivilisierten Barbarei dem Wesen, nicht nur dem Schein nach den Garaus zu machen – daran denken die Wenigsten, geschweige, dass sie fähig oder Willens wären, sich selbst mit umzuschaffen – und ohne das gehts nicht ehrlich vorwärts.“
Als Georg Herwegh 1875 starb, ließ sie ihn in der Schweiz begraben, in freier Erde, und dort liegt sie auch. Sie überlebte ihn um fast 30 Jahre.
Und sie ist ihren demokratischen Idealen bis an ihr Lebensende im März 1904 in Paris treu geblieben. Erlebt hat sie die Demokratie nicht mehr, es gab in Deutschland noch immer einen Kaiser, und abgesehen vom kurzen Zwischenspiel der Weimarer Republik wurde erst rund hundert Jahre nach den Ereignissen des Jahres 1848 die Demokratie in Deutschland verfassungsmäßige Wirklichkeit: nämlich 1949. Und wir wissen, dass sie noch immer nicht selbstverständlich, dass sie erschütterbar ist, dass sie immer aufs Neue verteidigt werden muss. Schon Georg Herwegh schrieb in einem Resümee der damaligen Ereignisse: „Ohne Republik keine schöpferische Entwicklung des Volkes, ohne Republik kein Wohlstand des Volkes, ohne Republik keine Einheitskraft im Innern und nach Außen, ohne Republik keine Freiheit und keine Freiheit für die Dauer.“
In einem brüchig gewordenen und gefährdeten Europa gelten diese Worte wie eh und je.
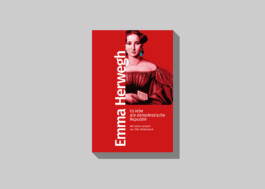
Emma Herwegh
Es lebe die demokratische Republik
Erschienen am 09.02.2023
Taschenbuch mit Klappen, 176 Seiten
€ (D) 14,– / € (A) 14,40
ISBN 978-3-462-50001-1
Es geht mir mit Deiner Prosa wie mit Deinen Versen, sie sind mir beide der Schlüssel zu meiner eigenen Natur, und tausend Dinge, die noch unbewusst in mir lagen, weckt der heimatliche Klang Deiner Stimme gleich gereift ins Leben. (…), wir bedürfen beide einander durch und durch, und keine Macht soll uns um eine Faser der Seligkeit betrügen, die uns miteinander, und in der Tatkraft durcheinander, werden muss. Schleud're Deine Blitze, denke an nichts, als an das eine, Dein Mädchen liebt die Gewitter, wenn sie rechter Art sind, und wird mitten in dem Feuer nur noch gestählter werden. Du liebst Deutschland, das weiß ich, wie entrüstet Du auch sein magst, oder vielmehr Deine Entrüstung zeigt es – nur was wir lieben, kann uns zur Verzweiflung bringen. Bin ich nur erst mit Dir, mich dünkt, ich könnte die Welt dann erobern, unsere Liebe scheint mir alles möglich machen zu können. (…) Sei auf nichts stolz, als auf Deines Mädchens Liebe, darauf aber kannst Du nicht stolz genug sein, und auf ihre Gesinnung, was Eins ist. Freiheit, Liebe, trenn' es, wer es kann, bei mir ist's Eins.
(Brief von Emma an Georg Herwegh, in: Brautbriefe, herausgegeben von Marcel Herwegh, Manuskript in der Handschrift Emma Herweghs, Herwegh-Archiv, Liestal, S 119.
Die Flucht
Wir liefen während mehrerer Stunden bergauf, bergab, fortwährend verfolgt, bis wir endlich das kleine Dorf K. erreichten, das drei Stunden von Rheinfelden gelegen. – Viele der Unseren hatten dieselbe Richtung eingeschlagen wie wir, und kamen mit uns zugleich in K. an. Auf diejenigen, welche man nicht mit der Hand erreichen konnte, hatte man fortwährend abgefeuert, es war eben die vollständige Hetzjagd. Wir klopfen an die erste Bauernhütte, und flehen um ein Asyl, sei es auch noch so schlecht. Wenn Ihr ein Schälchen Café wollt, war die Antwort, das können wir Euch geben, denn Ihr seid gewiss durstig, aber beherbergen können wir Euch nicht, Ihr müsst halt ins Saatfeld gehen. Weiterlesen
Schöner Trost! Während wir wohl eine halbe Stunde mitten im Korn versteckt liegen, sprengt ein Schwadron Ulanen nach der andern immer dicht am Acker vorbei, um Herwegh ausfindig zu machen. „Wenn wir ihn finden, solls ihm schlecht gehen, an dem andern Lumpenpack ist uns nichts gelegen“, so fluchten diese rohen Schwaben vor sich hin. Nach einer Weile wird es still. Ich hebe den Kopf aus dem Korn, um die nächste Umgebung zu sondieren und um zu sehen, ob wir ohne Gefahr weiter wandern können – aber vor uns lag nichts als eine weite, heiße Ebene, so recht behaglich, und von allen Seiten von der Sonne beschienen, und eh wir die passiert und das ferne Gebirge erreicht hatten, konnten wir tausendmal in die Hände unsrer Feinde fallen. Wagen wir‘s dennoch, rief ich endlich Herwegh zu, sicher sind wir ja hier eben so wenig als irgendwo, und soweit ich sehen kann, ist nirgends ein Soldat.
Eben als wir das Feld verließen, sprang ein Bauer auf uns zu. Im ersten Augenblick glaubten wir uns verraten, aber er kam uns freundlich näher und bot uns ein Obdach in seinem Hause an. Wir folgten ihm so schnell als nur irgend möglich, aber mich trugen meine Füße kaum, und als wir seine Wohnung erreicht, sanken mir fast die Kniee zusammen. Sein Weib und seine Tochter empfingen uns schon auf der Schwelle und sannen nach, wie uns am besten zu helfen wäre.
Folgt mir auf den Boden, sagte endlich der Bauer, dessen Namen ich verschweige, um ihn als Dank für diesen unvergesslichen Dienst, nicht der Gefahr preiszugeben – und wechselt schnell Eure Kleider, und wenn das geschehen, schicke ich Euch beide ins Feld arbeiten, bis der Abend kommt und bessern Rat schafft. Der Mann holte für Herwegh, die Frau für mich alte Bauerkleider, und so wollten wir gerade die unsern abstreifen, als wir aus der Ferne Pferdegetrappel hörten. Das sind die Württemberger, schrie unser Wirt, wenn die Euch hier finden, sind wir alle verloren. Bleibt indes ruhig hier, ich will hinuntersteigen, und wenn Ihr mich mit vielem Lärm die Treppe heraufkommen und an der Bodentür schließen hört, so nehmt es als Zeichen, dass sie mir folgen, und sucht Euch schnell hinter den Fässern oder sonst wo zu verbergen.
Die Ulanen sprangen heran, umzingelten das Haus und riefen dem Bauer, der sie auf der Schwelle der Wohnung empfing, zu: „Wenn Ihr den Herwegh und sein verfluchtes Weib, dass ihm in Manneskleidern folgt, bei Euch versteckt, und wir finden sie, so werden sie auf der Stelle massakriert, und Euch zünden wir das Haus über dem Kopfe an.“
Eine herrliche Aussicht für uns, die wir jedes Wort hörten. Geräuschlos und schnell suchen wir uns hinter einigen Fässern, die in einem finstern Winkel aufgetürmt lagen, zu verschanzen, da zerbricht Herwegh im kritischen Moment, wo nur die lautloseste Stille uns Sicherheit bieten konnte, mit fürchterlichem Lärmen den Boden eines kleinen Fasses das vorgeschoben lag und er übersehen hatte, und wir geraten Beide trotz der verzweifelten Lage, in solches Lachen, dass ich noch heute nicht begreife, wie uns das nicht den Hals gekostet. Jetzt fing das Examen an, aber unser Bauer leugnet standhaft, und protestiert so energisch gegen den Verdacht, als werde er sich dazu hergeben, Rebellen zu retten, dass die Soldaten gläubig weiter reiten und ihm nur noch zurufen: „Wir kommen bald zurück, werden uns dann einquartieren und Haussuchung bei Euch halten.“ Durch diesen Aufschub gewannen wir die nötige Zeit zu unsrer Rettung. Herwegh ließ sich, um ganz unkenntlich zu werden, den Bart scheren und zog alte Bauernkleider an, ich fuhr ebenfalls in ein Paar abgetragene, zerrissene Lumpen hinein, und so erreichten wir – jeder eine Mistgabel auf der Schulter – glücklich das Feld.
Drei volle Stunden arbeiteten wir dort – Herwegh am einen, ich am andern Ende des Ackers. Währenddessen nahm das Schießen im fernen Wald kein Ende. Es galt den Fliehenden, die statt sich in großer Anzahl und bewaffnet zu retten, in kleinen Rotten, zu zweien, dreien flüchteten, sich stundenlang unter dem Laub versteckt hielten, dann wieder plötzlich von den Soldaten aufgescheucht, weiter gehetzt wurden. — Uns war‘s, als solle uns das Herz zerspringen, und doch war unsere Lage nicht besser, nicht sicherer als die der andern. Bei jedem Büchsenschuss fuhren wir auf und sahen uns schweigend an. Sprechen durften wir nicht miteinander, um bei den Bauersleuten der benachbarten Äcker nicht Verdacht zu erregen, oder die Augen der Kavallerie auf uns zu ziehen, die während des ganzen Nachmittags immer durch die Felder und dicht an uns vorbei sprengte, um, wie der württemberg. General D. später einem unserer gefangenen Freunde sagte: „die verfluchte Bestie, den Herwegh aufzufinden“. Die Freude sollte ihnen aber nicht werden. Nach Sonnenuntergang, als die Bauern heimzogen und es still um uns her wurde, trug uns unser guter Wirt Wein und Brot aufs Feld, hieß uns die Hauptstraße nach Rheinfelden langsam ihm folgen, die er mit einem leeren Wagen mit zwei Ochsen bespannt schnell voranfuhr.
Kaum hatten wir die Schwelle seines Hauses verlassen, als die verheißene Einquartierung wirklich angerückt war. Mit Entsetzen erzählte uns der Bauer, wie die Württemberger nicht den kleinsten Winkel undurchsucht gelassen, und selbst jedes Fass mit ihren Bajonetten durchstochen hätten. Was wär aus Euch geworden, und aus uns, fügte er hinzu, wenn Sie Euch dort gefunden? Darauf verließ er uns, und eine halbe Stunde später kam er uns mit seinem Wagen und in Begleitung eines anderen Mannes (den ich ebenfalls nicht nennen will) entgegen, der uns an dem Württembergischen Posten auf der Rheinfelderbrücke vorbeiführen sollte. Hätte man uns dort angehalten, so würde er uns für seine Taglöhner ausgegeben haben. Aber die Schwaben merkten nichts, obschon wir ihnen mit unseren Heugabeln dicht an der Nase vorbeizogen, und so erreichten wir glücklich das Schweizergebiet, auf dem eine große Zahl der Unseren schon viele Stunden vor uns ein sicheres Asyl gefunden hatten.
Mehrere waren bei Hüningen, andere auf Schiffen herübergekommen, wobei sich die württembergischen Soldaten noch nichtswürdig genug benommen hatten. Als das letzte Boot nämlich mit etwa zwölf Flüchtigen das freie Ufer glücklich erreicht hatte, und die Mannschaft schon ausgestiegen war, entdeckten die Soldaten die ihnen entgangene Beute. Und was taten sie? Nach echter Heldenart drückten sie, noch eh eine Sekunde verstrich, ihre scharfgeladenen Büchsen auf die unbewaffnete Schar ab, und ruhten nicht eher, bis wenigstens einer getroffen zu Boden sank. Glücklicherweise hatte die Kugel ihm nur den Schenkel gestreift, so dass er nach einigen Wochen wieder geheilt war. Wie steigerte sich ihre Wut, als sie wenige Tage später unsern Aufenthalt ausgekundschaftet hatten, erfahren mussten, dass ihnen der kostbarste Fang (denn 1000 Gulden sind für einen schwäbischen Soldaten eine Welt) so unwiederbringlich entgangen war. Um kein Mittel unversucht zu lassen, schickten sie einen der Offiziere nach Rheinfelden ab, um durch Bestechung zu erlangen, was ihrem Verstand nicht geglückt war – aber unser Wirt war ein guter Schweizer, der sich trotz der 2000 Gulden, die man ihm bot, wenn er sich dazu verstehen wolle, Herwegh und seine Frau bei Nacht hinüberschaffen zu helfen, zu keinem Schurkenstreich gebrauchen ließ. Mit Entrüstung wies er das Anerbieten des Offiziers zurück und dem Herrn selbst die Tür, der ihm im Fortgehen noch zurief: Hätten wir Herwegh gefangen, so wäre er ohne Verhör füsiliert worden und die Frau zeitlebens an Ketten gekommen!!!
Ich will mich hier aller weiteren Betrachtungen enthalten, aber wissen möchte ich wohl, wer besagtem Offizier diese außerordentliche Vollmacht erteilt! Übrigens wiederholten sich dergleichen Vorschläge, Herwegh gegen irgendeine bald größere, bald kleinere Summe auszuliefern, während der letzten Tage unseres Aufenthalts so häufig, dass unser Wirt selbst ängstlich, uns vielleicht nicht genügende Sicherheit bieten zu können, Herwegh riet, diesen Ort zu verlassen, an den uns ohnehin nichts mehr fesselte.
Für die Flüchtlinge war nach Kräften gesorgt – an ein gemeinsames Wirken im Moment war nicht zu denken, und so kehrten wir nach Frankreich zurück.
Möchte dies Exil kein langes sein!
Hiermit schließe ich meinen Bericht.
Der Leser mag entschuldigen, wenn ich seine Aufmerksamkeit und Geduld so lange in Anspruch genommen habe. Ich durfte jedoch keine, selbst die scheinbar geringfügigste Einzelheit übergehen, ohne mich nicht zugleich von dem Ziel zu entfernen, das ich mir, wie ich dies bereits im Vorwort ausgesprochen, gesteckt hatte: das größere Publikum über die wahren Intentionen der deutschen, demokratischen Legion zu unterrichten und den Verleumdungen, zu deren Hauptzielscheibe sich deutsche Patrioten Herwegh ausersehen, durch die ungeschminkte Wahrheit die einzig würdige, einzig vernichtende Waffe entgegenzusetzen. Für seine Freunde, für alle, die ihn nur einmal recht erkannt, bedürfte es keiner Ehrenerklärung, keines schriftlichen Dokuments. – Sein ganzes früheres Leben war ihnen der schlagendste Beweis für die Niederträchtigkeit seiner Ankläger, obschon ich es nicht verhehle, dass es mir ihrer selbst wegen lieb gewesen wäre, wenn Einer oder der Andere sich berufen gefühlt hätte, laut auszusprechen, wovon er innerlich – ich weiß es – unerschütterlich überzeugt geblieben. Für die sogenannten Freunde, zu denen ich alle diejenigen rechne, die, wenn auch leicht zu überreden, Herwegh dennoch lieber in der öffentlichen Meinung steigen als fallen sehen, weil sie mehr schwach als schlecht, mehr beschränkt als boshaft sind, hätte auch ein weniger detaillierter Bericht genügt, damit war meine Aufgabe aber noch keineswegs gelöst.
Ich konnte mich erst dann zufrieden stellen, wenn es mir gelungen war, dieser würdigen Schar liberaler und konservativer freiwilliger und bezahlter Schurken, die sich an jede reine, edle Natur wie Vampire beharrlich festklammern, bis sie ihr den letzten Lebenstropfen ausgesogen – ihr Opfer lebendig und unversehrt zu entreißen.
Hierzu bedurft es nur einer einfachen, treuen Erzählung des Erlebten, und die bis in die kleinsten Details geben zu können, war niemand befähigter als ich, die Herwegh vom Anfang bis zum Schluss der Expedition keinen Augenblick aus den Augen verloren und Zeuge jedes Wortes gewesen war, das er gesprochen hatte.
Sehr möglich, dass die Aussage dieses oder jenes Gefangenen in einzelnen Punkten von der meinigen abweichen wird. Nicht jeder Mensch kann wahr sein. Manchem versagt das Gedächtnis den Dienst, andern wieder spielt die Eitelkeit einen Streich, und diejenigen, die während ihres ganzen Lebens mit allem Industrie getrieben, werden ihr bisheriges Handwerk auch jetzt nicht verleugnen können und sich nicht scheuen, selbst ihr Märtyrertum auf Kosten derer auszubeuten, die nur dem glücklicheren Zufall ein besseres Los verdanken.
An räudigen Schafen hat es, davon bin ich nachträglich mehr als je überzeugt, auch in unserer Schar nicht gefehlt, eben so wenig an solchen, die zu gleicher Zeit den doppelten Lohn eines Kämpfers für und gegen die Freiheit bezogen haben. Wie wäre sonst – nämlich ohne den Verrat im eigenen Lager – das plötzliche Verschwinden mehrerer Chefs wenige Stunden vor dem Gefecht zu erklären, wie der zehnstündige Marsch für drei Stunden Wegs, und wie endlich die Annahme des Kampfes selbst, die bei einem ordentlichen, militärischen Kommando so leicht hätte vermieden werden können?
Aber dieser Kampf bei Dossenbach, den ich, wie ich die Sachen heute kenne, für einen im Plan der Intrige durch Verrat herbeigeführten ansehe, musste sein, wenn nicht jede Handhabe zu irgendeiner Verdächtigung Herweghs wegfallen sollte, jede Gelegenheit, ihn entweder physisch oder moralisch zu töten. Wäre ihm die Flucht auf neutrales Gebiet geglückt, die, scheuen wir uns nicht, das Kind beim Namen zu nennen, nicht erst nach dem Gefecht bei Niederdossenbach, sondern bereits anderthalb Tage zuvor anfing, als der einzige ehrenvolle Ausweg, der uns nach der Nachricht von der Niederlage unserer Freunde vor Freiburg übrigblieb — was hätte man Herwegh dann vorwerfen können? Vielleicht dass er weder eitel noch wahnsinnig genug gewesen, sich einzubilden, mit einer schlechtbewaffneten Schar von 650 Mann, die Republik in Baden gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen zu können, nachdem alle andern Freicorps bereits geschlagen waren. Oder dass er einen ehrenvollen Rückzug einem sinnlosen Kampf vorgezogen – sonst nichts. Und was wirft man ihm heute vor, nachdem er den vielfachen Verfolgungen nur durch ein Wunder entgangen ist — Feigheit! Und weshalb?
Erstens weil er aus reinem Ehrgefühl und in der Hoffnung, durch seine Gegenwart wenigstens dasjenige, was der guten Sache entgegensteht, abwenden zu können, alles auf die Karte gesetzt hatte, den ungeschicktesten Führern geduldig nachgefolgt war, die, ich sage es frei heraus, denn es ist meine feste Überzeugung, ihn während der ganzen Expedition nur als glänzendes Aushängeschild benutzen wollten.
Zweitens, weil er unbewaffnet war, und mit dem militärischen Kommando nichts zu tun hatte, wenigstens das Recht für sich in Anspruch nehmen zu dürfen glaubte, das man jedem General zuerkennt, ohne deshalb seinen Mut in Frage zu stellen, nämlich: sich nicht persönlich herumbalgen zu müssen. Fäuste waren es ja nicht, an denen es uns fehlte! Und endlich Drittens, weil ohne Herweghs Geistesgegenwart die Kämpfenden, mit denen er vom Anfang bis zum Schluss des Gefechtes einen regelmäßigen, ununterbrochenen Verkehr unterhielt (denn er hatte mit der ihm während des ganzen Zuges gegebenen Bedeckung, die Stellung wenige Schritte vom Kampfplatz unverrückt beibehalten) nicht einmal das wenige Pulver rechtzeitig bekommen hätten, das als einziger Reichtum auf meinem Wagen verpackt lag und an das keiner der Herren Chefs dachte. Bei dieser Gelegenheit will ich es nicht versäumen, den Herren Mitarbeitern und Redakteuren der verschiedenen gelehrten und ungelehrten Blätter, wie der deutschen Hofrats-, der Baseler und Karlsruher Zeitung (diese letzte hat sich hartnäckig geweigert, jeden berichtigenden Artikel, welcher von Seiten der Gefangenen an sie gesandt, aufzunehmen), meinen Dank auszusprechen, für die lobenswerte Bereitwilligkeit, mit welcher sie auf guten Glauben ohne den Schatten eines Beweises, denn woher könnten sie ihn haben, da keiner existiert, allem ihre Spalten geöffnet, was Herweghs guten Ruf schänden und, wenn es wahr gewesen, ihm mit vollem Recht jede Wirksamkeit in Deutschland hätte abschneiden müssen. Ob jene Herren Skribenten glauben, heute weniger verächtlich zu sein, wo sie, weil der Liberalismus allein rentiert, ihr Schergenamt mit dem Wahlspruch: „Alles für das Volk, Alles durch das Volk“ versehen, als gestern, wo sie Herwegh „Mit Gott für König und Vaterland“ wegen seines Radikalismus verfolgt haben?
Es gibt ein junges, demokratisches Deutschland! Ein Deutschland, das mit der alten Welt und ihren Sünden abgeschlossen hat, das nicht eher die Waffen niederlegen wird, bis Polen, bis Böhmen, bis Italien, bis ganz Europa frei, der letzte Kerker geöffnet, die letzte Kette gesprengt ist. Diesem Deutschland allein übergebe ich diese Schrift, denn dies allein hat eine Stätte für jede gute, freie Natur, dies allein ist im Stande, seine wahren Kinder von seinen Stiefkindern zu unterscheiden, und wird das schreiende Unrecht, was jenen geschieht, dereinst zu sühnen wissen. So viel Kämpfe ihm auch noch bevorstehen mögen, so viel seiner besten Kinder auch noch als Opfer des Despotismus fallen werden, ehe es Sieger bleibt – es weiß, dass es später oder früher siegen muss, und kann stolz mit jenem edlen Republikaner, den man hier vor einigen Tagen zu den Galeeren verdammte, ausrufen:
a moi l’avenir.
Vive la République démocratique
et sociale.
Es sieht düster aus, geehrte Frau, die Freiheit verhüllt ihr Haupt, und mich zieht es heimwärts, nach der Heimat, wohin ich mich seit 14 Jahren sehne, nach dem Westen Amerikas.
Dass die privilegierten Volksverräter in Frankfurt einen provisorischen Kaiser, aus dem Geschlechte, welches nur hervorbrachte, fabrizierten, einen Unverantwortlichen, an die Beschlüsse der Versammlung nicht gebundenen, dass man also die Reden und Taten des Wiener Kongresses, das ganze Lügen- und Komödienspiel von 1813/15 neu auflegte, das wissen Sie bereits. Weiterlesen
Aber dass in Ungarn und Österreich die Republikaner bei den Wahlen unterlegen sind, dass die Wiener Barrikadenhelden, dass der ganze Michel in lautem Hallo dem Reichsverweser (Fäulnis! Fäulnis!) zujubelt, dass unsere feuerspeienden „Manifeste“ und „Ansprachen an die deutsche Nation“ zwar mit Jubel beklatscht worden, aber dann die Patschhände in den Schoß fielen, dass mit einem Wort beim Volk der Geist zwar willig aber das Fleisch immer schwächer wird, das alles, was uns das Herz zerschneidet, das wissen Sie nicht; und es ist gut, dass Sie‘s nicht wissen. Wer nicht ein sich selbst betrügender Enthusiast oder ein kurzsichtiger Narr ist, der sieht es klar, dass Deutschland im besten Zuge ist, statt 34-mal 35-mal monarchisch zu werden. Unglückseliges Volk, armes Vaterland. Kommt nicht ein Anstoß von außen, ziehen nicht rote Hosen über den Rhein, so erhebt sich das Volk nicht. Eine große Zeit ist über ein kleines Geschlecht hingerauscht, und der Weltgeist schüttelt zürnend seine Schwingen und wendet den Blick ab von der verächtlichen Rasse.
Wenn es wahr ist, was man sagt, dass nämlich der reichsverwesende „Hannes“, „nur unter Verantwortlichkeit annehme“ (also liberaler tut als die Schwätzer), wenn er ferner pfiffig genug wäre, zu erklären, dass er während seiner (provisorischen) Wirksamkeit (Wirksamkeit scheint eigentlich Würgsamkeit geschrieben werden zu müssen) keine Zivilliste beziehen wollte, und lässt er gar noch eine Amnestie vom Stapel, dann sollen Sie sehen, wie der linke und der rechte Michel in überschwänglicher Rührung sich zusammenschneuzen und alles zusammenschmilzt bis auf den Bauch, der als christlich-germanisches Grundstock-Vermögen übrigbleiben muss. Es ist eigentlich traurig, Kassandra in Hosen zu sein, allein ich habe so manches richtig vorausgesehen, und mache mir keine Illusionen mehr.
Grüßen Sie Herwegh und sagen Sie ihm, dass wenn das Spätjahr noch das Volk von heute findet, er nichts Besseres tun kann, als mit den Choctaws, Comanches, Sacs- und For-Indianern Büffel jagen, und das Glück zu genießen, die Zivilisation gründlich loszuwerden; ich gehe mit. Nun leben Sie wohl und bedenken Sie, dass es in schlechten Zeiten zwei Schätze gibt, die uns alles bevölkern, der Zweifel an allem (die Negation) und die Fantasie (die Position).
Ihr Hecker.
1 Nach der Niederlage in Kandern war Hecker zunächst in die Schweiz geflohen. Überall sonst in Europa drohte ihm die Verhaftung. Also beschloss er, in die USA zu emigrieren und setzte am 20. September 1847 von Le Havre aus nach New York über.
Hecker ist diesen Morgen vermutlich unter Segel gegangen, begleitet von seiner ganzen Familie, Gritzner1 (dem Alten), Wesendonck und einer Menge anderer Flüchtlinge. Ich hätte ihn gern nur auf eine Stunde gesprochen, und, wenn es von meinem Willen abgehangen, die Reise nach Havre deshalb gemacht. Da das nicht möglich war, hab‘ ich ihm ein schriftliches Lebewohl gesagt, das dicht vor der Einschiffung noch in seine Hände gelangt sein muss, und hab‘ als Vertreter für Dich bei ihm, und als Beweis, dass er in den Herzen der Besten fortlebt, ihm Deine beiden Gedichte beigelegt, leider ohne den Schluss. Ich glaubte ihm eine freudige Genugtuung dadurch zu geben für die vielen bitteren Enttäuschungen des letzten Jahres und auch in deinem Sinne zu handeln. Ein Brief von ihm, den er an den alten Gritzner von Havre aus geschrieben und in dem er ihn zur Mitfahrt auffordert, war ein sprechendes und schmerzliches Bild der Eindrücke, welche die letzten Tage und vor allem der Umgang mit den Demokraten in ihm aufgefrischt hat. – Er ist voll von Schmerz und Zorn und sagt unter anderem: ich sehne mich in mein mühevolles Leben zurück und will das letzte Kleid, an dem noch der Staub dieser wirklich sehr alten Welt klebt, in den Ozean werfen. – Dann in Betreff der Demokraten, mit denen er in Straßburg zusammengetroffen, sagt er: „Da hört ich nichts als Verräter, Spion, schlechter Kerl, Hundsfott, und das macht, wenn nicht menschenfeindlich, doch menschenscheu.“ Mit Entzücken schreibt er dann weiter von seiner Frau, von seinem herrlichen Weib, das nur mit Mühe dem Gefängnis entgangen, in das sie zu führen, der Befehl schon in den Händen des bayrischen Offiziers war. Weiterlesen
So viel von Hecker – nun ein Wort von Häfner, dem Redakteur des Konstitutionellen in Wien, der bei der Dresdner Geschichte die rechte Hand von Bakunin gewesen ist, und mir mit Bestimmtheit versichert hat, dass an ein Ausliefern nicht zu denken. Vor der Hand ist Bakunin in Dresden und wird zu mehrjähriger Zuchthausstrafe verdammt werden, die aber für ihn nur pro forma existiert. Er wird eben einer Kommission für Strafarbeit überwiesen, die mit ihm sehr gelinde umgehen, und wo er alle möglichen Freiheiten innerhalb des Gefängnisses genießen wird.
Dieser Häfner hat mir noch allerhand Lustiges erzählt, wie der Bürgermeister Bakunin gebeten, die Häuser zu verschonen, und dieser ruhig und Zigarren stopfend ihm geantwortet: „Was da, die Häuser sind jetzt nur vorhanden, um niedergebrannt zu werden.“
Ronge2) ist dieser Tage auch bei mir gewesen und wird Dich vermutlich in der Schweiz treffen, wohin er gestern abgereist ist, um mit Karl Fröbel eine Hochschule für Frauen zu deren Emanzipation zu errichten. Ein kleiner Mann, untersetzt, mit etwas schiefer, ausgerenkter, rechter Hüfte, glattem gutgeschnittenem, sehr gewöhnlichem Gesicht, wohlgepflegtem Bart, kurzen fetten Händen mit geschmacklosen Ringen besetzt, ohne Geist und mit vieler Bonhomie. Ich fragte ihn, was er mit diesen Frauenvereinen bezwecke und brachte ihn durch meinen Humor, mit dem ich die Sache aufnahm, dermaßen aus dem Text, dass ich‘s ihm unmöglich machte, seinen Ernst zu behaupten. Die soziale und religiöse Frage soll durch diese Vereine praktisch verschmolzen ins Leben treten, durch die höhere Erziehung der Frauen auf die Elementarschulen armer Kinder, ferner auf die Mägde gewirkt werden und durch diese dann wieder zurück auf die Kinder u.s.w. u.s.w. Bis dahin, sagte er, gab‘s in Deutschland nur zweierlei Frauen: Köchinnen und … Hier stockte er; ich half ihm weiter, indem ich das Wort „Kurtisanen“ aussprach und hinzufügte: Herr Ronge, Sie können ganz frei sprechen, es gibt ja nichts, was sich natürlich gesagt nicht vor und mit unbefangenen Menschen besprechen ließe. – Also Kurtisanen und Köchinnen: Nun, was soll geschehen? „Sehen Sie, Frau Herwegh, durch diese Hochschulen soll nun“ — „ach, ich verstehe“, fiel ich ihm in‘s Wort, „soll dies vermittelt werden, dass ferner alle Köchinnen Kurtisanen werden, und alle Kurtisanen kochen können, was allerdings sehr zweckmäßig wäre.“ – Mit all diesem Zeug, denn welcher ehrliche Mensch kann heutzutage solchen Unsinn ernst behandeln, hatte ich unsern sozialen Beichtiger dermaßen aus dem Text gebracht, dass er selbst in lautes Gelächter ausbrach und sich mit dem festen Bewusstsein entfernte, an mir keinen Adepten gewonnen zu haben. „Die Liebe“, Herr Ronge“, hatt‘ ich ihm auch gesagt, „ist der einzige Hebel zur Emanzipation der Frau; wen die nicht befreit, dem werden Sie nicht helfen, Herr Ronge“ – dadurch hatt‘ ich ihn ganz gewonnen. „Da haben wir’s ja“, erwiderte er enchantiert, „da ist‘s ja ausgesprochen“, und so hatt‘ ich ihn so weit gebracht, mich in die Mysterien seines großartigen Planes einzuweihen, und schon glaubte er, mich bekehrt zu haben, als ich ihm sagte: Ja, Sie können doch aber nicht hoffen, die 11000 heiligen Jungfrauen durch die Liebe zu bekehren? „Lachen Sie nur, Frau Herwegh, ich lasse mich nicht irre machen; an meinen Früchten sollt Ihr mich erkennen.“ Ich wünschte ihm Glück und wir schieden. Im Oktober will er hier zurückkehren, um auf die französischen Frauen zu wirken. Er versteht nämlich keine Silbe französisch!
1 Maximilian Gritzner, Beteiligter am Wiener Aufstand.
2 Johannes Ronge, katholischer Priester, gilt als Begründer des „Deutschkatholizismus“. Er nahm 1848 am Frankfurter Vorparlament teil und zählte dort zum radikal-demokratischen Flügel.
Zur Geschichte der deutschen demokratischen Legion au Paris. Von einer Hochverräterin, Druck und Verlag von W. Levysohn, Grünberg 1849.
Briefe von und an Georg Herwegh, herausgegeben von Marcel Herwegh, Albert Langen’s Verlag, München 1898.
Es leben die demokratische Republik. Mit einem Vorwort von Elke Heidenreich, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023.
Michael Krausnick: EMMA – Herweghs verfluchtes Weib: Nicht Magd mit den Knechten, CreateSpace Independent Publishing Platform 2015.
Dirk Kurbjuweit: Die Freiheit der Emma Herwegh. Roman, Karl Hanser Verlag, München 2017.
Wir nutzen Cookies und ähnliche Technologien, um Geräteinformationen zu speichern und auszuwerten. Mit deiner Zustimmung verarbeiten wir Daten wie Surfverhalten oder eindeutige IDs. Ohne Zustimmung können einige Funktionen eingeschränkt sein.