
FRIEDRICH HECKER
Abb.: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, LMZ318867
Friedrich Hecker, promovierter Jurist – ungestümer revolutionärer Vollbart, Charismatiker, genialischer Redner, der gern bewaffnet und mit breitkrempigem Hut mit roter Feder, dem „Heckerhut“, auf die Rednerbühne tritt – ist 1848 der wohl berühmteste aller deutschen Revolutionäre. Als lupenreiner Demokrat hatte er bereits vor der Revolution für Freiheit, Einheit und eine Lösung der „Soziale Frage“, für den Kampf gegen Armut und Hunger von Millionen Deutschen gestritten. Nun, ab dem Ausbruch der Revolution im Februar 1848, gilt sein Wirken nur noch einem: der Errichtung einer deutschen demokratischen und sozialen Republik. Die Menschen verehren ihn, er ist der große demokratische Star: leidenschaftlich, dabei höchst reflektiert, entschieden, aber auch die Bedenken wägend. So votiert er gegen einen bewaffneten Aufstand, als er nahe lag; erst als er und sein radikal-demokratischer Gefährte Gustav Struve von Verhaftung bedroht sind, rufen sie ihre Getreuen in Baden zu den Waffen; es folgt der sogenannte Heckerzug. Der „rechte Moment“ allerdings, nach dem sie suchten, war da wohl vorbei. Nach einem letzten verzweifelten Gefecht gelingt ihm die Flucht in die Schweiz und schließlich in die USA, wo er, hochgeachtet als „Forty Eighter“, sein demokratisches Engagement, seinen Kampf um Volkssouveränität und Menschenrechte als Offizier der Nordstaaten-Armee fortsetzt.
Friedlich Heckers Schriften zeichnen das differenzierte Bild eines Mannes, der von der fürstlichen wie liberal-konstitutionellen Propaganda als „Radikaler“, „Terrorist“ und „Verbrecher“ diffamiert wurde.
Am 28. September 1811 wird Friedrich Karl Franz Hecker in Eichtersheim geboren und wächst in einem bürgerlich-liberalen Elternhaus auf. Der Vater, Josef Hecker, ist ein königlich bayerischer Hofrat.
Nach der Schulzeit in Eichtersheim und Mannheim studiert Hecker in Heidelberg und München Jura und schließt das Studium im Juni 1834 als „Doctor iuris“ ab.
Zunächst im Staatsdienst tätig, wird Hecker 1838 am Badischen Obergericht als Advokat zugelassen; hier lernt er Gustav Struve kennen, einen Amtskollegen am selben Obergericht. Als Anwalt vertritt er u. a. die Rechtsansprüche armer Bauern gegen adelige Grundbesitzer.
Auf Empfehlung Adam von Itzsteins, einer führenden Persönlichkeit des süddeutschen Liberalismus, wird er in die Zweite Badische Kammer in Karlsruhe gewählt und steigt dort schnell zum Wortführer der demokratischen Opposition auf.
Auf der Offenburger Volksversammlung fordert er offen eine deutsche Republik und kritisiert, angesichts grassierender Hungersnöte, mit scharfen Worten das Missverhältnis zwischen arm und reich.
Die Zweite Offenburger Volksversammlung am 19. März 1848 verabschiedet zwar auf Initiative Heckers ein revolutionäres Programm, um die politische Macht zu übernehmen, doch können sich Hecker und Struve damit im Frankfurter Vorparlament (31. März bis 3. April) nicht durchsetzen. Als sie daraufhin auch nicht in die Nationalversammlung gewählt und stattdessen Mitstreiter verhaftet werden, rufen sie ihre Anhänger am 13. April zu den Waffen.
Dem „Heckerzug“, der anfänglich nur aus wenigen Dutzend Freischärlern besteht, schließen sich in der Folge rund 800 Männer an, die allerdings schlecht ausgebildet und unzureichend bewaffnet sind und von den Truppen des Deutschen Bundes bei Kandern im Südschwarzwald entscheidend geschlagen werden. Hecker gelingt die Flucht in die Schweiz und emigriert von dort aus über Straßburg am 20. September in die USA.
Hecker erwirbt eine Farm in Illinois, wo er Wein anbaut und Viehzucht betreibt, bleibt aber weiterhin politisch aktiv und engagiert sich für die Abschaffung der Sklaverei. Im Sezessionskrieg (1861-1864) setzt er als Offizier der Nordstaatenarmee seinen Kampf um Menschen- und Freiheitsrechte fort.
Friedrich Hecker stirbt im Alter von 69 Jahren. Sein Grabstein befindet sich in der Nähe seiner Farm in Summerfield/Illinois – und trägt die Inschrift: Friedrich Hecker, Kommandeur des 82. Infanterieregiments des Staates Illinois.
Antonia Grunenberg
Eigentlich müsste seine Statue vor dem alten Reichstagsgebäude in Berlin stehen, dem heutigen Bundestag: Friedrich Hecker, Demokrat der ersten Stunde, Kritiker der deutschen Reichsgründung unter preußischer Führung, hellsichtiger Mahner und begnadeter Spötter.
Als der Reichstag 1894 nach mehr als zehnjähriger Bauzeit endlich fertig war, symbolisierte er den Triumph der deutschen Monarchie über die demokratische Bewegung, deren bekanntester Kopf Friedrich Hecker 1848 gewesen war.
Doch wer kennt Friedrich Hecker heute noch, von Historikern und Historikerinnen einmal abgesehen? Einige Geschichtsliebhaber wissen, dass es ein Hecker-Lied sowie einen Hecker-Hut gibt und dass 1848 ein „Hecker-Marsch“ stattgefunden hat. Viel mehr ist über diesen unvergleichlichen Revolutionär nicht bekannt. Zu Unrecht, wie die hier versammelten Texte deutlich machen. Friedrich Hecker war ein für die Geschichte der deutschen Demokratie weit bedeutenderer Mann als Otto von Bismarck, vom deutschen Kaiser ganz zu schweigen. Weiterlesen
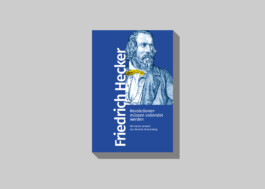
Friedrich Hecker
Revolutionen müssen vollendet werden
Erschienen am 09.02.2023
Taschenbuch mit Klappen, 176 Seiten
€ (D) 14,– / € (A) 14,40
ISBN 978-3-462-50004-2
Friedrich Karl Franz Hecker, 1811 in Echtersheim im Großherzogtum Baden geboren und 1881 in Summerfield/Illinois gestorben, war schon überzeugter Demokrat, als in deutschen Landen die Leute begannen, von politischer Freiheit zu reden. Was trieb ihn um, den Kämpfer aus dem Badischen, der den Deutschen helfen wollte, sich aus jahrhundertelanger Unterdrückung zu befreien?
Hecker kam aus einem liberal-bürgerlichen Elternhaus, besuchte das Gymnasium und studierte Rechtswissenschaft. Seine Ausbildung führte ihn zum Anwaltsberuf. Doch sein Interesse galt der Politik. In der Folge übernahm er kleinere politische Ämter und fiel auf, weil er ebenso leidenschaftlich wie überzeugend sprechen konnte. Das brachte ihm den Posten eines Abgeordneten in der Zweiten Badischen Kammer in Karlsruhe, der Hauptstadt des Großherzogtums Baden ein.
Die zwanziger und dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, in denen er heranwuchs, sah er im Rückblick als Zeit des Stillstands, geprägt von einer Atmosphäre des „Anhündelns“; so nannte Hecker das buckelnde Postenschachern an den Fürstenhöfen. Opportunismus und Feigheit, so erinnerte er sich später, hätten in der Politik vorgeherrscht, und zwar auch und gerade in liberalen Kreisen. Einflussreiche politische Persönlichkeiten seiner Zeit bedachte er mit Invektiven wie „aufgeputzte politische Koketten“ oder „eitle, törichte Schwätzer“. Man kann sich gut vorstellen, wie Hecker in jungen Jahren mit der damaligen demokratischen Studentenbewegung sympathisierte. Er hatte ein feines Gefühl für den Zeitgeist; und der verkündete von vielen Dächern in den deutschen Ländern, dass Herzöge, Grafen und Könige rasant an Vertrauen verloren. Sehr viele im Volk, vor allem im Großherzogtum Baden, wollten nicht mehr geradestehen für den fürstlichen Prunk und die Apanagen der Hofschranzen, für die Gehälter und Pensionen ihrer Beamten.
Als aufgeklärter Bürger glaubte Hecker, der Mensch sei von Natur aus befähigt, vernünftig zu denken. Daher sollten die Bürger wichtige Entscheidungen, die das Zusammenleben aller beträfen, nicht in den Händen von Monarchen und deren Regierungen belassen. Der Advokat Hecker war überzeugt, dass seine Mit-Menschen sich selber vernünftige Gesetze für ihr Zusammenleben geben könnten.¹ Und so liegt ein Schwerpunkt seiner Reden und Schriften in der oft wiederholten Maxime: Religion ist keine Staats- und auch keine monarchische Angelegenheit, sondern Privatsache. Jedem sein eigener Gott ‒ und der war nicht politisch, weil außerhalb des Irdischen angesiedelt. Damit stellte Hecker die angeblich gottgegebene Autorität der Monarchen in Frage und setzte an ihre Stelle die naturgegebene Selbstverantwortlichkeit der Bürger. In seinen Überlegungen zur Verfassung einer freien Gesellschaft bilden diese Maximen das Fundament: Monarchie ist unvernünftig, Demokratie ist vernünftig, aber nur möglich ohne Staatsreligion. In den vierziger Jahren wuchs die demokratische Bewegung überall an. Hecker und seine Freunde Johann von Itzstein, Gustav Struve, Heinrich von Gagern oder Friedrich Bassermann taten sich mit Gleichgesinnten zusammen. Sie gründeten politische Debattierklubs und beschlossen schließlich, öffentlich für eine Verfassung einzutreten, in der die Rechte des Volkes neu geregelt würden. Es galt, in den Ländern, allen voran in Baden, eine demokratische Verfassung zu erarbeiten und eine dem Volk verantwortliche Regierung zu bestellen. Also sollte zunächst ein Vorparlament ernannt werden, dann freie Wahlen ausgeschrieben und ein ordentliches Parlament gewählt werden, aus dem heraus eine unabhängige Regierung bestellt werden konnte.
Welche juristischen und politischen Instrumente es dazu brauchte, das konnte man bei den Franzosen abschauen, die schon zwei Revolutionen hinter sich hatten und im Februar 1848 erneut gegen die Monarchie aufstanden. Oder man blickte nach Amerika, wo die Verfassung nach einem Unabhängigkeitskrieg gegen die englische Kolonialmacht in öffentlicher Debatte geschaffen worden war.
Doch an der Frage, wie man mit den angestammten Königen, Großherzögen und Grafen und deren machtgestützten Netzwerken umgehen sollte, spaltete sich die Bewegung. Die Mehrheit der Liberalen, zu denen Gagern und Bassermann gehörten, wollte einen Kompromiss: Verfassung ja, aber mit Zustimmung der Monarchen. Das Volk verursache nur Unruhe, müsse also in Schach gehalten werden, argumentierten die Liberalen. Hecker und seinen Freunden war klar, dass dieser Kompromiss faul war. Sie bestanden darauf, dass die monarchische Herrschaftsform gänzlich abgeschafft gehöre – und liefen gegen eine Wand der Ablehnung. Letztlich unterlagen sie den Ränkespielen ihrer Gegner so deutlich, dass selbst das Volk sich zurückzog. Ein letzter Versuch Heckers, mit einer Menge von bewaffneten Bürgern in die Hauptstadt des Großherzogtums Baden, nach Karlsruhe, einzuziehen, scheiterte kläglich am Mangel von Mitkämpfern. Es kamen nicht mehr als 800 Männer zusammen, die im Kampf mit den örtlichen Truppen hoffnungslos unterlagen; Hecker floh in die Schweiz.
Am Ende siegten die Liberalen im Verein mit den Monarchisten. Ihnen kam es ohnehin mehr auf den ungehinderten Warenverkehr an als auf eine freiheitliche politische Ordnung. Sie betrachteten die Politik als Wegbereiterin wirtschaftlichen Wachstums. Entscheidend waren für sie die wirtschaftspolitischen Freiheiten, die sich erst in einem einheitlichen Wirtschaftsraum entfalten könnten. Also votierten sie für den Kompromiss, den die radikalen Demokraten für grundfalsch hielten: eine konstitutionelle Monarchie unter Preußens Führung, will heißen, unter einem preußischen König. Der aber machte sich öffentlich lustig über die Abgeordneten, die ihm den Entwurf einer demokratischen Verfassung überreichen wollten.
Am Ende erreichten die Liberalen den Fortbestand der Monarchie in deutschen Ländern samt pseudoparlamentarischer Verfassung. Die Fürsten waren erleichtert, am lautesten lachte der preußische König. Die Reichseinigung unter einem preußischen Kaiser brachte dann im Jahre 1871 den deutschen Ländern den endgültigen wirtschaftlichen Zusammenschluss, aber eben nicht die politische Freiheit ihrer Bürger.
Das Programm der sogenannten radikalen Demokraten, die sich nicht von den Liberalen einfangen ließen, trug Heckers Handschrift:
- Abschaffung aller monarchischen Steuern und Abgaben; sei das geschehen, würde das Volk freiwillig Steuern nach Maßgabe des Verdienstes zahlen;
- Enteignung allen monarchischen Grundbesitzes; Überführung in Volkseigentum unter staatlicher Verwaltung mit anschließender Bodenreform inklusive Landverteilung an arme Bauern;
- Staatsbeamte (Richter und Verwaltungsbeamte) sollten vom Volk gewählt werden, ihre Entlohnung maßvoll sein; nach Ablauf ihrer Dienstzeit sollten sie ohne Pension zurück in den Privatstand treten und ihrem Beruf nachgehen;
- Bildung einer Regierung durch gewählte Volkskommissare, die von der Nationalversammlung zu bestellen seien;
- statt einem stehenden Heer solle ein Volksheer aufgestellt werden.
Dieses politische Gebäude sollte vom freien Zusammenschluss aller deutschen Länder zu einer föderalen Republik mit demokratischer Verfassung gekrönt werden.
Hinzu trat die Garantie persönlicher Freiheiten: Religionsfreiheit, Presse- und Meinungsfreiheit.
Die Eckpfeiler der auswärtigen Politik sollten durch Vertragsabschlüsse mit anderen freien Staaten (Frankreich, Amerika, Schweiz) gebildet werden.
Die Kernaufgaben des Staates fasst Hecker lakonisch in drei Punkten zusammen: Der Staat muss
1. die Religion privatisieren,
2. die Freiheitsrechte aller garantieren und
3. das Individuum vor Übergriffen, auch den staatlichen, schützen.
Das Ziel der Umwälzung der politischen Ordnung sei es, einen „menschenwürdigen Zustand der Freiheit“ zu begründen. Heckers radikale Absage an die Monarchie war mehr als nur Ausdruck eines aufklärerischen Idealismus. Er nahm die Not der Bauern und der städtischen Bevölkerung realistisch wahr; das liest man in seinen Schriften. Er wusste, was er sagte, wenn er die Abgabenlast der „Zehnten, Frohnden, Rabatte, Gülten, Zinsen, Zwangsgerechtigkeit und andere(r) Grundlasten“ für überlebt und kontraproduktiv erklärte. Schließlich lebte man mitten im beginnenden Industriezeitalter. Durch die vielen Steuern und Abgaben war das Bürgertum in seinem Tatendrang blockiert, das wurde den Handwerkern, Laden- und Manufakturbesitzern immer dann klar, wenn sie nach England blickten, wo die industrielle Revolution seit über einem halben Jahrhundert im Gange war. Weder gab es einen gemeinsamen Markt noch eine gemeinsame Währung, weder allgemein gültige Maßeinheiten noch durchgehende Eisenbahnlinien, geschweige denn Bewegungs- bzw. Reisefreiheit. Viele materielle Gründe sprachen für die Abschaffung der monarchischen Regimes in deutschen Landen. Von den armen Leuten gar nicht zu sprechen, die aufgrund der Abgaben keine Chance hatten, aus der Armut herauszukommen. Daher unterstützten vor allem in Baden nicht nur tatendurstige reiche, sondern auch mittellose arme Bürger Hecker und seine Getreuen anfangs.
Das demokratische Programm war für alle deutschen Staaten gedacht. Der Prozess der Demokratisierung war eng mit der Vereinigung der deutschen Staaten verbunden. Demokratie in nur einem der zahlreichen deutschen Staaten, das war nicht möglich, darin stimmten die Liberalen mit den Demokraten überein. Im Grunde war die deutsche Zersplitterung – 38 Staaten mit ebenso vielen monarchischen Höfen ‒ ein Überbleibsel aus dem Feudalismus. Der deutsche Staatenbund (Deutscher Bund) von 1815 hatte diese Einigung natürlich nicht erreichen können, da er nicht mehr als ein Zweckbündnis der Fürsten gegen das Volk sei, argumentierten die Demokraten.
Eine aus freiem Entschluss der Bürger erreichte deutsche Einheit war etwas völlig anderes. Das künftige Deutschland sollte ein freier föderaler „Volksstaat“ sein: also Einheit in Freiheit – und nicht Einheit ohne Freiheit, wie es dann 1871 geschah.
Zu Heckers Zeit gärte es rings um Deutschland herum. Man musste nur über den Rhein schauen, um das europäische Vorbild eines demokratischen Aufbruchs zu sehen: Frankreich. Gleichwohl mussten die Franzosen dreimal ‒ 1789, 1830 und 1848 ‒ revoltieren, ehe es ihnen gelang, eine Republik der Bürger zu etablieren. Erst die dritte Revolution brachte die Befreiung von der adeligen Pfründenwirtschaft. Das hätte Hecker und den Seinen zu denken geben können.
Die Schweiz war auf dem Weg von einem Staatenbund zu einem republikanischen Bundesstaat; aber auch dort wurde dieser Prozess regelrecht ausgekämpft. Im Habsburgischen Reich brodelte es. Der ungarische Adel und das dortige Bürgertum wollten mehr Selbständigkeit. Fast überall in Europa blühten demokratische Bewegungen auf. Die Völker spürten, dass die königliche Macht schwächer geworden war und die Monarchen sich nurmehr auf Gewalt stützten.
Vom fernen Amerika glänzte im Morgennebel die Freiheitsstatue, das Symbol eines Bundes von sich selbst regierenden Republiken mit einer gemeinsamen staatlichen Zentrale. Von den großen Persönlichkeiten des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs konnte man lernen, wie eine freiheitliche Verfassung zustande kommt und auf welchen Prinzipien sie beruht. Die Amerikaner wiederum hatten während der Französischen Revolution gelernt, was man vermeiden sollte, nämlich soziale Gleichheit durch Terror zu erzwingen.
In Baden war die demokratische Bewegung am stärksten; von dort kam Hecker ja her. Aber selbst dort trauten sich die Bürger, die sich über lange Zeit immer wieder auf ihren Marktplätzen versammelt und nach Freiheit verlangt hatten, letztlich nicht, die entscheidenden Schritte zu gehen. Vielleicht haben Hecker und seine Getreuen das Momentum verpasst, vielleicht waren es einfach zu wenige, die die Republik wollten, vielleicht lag es daran, dass sie die Hilfe der deutschen Exilanten aus Paris (unter ihnen der Journalist Georg Herwegh und seine Frau Emma), die sich mit einer Heerschar von Gesinnungsgenossen auf den Weg nach Deutschland gemacht hatten, um der Badischen Freiheitsbewegung beizustehen, nicht annahmen. Vielleicht waren aber auch die deutschen Bürger noch nicht selbstbewusst genug, trauten letztlich ihrer eigenen Kraft nicht. Und so endete diese demokratische Erhebung kläglich.
Nach der demütigenden Niederlage floh Friedrich Hecker in die Schweiz. Dort sah man ihn nicht gerne; er versuchte es in Frankreich, aber da wollte man ihn auch nicht. Es war aus seiner Sicht nur folgerichtig, in dieser ausweglosen Situation in die Vereinigten Staaten auszuwandern, dem Land, in dem die Freiheit gefestigt schien, in dem die Bürger ihre politische Zukunft selbst in die Hand genommen hatten. Er ließ sich in Illinois nieder und kaufte eine Farm, baute Wein an, betrieb Viehzucht.
Aber in den Vereinigten Staaten war die Freiheit noch keineswegs gesichert zu jener Zeit. Der Norden war für die Abschaffung der Sklaverei, die Südstaaten traten aus der Union der Vereinigten Staaten aus, um weiter Sklavenwirtschaft betreiben zu können. Sie gründeten eine eigene Konföderation der Sklavenhalter-Staaten. 1861 brach über dieser Sezession ein Bürgerkrieg zwischen den verfeindeten Staatenbünden aus. An ihm nahm Hecker wie auch viele andere deutsche Emigranten als Freiwilliger der Nordstaaten-Armee teil.
Ein einziges Mal noch, 1873, kehrte er nach Deutschland zurück – und sah dort das, was er 1848 vorausgesehen hatte: Ein mächtiges Reich, das polizeistaatlich regiert wurde.
Friedrich Hecker starb 1881 in seiner zweiten Heimat Illinois. Auf seinem Grabstein ist sein militärischer Rang als Kommandeur des 82. Infanterieregiments verzeichnet.
Der demokratische Revolutionär mit Leib und Seele ist nach seinem Tod zu einer Provinzgröße zurückgestuft worden, über die man nur in lokalen Kreisen spricht. In Mannheim machen sich die Stadtväter seit einigen Jahren Gedanken, ihm ein Denkmal zu setzen ‒ über 170 Jahre nach der demokratischen Revolution, für die er stand. In Berlin lehnte man ein Denkmal für die Revolutionäre von 1848 auf dem Schlossplatz ab und wählte stattdessen den indirekten Weg eines Denkmals für jene nach Nordamerika vertriebenen Demokraten, als deren Repräsentant Carl Schurz bestimmt wurde, auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor. Offenbar kann man deutsche Demokraten umso leichter ehren, wenn sie nach Amerika vertrieben worden sind. Friedrich Hecker wird dort unter ferner liefen firmieren.
Heckers Geschichte erzählt von Wagemut und Verrat, von hohen Zielen und den Mühen der Ebene, von Niederlagen und Siegen, vom Hinfallen und Wiederaufstehen. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, dieser Spruch aus dem Umbruchsjahr 1989 lässt sich auch umkehren: Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. Hecker kam zu früh, und dafür wurde er bestraft. Doch er hat deutliche Zeichen hinterlassen.
Wer Heckers Schriften heute liest, erschrickt manches Mal. So klar und weitsichtig lesen sich seine Analysen, so zeitgenössisch – und so zeitlos. Wie eine prophetische Voraussage klingt, was er seinen Landsleuten nach dem Scheitern des Badischen Aufstands vorhielt: „Ohne Republik stets ein zersetzender Gärungsprozess, ohne Republik keine schöpferische Entwicklung des Volkes, ohne Republik kein Wohlstand des Volkes, ohne Republik keine Einheitskraft im Innern und nach Außen, ohne Republik keine Freiheit, und keine Freiheit für die Dauer.“
Was manchen Liberalen damals wie eine leere Drohung vorgekommen sein mag, verblüfft uns heutzutage ob seiner Aktualität: Hat nicht die Gründung des Deutschen Kaiserreichs den Spaltpilz erst recht in die deutsche Gesellschaft getragen? Die Politik des Reichskanzlers Otto von Bismarck (Kulturkampf und Verfolgung der (Sozial-)Demokraten) legt jedenfalls davon Zeugnis ab.
Wie ein roter Faden zieht sich eine Lehre durch die jüngere deutsche Geschichte: Die Deutschen verzweifeln immer dann an der Freiheit, wenn die Zeiten schwer sind. Die 15 Jahre andauernde Weimarer Republik fand nicht genügend Verteidiger, die sie vor dem Ansturm der kommunistischen Bewegung auf der einen Seite, der nationalsozialistischen Erhebung auf der anderen Seite und dem mangelnden Stehvermögen des Bürgertums hätten schützen wollen.
Die Gründung der Bundesrepublik 1949 war (dem Himmel sei Dank!) ein Oktroi der westlichen Besatzungsmächte und beruhte nicht auf dem seinerzeitigen Volkswillen. Die Gründung der DDR, ebenfalls 1949, war ein als antifaschistischer Akt verkleideter kommunistischer Oktroi, den die Mehrheit der Bevölkerung begrüßte. Die friedliche Revolution von 1989, von der Mehrheit der Menschen in der ehemaligen DDR jubelnd begrüßt, wich Jahre später bei einem nicht unbeträchtlichen Teil der Bevölkerung einem Argwohn, der insinuierte, die neu errungene Demokratie sei mit Hilfe einer Siegerjustiz oktroyiert worden.
Bis heute wissen beachtliche Minderheiten in Ost und West nicht recht, ob sie nun demokratisch leben oder lieber fürsorglich bevormundet werden wollen. In Umfragen, in denen sondiert wird, wie hoch die Deutschen die soziale Sicherheit und die politische Freiheit schätzen, steht immer die soziale Sicherheit an erster Stelle, vor der Freiheit. Auch wenn andere Umfragen besagen, dass die Mehrheit der Deutschen davon überzeugt ist, langfristig werde überall auf der Welt Freiheit gegen Unfreiheit siegen, die Befunde sind nicht gerade beruhigend.
Wäre Deutschlands Weg weniger katastrophal verlaufen, wenn die Bürger 1848 mutiger gewesen wären? Wir wissen es nicht. Der Verlauf der Geschichte lässt sich weder vorwärts noch rückwärts berechnen. Doch als Frage kommt dieser Gedanke gleichwohl immer wieder auf.
Daran ist Friedrich Hecker nicht ganz unschuldig.
1 Hecker war eine Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts, daher war für ihn Politik reine Männersache; dies war in deutschen Landen nicht anders als in Frankreich, England oder den Vereinigten Staaten. Gleichwohl hat er sicher wahrgenommen, dass es Frauen gab, die ebenfalls für die Politik begabt waren, wie zum Beispiel Emma Herwegh, die Frau des ins Pariser Exil vertriebenen Dichters Georg Herwegh.
1. Einleitung.
Der badische Landtag von 1842 bildet ohne Zweifel einen scharf bezeichneten Abschnitt in der staatlichen Entwicklung des·deutschen Volkes. Der laute Freiheitsschrei des gallischen Hahns im Jahr 1830 war verklungen, die politische Trägheit und Gleichgültigkeit hielten reiche Erne, große und kleine Klatschereien und literarischer Skandal waren die Würze zu dem Sklavenbrei des alltäglichen Schlendrians, Gelddurst und ein Rennen nach Erwerb, was man die materiellen Interessen nannte, war die Losung des Tages, und sie wurde von oben herab gnädig beäugelt und begünstigt, weil in geldgierigen Krämerseelen kein prometheischer Funke aufstrahlt und weil die Richtung der Zeit wie eine Finanzspekulation angesehen wurde: wobei man sich aber denn doch verrechnet haben möchte, da auch die materiellen Interessen der Sache der Freiheit dienen müssen und dienen. In dieser welken Zeit tauchte nur hier und da in deutschen Landen ein Wetterleuchten auf. Weiterlesen
1 Dieser Text ist ursprünglich für eine von Georg Herwegh geplante, aber noch vor Erscheinen verbotene Zeitschrift entstanden. Herwegh hat ihn daraufhin, mit anderen Zeitschriften-Beiträgen, 1843 in einem Sammelband veröffentlicht, dem er den Titel gab: „Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz“ – „einundzwanzig“ deshalb, weil in den Ländern des Deutschen Bundes alle Druckerzeugnisse bis zu 20 Bogen einer Vorzensur ausgesetzt waren. Das Buch wurde zu großen Teilen bereits im Drucksaal beschlagnahmt. Dennoch gelangten einige Exemplare nach Deutschland und trafen dort auf große Resonanz.
Hannover machte ein mutiges Gesicht und wendete sich höflich an den Bundestag, der sich offiziell für inkompetent erklärte; die deutschen Kammern trugen hingegen Bedenken und predigten tauben Ohren für die Brüder in Hannover; Pressfreiheit wurde begehrt und·Zensuredikte ergingen; die Zeitungen erzählten ausführlich, dass Prinzen auch heiraten, fürstliche Kinder auch getauft werden, und Könige sterben wie Bauern. Fast allmonatlich musste ganz Deutschland deshalb entweder in der verzücktesten Exaltation oder in der tiefsten Trauer sich befinden, so dass die guten Michelinge nach den offiziellen Zeitungsnachrichten gar nicht mehr wussten, wie sie eigentlich daran waren.
In Baden hatte sich der Sinn für Freiheit und Verfassungsleben noch am wachsten erhalten. Da fuhr der Urlaubsstreit und seine Folgen wie ein Streiflicht über das Land; die wahren Abgeordneten des Volkes erhoben sich, wie Ein Mann, gegen Eingriffe in die Verfassung. Die Minister waren gewöhnt, dass man in glatten, abgedroschenen Formen sie anredete; jedes Wort wurde noch extra in Baumwolle gewickelt, damit man ihnen nicht zu wehe tue, und das nannte man: eine parlamentarische Sprache führen. Die deutschen Minister, die wohl wussten, dass ihnen das Portefeuille an den Leib gewachsen war und nur der Tod sie von ihm trennen könne, nahmen Prisen, während man sie apostrophierte, und die Reden und Vorwürfe glitten an ihnen ab wie der Hauch am Spiegel.
Da erhoben sich die badischen Deputierten und nannten die Dinge bei ihrem wahren Namen; sie sprachen mit dem Herzen; die Wörterbuhlschaft hatte ein Ende. Das war der Regierung unbequem: Es verwischte das Zwielicht ministerieller Erhabenheit; es kam einem adelichen Minister höchst auffallend vor, dass ein schlichter Landmann, ein Bürger aus der Stadt, ein Anwalt ihm unumwunden ins Gesicht sagte: „Das ist recht und das ist schlecht", denn er war ja lediglich an den Bückling des Supplicantenfracks und baumwollene Redensarten gewöhnt.
Nun entstanden eine Reihe halb offizieller Artikel, in welchen man die Abwehr der Eingriffe in Verfassungs- und Volksrechte Anmaßung und Angriff auf die Rechte. der Krone nannte; das monarchische Prinzip wurde mit der Person der Minister identifiziert, und wer einen Meister angriff, musste unfehlbar den Regenten angegriffen haben. Die Regierungsjournale versicherten auf das Bestimmteste, die deutschen Verfassungen seien samt und sonders keine repräsentativen, sondern deutsch-monarchisch-ständische. Was letzteres Wort bedeute, wurde eigentlich nicht gesagt, sondern so oft ein den Ministern unbequemer Akt vorging, hieß es immer: das ist gegen den Geist der deutsch-monarchisch-ständischen Verfassungen. lm Hintergrunde lauerte die Idee von Feudalständen, wenn's gut ginge, von Postulatlandtagen, mit denen es sich so bequem regieren lässt; aber geradezu sagen wollte man es denn doch nicht, obschon in der neuesten Zeit die Sache deutlicher ausgesprochen wurde. Eine große Unwissenheit in Verfassungsgesetzen verriet freilich eine solche Behauptung in Baden, woselbst in dem Verfassungsgesetz vom 23. Dezember 1818 die Verfassung selbst, abgesehen von ihrem Geiste, sogar eine repräsentative genannt wird; eine große Unkenntnis der Geschichte verriet das unbedingte Berufen auf die alten deutschen Landstände, da verschiedene derselben den Ständen das Recht der Steuerverweigerung ausdrücklich, ja, sogar das weitere Recht einräumten, wenn der Regent die beschworene Verfassung verletze oder bräche, sich ihm mit gewaffneter Hand zu widersetzen.
Das wichtigste Moment des badischen Landtags von 1842 ist, dass er nicht der Abglanz fremden Freiheitsgeistes, wie 1831, war, sondern dass dieser Geist sich selbstständig aus dem Volke entwickelte, während in Frankreich immer mehr und mehr-die Freiheit entschlummerte und die Minister die Deputierten wählten, nicht aber das Volk. Das war der Zustand der Dinge im Allgemeinen.
Bevor man nun zur Geschichte und Beleuchtung des Landtages von 1842 übergeht, wird es nicht überflüssig sein, auf die Zusammensetzung der zwei Kammern in Baden einen Blick zu werfen. da in der neuesten Zeit sowohl ein ehemaliger Reichsbaron in der ersten Kammer und ein Artikel der Carlsruher Zeitung, offenbar das Kind des Ministers von Blittersdorff, welcher der zweiten Kammer als Lebewohl nachgesendet wurde, so gütig waren, sich soweit herabzulassen und zu behaupten, es sei eine Anmaßung der zweiten Kammer, sich allein als-Volkskammer darstellen zu wollen; denn die Mitglieder der ersten Kammer seien auch vom Volke. Die Regierung gehöre mit allen Ministern dazu. Das war eine Manipulation, um das Wort Volk zum sachdienlichen Gebrauch in die adeliche und Ministerhand zu nehmen, wie ein deutscher Prinz kein Preußen und kein Österreich, sondern ein einiges, großes Deutschland hochleben ließ; ein Wort, das früher vor die Mainzer Kommission2 geführt hätte (…).
2. Zusammensetzung der badischen Kammern.
Die erste Kammer, welche also, wie gesagt, auch eine Volkskammer sein will, besteht nach der badischen Verfassung aus:
Das·ist denn doch kein Senat wie der belgische. Unter Volk hat man bisher immer die Staatsbürger begriffen, die sich an Rechten unbedingt gleich sind, die keine Vorzüge der Geburt, keine Vorzüge des Standes für sich in Anspruch nehmen und keinen Vorzug als den der Intelligenz anerkennen. Bisher hat man die Aristokratie immer in Gegensatz zum Volke gestellt; noch ist unter den hochadelichen Herren das Won Canaille als Bezeichnung des Bürgers nicht verschwunden; bis beute haben jene gnädigen Herren der Entlastung des Bodens sich entgegengestemmt, und gegen die Gesetze, welche sie selbst mit verfassen halfen, in dem ihre gewählten Vertreter in der ersten Kammer ihre Zustimmung gaben, (…) bis heute jedem Fortschritt. wenn er nicht von oben kommandiert war, ein starres, verstocktes Nein entgegengesetzt.
Fassen wir aber nun die Zusammensetzung dieser Kammer ins Auge, so ergibt sich, dass kein freisinniger Vorschlag, kein Vorschlag zum Fortschritt, keine Adresse an den Großherzog, worin um·etwas Zeitgemäßes gebeten wird, die Zustimmung dieser Kammer erhalten kann, wenn nicht die Regierung a priori mit der zweiten Kammer einverstanden ist, folglich eine Adresse überflüssig wird, indem die Regierung dann ohne dieses schon mit der Sache herausrücken wird. Denn nehmen wir zum Beispiel an, die zweite Kammer verlangte in einer Adresse an den Regenten Geschworenengerichte, die Regierung hätte eine Abneigung dagegen, geschwind wird die erste Kammer sie in der Abstimmung über die Adresse der zweiten Kammer teilen. Würden nämlich die·acht Grundherren als unabhängige Gutsbesitzer mit der zweiten Kammer eines Sinnes sein, was, per parenthesis gesagt, schwerlich je vorkommen wird, gleich wird ihr Votum durch die acht Staatsdiener aufgewogen; die zwei Deputierten der Universitäten würden durch die zwei geistlichen Würdenträger paralysiert; die Prinzen des Hauses werden sich mit der Regierung nicht in Opposition setzen, – und das ist eine Volkskammer?!
Es ist komisch, wie der Freiherr von Andlau in der zwölften Sitzung der ersten Kammer am 26.August, bei Gelegenheit der Großjährigkeit des Erbgroßherzogs und seiner Einführung in die erste Kammer, in einer wohlstudierten Rede sich entrüstet erklärte, dass man daran zweifle, die erste Kammer sei eine Volkskammer. Was würde der goldgeharnischte Reichsfreiherr mit dem lichtbraunen Rösslein gesagt haben, wenn ihn, den Volksrepräsentanten, ein schlichter Landmann im Kreise anderer Junker mit einem Händedruck und den Worten hätte begrüßen wollen: „O Angehöriger und Teil des Volkes u. s. w.“ Hellauf hätten die Freiherren gelacht, und verlegen hätte der Volksrepräsentant versichert, so sei es doch eigentlich nicht gemeint gewesen, sondern …
War es eines Mannes, der dem Volke angehören will, würdig, in das weiche und zugängliche Herz eines Fürstensohnes bei dessen Eintritt in das politische Leben die Verdächtigung einzugießen, als sei die andere Kammer auf dem Wege, welchen der Nationalkonvent und seine Wohlfahrts und Sicherheitsausschüsse gingen! War es würdig, den Morgen jenes politischen Lebens (und die ersten Eindrücke verwischen sich nicht leicht) mit Anspielungen auf den Tod Ludwigs XVI. zu begrüßen, Hass und Misstrauen in eine jugendliche Brust zu säen, ein unheimliches Gefühl gegen die andere Kammer in ihm heraufzubeschwören! Und wer hat denn mehr Könige gemordet als die Standesgenossen des Freiherrn? Wer hat in der jüngsten Geschichte Gustav III., wer hat die russischen Zaren gemeuchelt? (…)
Die zweite Kammer ist zusammengesetzt aus 63 Abgeordneten der Städte und Ämterbezirke. Jeder Staatsbürger, der das 25. Jahr zurückgelegt hat, im Wahldistrikt als Bürger angesessen ist, oder ein öffentliches Amt bekleidet, ist Wähler; ausgeschlossen sind bloß Hintersassen, Gewerbsgehilfen, Gesinde, Bediente.
Diese Wähler wählen Wahlmänner und diese den Abgeordneten. Abgeordneter kann jeder werden, der einer der anerkannten christlichen Konfessionen (katholische und evangelische) angehört, 30 Jahre alt, in dem Häuser-, Grund- und Gewerbesteuerkataster mit einem Kapital von 10,000 fl.3 eingetragen ist, oder eine Rente von wenigstens 1500 fl. von einem Stamm- oder Lehensgute, oder eine fixe und ständige Besoldung oder Kirchenpfründe von gleichem Betrage als Staats- oder Kirchendiener bezieht, auch in diesen beiden letzten Fällen wenigstens irgendeine direkte Steuer aus Eigentum zahlt.
Diese Wahlordnung ist nun ein Stein des Anstoßes. wie in dem acht Spalten großen Artikel der Carlsruher Zeitung, der unmittelbar nach dem Schlusse des Landtages erschien, mit vieler Gleisnerei gepredigt wird. Ebenso ist es auch die Bestimmung der Verfassungsurkunde, wonach derjenige, welcher im Gewerbesteuerkataster mit 10.000 fl. eingetragen ist, Abgeordneter werden kann. Man möchte gerne, wie in Frankreich, einen Wahlzensus eingeführt wissen; denn, wenn dieses geschehen würde, so hätte, wie in Frankreich, die Regierung gewonnenes Spiel. Die Wähler würden dann auf einige tausend reduziert; es wären meist reiche und, wie die meisten Reichen, ängstliche Leute; sie wären leicht zu bearbeiten und zu kontrollieren; wenn aber jeder Bürger Urwähler ist, geht das nicht an. Man hat wohl eingesehen, dass die Urwähler es sind, welche den Abgeordneten erküren; denn wählen die Urwähler freisinnige, unabhängige Bürger zu Wahlmännern, so hilft alle Bearbeitung der Regierung nichts, ein liberaler Abgeordneter wird gewählt. Sogar die selige oberdeutsche Zeitung ging in einer ihrer letzten Nummern in jene Ansicht ein: auch sie wurde vornehm und meinte, es sei denn doch etwas zu weit gegangen, wenn alle Bürger, ob sie etwas besäßen oder nicht, Wähler sein könnten. Es ist gut, dass ein Blatt, welches die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte lediglich von dem Besitz abhängig machen wollte, welches den ersten Menschenrechten den Krieg erklärte, aufgehört hat, zu erscheinen.
Ist denn der intelligente Mann, dem die Zufälligkeit der Glücksgüter versagt ist, ist der Bürger, welcher alle staatlichen Pflichten getreulich erfüllt, der steuert wie der Reiche, ein Paria, weil er nicht gefüllte Truhen im Hause hat? Ist der ärmere Bürger schlechter als der Reiche? Fühlt er nicht Wohl und Wehe des Vaterlandes wie jener? Ist ihm die Sache des Vaterlandes und der Freiheit weniger teuer? Und soll er mit allen edlen Gefühlen seiner Brust ausgeschlossen sein von der Ausübung staatsbürgerlicher Rechte? Sich dabei unvertreten sehen? Das ist Furcht und Feigheit, das ist Geldhochmut und Kastengeist, das ist Machiavellismus. Die Reichen und Besitzenden allein retten das bedrängte Vaterland nicht, und wenn der ärmere Bürger gut genug ist, sein Blut für das Gemeinwohl als Krieger zu verspritzen, muss er auch gut genug sein, mitzureden bei den allgemeinen Landesangelegenheiten, denn Blut ist mehr als Geld, und nur da ist ein wahres Repräsentativsystem vorhanden, wo alle Bürger an der Volksvertretung teilnehmen. Vergesst, ihr Hochmütigen, die Worte des Heilandes nicht, dass ein Kamel eher durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in das Himmelreich kommt.
(…)
4. Das Ministerium Blittersdorf und sein System
Das politische System eines Menschen hängt mit seiner Persönlichkeit und seinen Verhältnissen innig zusammen. Der Minister Blittersdorf ist ein von Haus aus armer Adelicher, das ist: ein bedeutungsvolles Subjekt und Prädikat. Seine finanziellen Verhältnisse haben sich durch Verehelichung mit einer bürgerlichen, einer Frankfurter Bankierstochter günstiger gestaltet; wenngleich noch zurzeit nicht so bedeutend, dass er, wie dieses Jahr in Kissingen der Fall gewesen sein soll, jedes Jahr 12,000 fl. verspielen könnte. Von Charakter ist er hochfahrend, herrschsüchtig und wiederum aalglatt, einschmeichelnd und listig, besitzt jene, an Gründen nicht überfließende, Leute schwächeren Geistes blendende, Salonsprache und Redegabe; daher auch Mancher hinter seinen Reden in der Kammer etwas suchte, aber bei ruhiger Analyse nichts fand, als Behauptungen ohne Beweis, Widerspruch ohne Widerlegung, eingekleidet in eine wörterglänzende Sprache. Sein politisches System verrät Frechheit, aber keine Kühnheit, Unüberlegtheit, aber keinen Mut, einen Satz Stirn an Stirn durchzukämpfen. Der Fürst Metternich soll ihm, nach glaubwürdigen Versicherungen von Männern, die auf Schloss Johannisberg, bei dem bekannten Diener, im Jahre 1841 anwesend waren, gelegentlich des von Blittersdorf angezettelten Urlaubsstreits4 gesagt haben: „Es war sehr ungeschickt. Herr von Blittersdorf, diesen Streit zu einer Zeit anzuregen, in welcher Regierung und Stände durchaus einig waren.“ Was es, ins Deutsche übersetzt, heißt, wenn Metternich etwas ungeschickt nennt, bedarf keiner Ausführung. Blittersdorf ist ein politischer Spieler. Aber er hat nicht den Mut va banque! zu rufen, er möchte um jeden Preis herrschen und Portefeuille und Gehalt nicht verlieren. Sein System ist durchaus nicht das rein monarchische. Er möchte den Fürsten von der Cotterie seiner Standesgenossen umgeben wissen, der Adel soll herrschen, der Regent dem Adel verfallen, das Volk incanailliert werden; sein Prinzip ist das aristokratische (…). Wie alle derartigen Individuen, verhehlt er die Wahrheit, verdreht sie, erregt Befürchtungen, greift jeden Moment auf, um ihn seinem Herrn als Angriff auf die Rechte der Krone darzustellen, und treibt die Ungeschicklichkeit so weit, jeden Angriff auf die Minister als einen Angriff auf die Rechte der Krone darzustellen, seine Person mit dem monarchischen Prinzip zu identifizieren. Die von ihm ausgehenden, vielen Zeitungsartikel, leicht am Stil erkenntlich, sind weniger berechnet, auf das Volk als nach oben zu wirken, weil er weiß, dass das Volk weder Minister macht noch absetzt; daher drehen sich auch alle diese Artikel um eine Achse, nämlich, alle Handlungen der Kammer als Angriffe auf die Krone darzustellen. Unterstützt wird er von seinen Standesgenossen, besonders von dem gesamten Ministerialadel, weil sie einsehen, dass er für ihre Herrschaft streitet.
Vielfach hat er schon ausgesprochen, die badische Verfassung sei keine repräsentative (eine Unwahrheit, die oben widerlegt ist), sondern eine monarchisch-ständische, d. h. eine aus den alten Feudalverfassungen allein zu interpretierende. Eine Interpretation aus analogen Verhältnissen anderer repräsentativer Staaten in Verfassungen erklärt er für hohle Theorie und politischen Schwindel. Sein Streben ist, die Verfassung zu einer feudalen Grundlage zu führen, womit folglich nur Geburts-, Geld- und Beamtenaristokratie vertreten würden, das ist in seinen Artikeln offen gesagt, das scheint durch alle seine Reden und Taten durch, und darum artikuliert er in Broschüren und Pamphleten gegen die Wahlordnung und für Einführung eines Zensus. Mit solcher Verfassung ließe sich bequem regieren. Der Fürst bliebe in seiner Stellung, die er in allen Repräsentativverfassungen einnimmt, und wonach er, nach Blittersdorf in der Kammer, gelegentlich der Erwähnung der englischen Verfassung, geäußerten Ansicht eine Null ist. Das Volk, ausgeschlossen von der unmittelbaren Teilnahme an dem Verfassungsleben, wäre ebenfalls Null, und übrig bliebe der Adel, die furchtsamen Reichen, die Geistlichkeit. Letztere kann und darf im Staate nicht herrschen, die Reichen gehen nicht dienen, taugen auch nicht, nach adeligen Begriffen, zu allen Ämtern, wenn sie bürgerlicher Herkunft sind, haben keinen Zutritt bei Hof, können folglich auch keinerlei Einfluss auf den Regenten ausüben, und so bleibt denn der Adel allein übrig, und das ist das System Blittersdorfs. Er benutzt folglich aus der konstitutionellen Staatsverfassung, was in seinen Kram taugt, ebenso aus den Feudalverfassungen und der absoluten Monarchie. Letztere wäre ihm nicht die bequemste, weil er, gegenüber der unbeschränkten fürstlichen Macht, weniger Spielraum hätte.
Das ist aber nichts Neues: so hat es der Adel aller Zehen und Orten gehalten; und der verarmte und arme Adel, erbittert über den Mangel an Glücksgütern (darum umso gefügiger und die herrschsüchtigen Pläne fein anlegend), ist es, der das Spiel um die Herrschaft unternahm. Jedes Blatt der Geschichte bestätigt diesen Satz.
(…)
2 Das war eine Kommission zur Untersuchung „hochverräterischer Umtriebe“ als Teil des von Lothar von Metternich eingerichteten Überwachungssystems, nachdem die Staaten des Deutschen Bundes 1819 auf einer Konferenz in Carlsbad beschlossen hatten, beispielsweise Studenten und Professoren an deutschen Universitäten jede politische Betätigung zu verbieten.
3 „fl.“ Ist die Abkürzung für die süddeutsche Gulden-Währung (im Unterschied zur norddeutschen Taler-Währung). Ein Gulden (fl.) zerfiel in 60 Kreuzer zu je 4 Pfennigen, ein Pfennig waren 2 Heller.
4 Der erzkonservative Politiker setzte im Frühjahr 1841 bei Großherzog Leopold durch, dass zwei Richter, die gerade zu Abgeordneten der Liberalen gewählt worden waren, keine Freistellung („Urlaub“) erhalten, um ihr Mandat wahrzunehmen. Das führte zu einem heftigen Streit zwischen Regierung und Opposition. Anfang 1842 stimmten die Abgeordneten mehrheitlich einem Antrag Johann Adam von Itzsteins zu, der das großherzogliche Verdikt als nicht verfassungsmäßig verurteilte, woraufhin der Großherzog das Parlament auflöste und Neuwahlen ausrief, bei denen die Liberalen jedoch, weil der Urlaubsstreit ihre Wähler mobilisiert hatte, ihren Sitzanteil behaupten konnten – eine schwere Schlappe für von Blittersdorf und seine Regierung.
Die gegenwärtige Lage der Dinge in Europa bietet ein solches Chaos von gegensätzlichen Elementen, Wirren und Widersprüchen dar, dass nur wer sich seines Zieles klar bewusst ist und damit weiß, welcher Mittel man sich bedienen muss und von welcher Stärke sie sein müssen, allein imstande ist, mit Erfolg in die Gegenwart einzugreifen und über die Zukunft ein Prognostikon zu fällen. Nur zwei Parteien sind es, welchen ihr Ziel und die Mittel klar vor Augen liegen, die Partei der Republik und der Despotismus, darum muss auch eine von ihnen den Sieg davontragen, die in der Mitte stehende Partei, die sich mit den Redefiguren „gemäßigt-monarchische“, „konstitutionell-monarchische“, „monarchische Demokratie“ und mit anderen schwatzhaften Stichwörtern breit macht, hat bereits ihre völlige Rat- und Tatlosigkeit auch den Blödesten klar bewiesen. Dem denkenden Menschen war die Unnatur einer Kuppelwirtschaft, zwischen Fürstengewalt und Volksgewalt von vornherein klar, es war ihm klar, dass auf einer solchen Missehe nur krüppelhafte Bastarde hervorgehen können. Diese Partei, welche jetzt das große Wort an sich reißen und mit endloser Schwätzerei den Volksbürger regenerieren zu wollen sich vermisst, will zwar dem Volk eine Summe von Rechten auf dem Papier zusichern, sie will aber auch die Fürstengewalt beibehalten! Sie will mit einem Wort auf zwei Schultern Wasser tragen. Warum, so fragt diese nun der Mann, der nur „Ja Ja“, „Nein Nein“, nur „Wahrheit und Lüge“ und keine liederliche Verblumung des Einen oder des Anderen gelten lässt, warum erkennt ihr denn das Volk als Quelle alles seines Rechts, warum die Souveränität und Majestät des Volkes jederzeit an? Warum erkennt ihr an, dass eine konstituierende Volksversammlung allein das Recht habe, der Nation Grundgesetze zu geben, und wollt im gleichen Augenblick neben der Macht und Herrschaft des Volkes auch eine andere Macht gelten lassen und ihr Rücksichten tragen? Warum sprecht ihr von dem ewigen, ganzen, unteilbaren Recht des Volkes und verweist im nämlichen Augenblick auf seine teilweise Beraubung zugunsten alter Stegreifgeschlechter hin? Warum soll das Volk um einen Teil seiner Macht und Herrlichkeit bestohlen und ihm neben diesem politischen Raub noch ein ewiges Geschwür gemacht werden, welches die besten Kräfte seines Schweißes, seiner Arbeit verzehrt? Wir wollen es dir sagen, du großes, herrliches Volk – die Feigheit dieser Partei ist es, welche dich verkuppeln will. Weiterlesen
Während sie dem Volk, als der alleinigen Urquelle alles Rechts, aller Gewalt, aller Herrlichkeit, von seiner Freiheit und Befreiung in hohlen Phrasen vorbeilavieren, können sie sich der Furcht nicht erwehren, was daraus entstehen könnte, wenn sie den Grundsatz der Volkssouveränität in seiner ganzen, klaren, hohen Bedeutung, in seiner äußeren Form, der Republik, aussprechen. Sie zittern und schlottern in einer doppelten Furcht herum. Sie fürchten einerseits das blutige Vampir-Geschlecht der Monarchie, sie besorgen, dieses könnte mit den letzten ihm zu Gebote stehenden Mitteln unter russischer Beihilfe einen Kampf der Verzweiflung versuchen, obsiegen und sie dann heimsuchen für die Treue gegen das Volk; sie könnten dann ihre Stellen, ihre Pfründe, ihre Praxis, ihre Kunden verlieren; andererseits fürchten sie sich vor dem bewegten Leben der Volksherrschaft und seiner scharfen, wachsamen Kontrolle, wo Schönreden nichts gilt, sondern Rechtshandeln. Sie ziehen daher Samthandschuh an und streicheln links und rechts, schmeicheln rückwärts und vorwärts, nehmen Rücksichten hin und her, packen eben etwas ganz tapfer an und lassen gleich wieder nach, wenn Widerstand und Gefahr drohen; und diese aufgeputzten, politischen Koketten glauben sich berufen und imstande in einer gärenden, revolutionären Zeit, in einer Zeit, welche eine neue Gesellschaft, einen neuen Staat gebären will, zu ordnen, zu schaffen und zu bauen. Eitle, törichte Schwätzer! Nur ein klares Prinzip, ein energisches Verfolgen desselben, vermag unser Volk zu erretten. Der Kampf zwischen Menschenrecht und Menschenwürde und zwischen Knechtung und Verdummung macht seinen letzten Gang, er muss ausgekämpft werden zum letzten Schlag, und ihr wollt vermitteln! Das heißt nichts anderes, als bewusst oder unbewusst auf diplomatischem Wege die Menschheit an die Despotie verraten! Dann mögt ihr Verfassungen machen, so viel ihr wollt, mögt darin aufnehmen, was ihr wollt, setzt ihr einen Fürsten an die Spitze, so wird er trotz dem Schatten eurer Ministerverantwortlichkeit im Laufe der Zeit das Volk betrügen um sein gutes Recht, das sagen euch tausend Blätter der Geschichte.
Die sich nennende konstitutionelle Partei ist demnach ein kampfunfähiges Partei- und Parlamentärgeschlecht, welches zwar die Republik dem Grundsatz nach als die einfachste, naturgemäßeste und allein gerechte Staatsform anerkennt, aber nicht den Mut hat, sie zu proklamieren, zu erkämpfen und mit allen Mitteln zu verteidigen; ein Geschlecht, welches eben wegen seiner Feigheit nicht einmal imstande ist, sein eigenes Kind zu verteidigen, durch fortwährendes Reden, Unterhandeln und furchtsames Nachgeben dasselbe immer weiter und tiefer fürstlichem Despotismus überantwortet, wie wir nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich unter Bourbons und Orleans gesehen haben.
Eine solche Partei von Zwittern ist nun nicht imstande, Deutschland aus der grenzenlosen Verwirrung, aus der Unzufriedenheit aller Parteien, aus dem Versinken und Versiegen aller Wohlfahrts- und Reichtumsquellen zu erheben; und hätte der Despotismus es nur mit ihr zu tun, er wäre längst Sieger. Er fürchtet nur eine Partei, die Republikaner, und fast närrisch klang die feige Klage der Konstitutionellen nach Beendigung der Schilderhebung in Baden, „jetzt kommt die Reaktion“, „der Reaktion ist nun Tür und Tor geöffnet“, was ins Deutsche übersetzt nichts anderes heißt als: Vor uns braucht sich niemand zu fürchten, wir sind bloß Schwätzer, wir konnten, solange die Republikaner noch dastanden, die Esel in der Löwenhaut spielen, jetzt ist alles aus. So stehen sich also in der Tat nur zwei kämpfende, selbstbewusste Parteien gegenüber, die Republikaner und der Despotismus, die in der Mitte laufen dem nach, auf dessen Seite sich der Sieg neigt.
Die deutschen Republikaner müssen daher ihre Stellung, ihrer hohen Risiken völlig bewusst werden, sie müssen sich mit dem Gedanken identifizieren: dass die Stellung des Vaterlandes, sein Bestand, seine Größe nur allein in ihren tätigen und tatenkräftigen Hände gelegt ist. Wir müssen daher die Stellung der beiden alleinigen Gegner genauer ins Auge fassen.
Die Republikaner haben sich für die Einfachheit, Klarheit und Wahrheit ihrer Grundsätze, die eins sind mit dem Menschen in seiner vollen Berechtigung, Anerkennung und Geltung, ausgedrückt in dem Wahlspruch Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Sie haben für sich die Erfahrung. Tausendjährige Bedrückung, Knechtung, Auslaugung und Verarmung haben dem Volke die übertünchten Gräber monarchischer Staatsform aufgedeckt und es in die Tiefen voll Elend und Moder blicken lasse; während es mit wandersüchtigem Sehnen hinüberblickte auf die blühenden Freistaaten diesseits und jenseits des Meeres, an welche tausend Verbindungen des Familien- und Geschäftsverkehrs es knüpften mit stets innigeren Banden.
Sie haben für sich die Einsicht des Volkes in seine materiellen Interessen. Der schlichteste Landmann sieht ein, dass die Staatsform, welche Pracht und Luxus, müßige Müßiggänger, den ganzen Tross des Hofgesindels und Schreibervolkes, die Besoldungs- und Pensionsverzehrer in Legion erheischt, es unmöglich mache, dass der Bürger froh werde seines harten Tagewerkes. Mit einem Wort: Die weitaus größte Mehrzahl der Deutschen sind Republikaner aus Gründen der Erkenntnis, und es bedarf weiter nichts als diese Erkenntnis auf doppeltem Wege zur vollendetsten Klarheit zu bringen und zu befestigen, und sie zur Tat überzuführen. Auf doppelte Weise, indem einmal in Schrift und Tat alle und jede Bedrückung und Betrügerei, welche das Volk unter der monarchischen Staatsform erduldete oder zu gewärtigen hat, tagtäglich aufgedeckt und ihm in lebhaften Farben vorgeführt werde, und das, was es erduldet und ertragen hat, noch duldet und erträgt, ihm pünktlich vorgehalten, der Nimbus, in welchem sich die Fürstengewalt durch allerlei Taschenspielerkünste einzuhüllen strebt, zerrissen, die nackte Missgeburt bloßgestellt und deren Helfershelfer der Verachtung und dem Spott preisgegeben werden, welche ihr alleiniges Verdienst sind. Zum anderen, dass man tagtäglich als Gegensatz zu diesem Treiben der Monarchie die Einfachheit der republikanischen Staatsverwaltung, mit Beilegung von Beispielen aus den glücklich bestehenden Republiken, darlegt, wo keine spürnasige Polizei, kein Heer von Schergen den Frieden stören, wo die Beamten der Justiz und der Verwaltung lediglich Männer aus dem Volke und aus seiner Wahl hervorgegangen, nicht jede Paschadespotie deutscher Amtsleute üben dürfen, wo sie nach umlaufender Amtszeit nicht auf der Pensionsstreu tot gefüttert werden, sondern wie jeder andere Bürger ihr Fortkommen selbst suchen müssen, wo kein brutalisierender Soldatenstand existiert, vielmehr jeder Bürger selbst die Waffe führt und Haus und Herd gegen jeden Angriff schützt; wo endlich der nutzlose, verschwenderische Fürstenprunk nicht existiert und die dafür nötigen harten Taler dem Volksverkehr verbleiben.
Dieses alles also, was jeder fühlt, denkt, weiß, soll er sich täglich vorhalten und sagen, anderen mitteilen und einen Blick werfen auf unsere zerrissenen, verwildernden und verdorbenen Zustände, unsere verschuldeten Felder und unsere verpfändeten Hütten, den festen, energischen Beschluss fassen – und zur Tat werden lassen, dass in seine Hände es gelegt sei, die heimatliche Erde zu befreien, einzureißen den alten Kerkerbau und statt Kinder und Enkel mit gebundenen Händen den Drängern zu überliefern, ihnen die deutsche, befreite Erde als ein Erbe zu hinterlassen, wo sie freudig sich Hütten bauen und ihrer Arbeit froh werden können. Und ist es denn ein so großer Schritt, eine kurze Zeit entscheiden zu wollen, auszurotten die alte Wildnis, und dann für Generationen hinaus beglückend gewirkt zu haben? Fürwahr die Arbeit ist nicht größer, als einen Sumpf trocken zu legen, ein Bergfeld zu roden oder einen alten Wald anzustecken.
Und wer sind denn eure Gegner, wer sind die Despoten und ihre Knechte? Leiten auch sie jene hohen Ideen der Befreiung und Beglückung aller Menschen; leiten auch sie die süßen Gefühle, Kindern und Kindeskindern von Millionen freie, friedliche, glückliche Hütten zu bauen? Leitet sie nicht vielmehr die kaltherzige und erbarmungslose Herrschsucht, welche den Schweiß des Mannes und die Tränen der verpfändeten Witwe in schwelgerischen Gelagen, rauschenden Festen, eitlen Paraden und menschenschlächterischen Heerzügen aufgehen lässt, sind es nicht die niederen, schwarzen Leidenschaften, ist es nicht eine Höllenmacht des Herzens, mit welcher sie wirtschaften? Verflucht sei euer Sohn, welcher im Dienerrock oder Soldatenkleid sich stellt gegen das Volk, gegen Vater und Bruder, verflucht sei das Geschlecht, welches sich hergibt zur Entwürdigung des göttlichen Ebenbildes, des Menschen, und Fluch aus tiefstem, zitterndem Herzen über die, welche hereinbrechen gegen die Satzung des Menschenrechts, der ewigen Liebe, der Freiheit und der Gleichheit aller. Und ihr zögert, und ihr wählt und rechtet noch gegenüber solchem Gegner? – Zögert ihr noch und wählet, wenn der Wolf in eure Herde brechen, wenn der Räuber eure Habe vergewaltigen und eure Wohnungen niederbrennen will? Und werdet ihr nicht täglich aufgezehrt und beraubt, und steht nicht im Hintergrund der Polizeiknecht, der Wander- oder Bettelstab? Und ihr zögert und hofft auf einen Erlöser in Gestalt eines Parlaments neben 34 Fürsten und einen 35sten Kaiser. Habt ihr die Pracht und die Gewalt über euch noch nicht genug genossen? Wollt ihr schaffen noch mehr Pracht und setzen eine neue, größere Gewalt über euch?
Aber – in deine Hände, o Volk, ist gelegt deine Errettung und deine Erlösung, in deine Hand, du mutige Schar republikanischer Männer. Denn während man redet und tagt und tagt (…), sammeln die Despoten ihre bezahlten Schergen enger um sich, reichen dem Russen hinter dem Rücken des Volkes die Hand zum Bunde.
Mit hunderttausenden von Sklaven, mit Kosaken, Baschtuken und Tartaren, mit wildem Raubgesindel steht er an der Pforte, um hereinzubrechen und die Fürsten einzusetzen in die rachedurstige Macht und dich rückzuführen in eine Knechtschaft, härter als die Israels war unter Pharao, um wieder zu bauen ein verwüstetes Land.
Während in nutzlosen Einzelkämpfen das Volk nach seinen Rechten, nach Erleichterung von seinen Lasten ringt, steht der Russe lauernd an den Pforten, um über das ermattete Volk im rechten Zeitpunkt herzufallen. Mitleidlos sehen die befreiten Völker auf unsere Not, der Freie achtet nur den Freien. –
Es bleibt nur eine Wahl. Sobald den deutschen Fürsten der rechte Zeitpunkt gekommen scheint, sobald das Parlament nicht nach ihrer Pfeife tanzt, sobald der Ehrgeiz um die Oberherrschaft in Deutschland nebenbuhlerisch wird und der fürstliche Despotismus mit den Russen im Bunde auftritt, in demselben Moment rückt der Franzose in die deutschen Marken, und das deutsche Volk hat die Freien nicht zum Freunde und die Despoten zu Feinden, auf unserer Erde, mit unseren Kräften und unserem Blut werden die gewaltigen Gegner sich bekämpfen.
Friedrich Hecker
Jede Revolution, welche vom Gebiet der Tat hinübergleitet auf den Boden der Diskussion zehrt sich auf und wird von derjenigen Macht, welche durch die Revolution gestürzt werden sollte, mit den Mitteln der Intrige, der Bestechung, des Zögerns und Hinhaltens, mit einem Worte durch das Spiel politischer Betrügerei ausgebeutet und zu Grunde gerichtet.
Aufgabe eines jeden Volles, welches sich erhebt aus der tiefen Erniedrigung, aus der Knechtschaft und Unterdrückung ist es, die feindliche Macht, unter deren Druck es geschmachtet und gelitten hat, und gegen welche es sich erhebt, vollständig zu zerbrechen, provisorisch die Grundlagen des neuen Freiheitsbaues zu legen und erst, wenn die Revolution siegreich ihre Fahne wehen sieht über der zerbrochenen tyrannischen Gewalt, erst dann kann die Beratung des neuen Staatsorganismus beginnen; das alle muss so gründlich vernichtet sein, dass eine Wiederlehr nicht möglich wird, dann erst kann der junge Freiheitsbau vollendet werden. Weiterlesen
Ewig wahr ziehen die Sätze durch diese Geschichte aller Revolutionen, und alle Revolutionen gegen die menschenentwürdigende Herrschaft eines Einzelnen, gegen die Monarchie, gingen unter, wenn das Volt, statt die Revolution mit allen revolutionären Mitteln zu vollenden, sich auf das Verhandeln und Unterhandeln, auf lange Reden und bodenlose Schwätzerei einließ. Mit der Monarchie ist kein Vertrag möglich. Gegen fürstliche Tyrannei gibt es nur das einzige Mittel, völlige Vernichtung der Monarchie.
Diese durch Erfahrung von Jahrtausenden erprobten Axiome standen mir klar vor der Seele im politischen Leben, sie traten in Riesengestaltung vor mich, als Frankreich, welches alle Formen der Monarchie, von der Despotie des XIV. Ludwigs bis zu der gaukelspielerischen Betrügerei der konstitutionellen Monarchie durchlebt hat, sich erhob und das Königtum stürzte. Welchen Anteil ich an der Bewegung, an der Erhebung Süddeutschlands genommen, wie ich sie mit aller Begeisterung, Ruhelosigkeit und Energie, deren ich nach meiner geringen Kraft fähig bin, gefördert, getrieben und nur in ihr gelebt habe, das ist Vielen bekannt; es galt jetzt den Gedanken, der Tag und Nacht mein Begleiter war, zur Tatsache werden zu lassen. (…)
Der 24. Februar zuckte elektrisch durch unser unglückliches niedergeworfenes Volk, die Bewegung brach los, es verlangte klare Rechtsbriefe, die revolutionäre Kraft und Begeisterung strömten aus der Tiefe auf, die 38fache Zersplitterung hinderte die Gesamtentfaltung und die Benutzung der in 38 Staaten arbeitenden revolutionären Kraft, jedes Land und Ländchen arbeitete für seine eigene Rechnung, die zitternden Fürsten, ihre gegliederte Diplomatie und Bürokratie waren, wenn auch zurückgedrängt, eingeschüchtert, immerhin noch organisiert, und dass sie (…) ihre Verbindung umso enger knüpften, konnte man als gewiss voraussetzen, denn es galt ihrer Existenz, die Selbsterhaltung musste sie dazu treiben.
Das Volk fühlte selber diesen Zustand der Zersplitterung seiner Revolutionsarbeit, es verlangte nach einem Sammelpunkt. Einen solchen Sammelpunkt, in welchem die 38fach gespaltene revolutionäre Kraft föderiert über das Ganze der 38 Staaten zu wirken im Stande war, konnte nur eine revolutionäre Versammlung abgeben, welche mir kraft revolutionären Willens, ohne allen Anstrich einer Fußung auf den Gesetzen der alten Staatsform, zusammentrat. Diese Versammlung war das Vorparlament, dieses musste permanent bleiben; man konnte in dasselbe fort und fort neue Kräfte berufen, diese Versammlung musste das Steuer in die Hand nehmen, sie musste provisorische Dekrete erlassen und die Grundlagen legen. Aber sie musste, um letzteres zu können, permanent bleiben; und blieb sie beisammen, so musste sie mit jedem Tage energischer vorwärts gehen, denn sie stand auf keinem anderen Boden als dem der Revolution; was sie geschaffen und vollbracht, konnte sie als Erbe einem konstituierenden Konvent übergeben, der aus der Volkswahl hervorging. Ich sah es klar, dass die Revolution nur gerettet, rasch und energisch vollendet werden könne durch die Permanenz, und stellte den Antrag – er fiel, nur Waffengewalt konnte jetzt noch entscheiden. Das war meine feste Meinung. Ich bin überzeugt, dass Fürsten und Diplomaten aufatmeten, als sie sahen, dass die Permanenz verworfen worden war und die Revolution auf das Feld der lokalen Schwätzereien verwiesen werden sollte, sie hatten Zeit gewonnen, und Alle, welche gegen die Permanenz auftraten oder stimmten, haben die Revolution, haben das Volk verraten! Jetzt galt es die Revolution durch die Revolution zu retten, wir erhoben uns in Baden. Die Erkenntnis der Faulheit der üblen Zustände war in Baden, war in Deutschland vorhanden; das Volk hatte in Versammlungen und Einigungen dieses laut erklärt, es hatte zur Tat aufgefordert, es gehörte nichts als der Mut der Tat zu dem Mute des Wortes, es gehörte Aufopferungsfähigkeit dazu, und eine Erhebung in Masse hätte ohne Schwertstreich die Revolution zum Sieg geführt, das stehende Heer, dessen Disziplin gänzlich dahin war, wäre bei einem Aufstand in Masse dem Volk nicht entgegengetreten, und wäre dann unter flatternden Fahnen der Republikaner die Wahl zur konstituierenden Versammlung des deutschen Volkes vorgenommen worden, ein Nationalkonvent voll großartiger Energie und schöpferischer Kraft hätte im Bündnis mit Frankreich Europa neu gestaltet.
Wir standen auf – wir unterlagen, weil bei dem Volk der Mut der Tat nicht mit dem Mut des Wortes gleichkam.
„Wir wollen das Parlament abwarten!“
Nun, ihr habt euer Parlament! Seid ihr frei? Seid ihr glücklich? Ihr habt den Vertröstern auf das Parlament mehr Gehör geschenkt als denen, welche mit dem Schwerte auszogen und euch voraussagten, fast wörtlich voraussagten, was das Parlament euch bringen werde, und – seid ihr frei, seid ihr glücklich?
Als die Erhebung für die deutsche Republik aber unterlegen war, eu wurden die Besiegten geschmäht und gehöhnt (…). Bald sah das Volk ein, dass seine Errungenschaft sich in nichts auslösen würde, und ich habe in fast jedem meiner leitenden Artikel des Volksfreundes die Lage der Dinge und was die Zukunft bringen werde, dargelegt und vorausgesagt.
Was tat das Volk? Sorgte es für seine Bewaffnung, scharte es sich auf seinen Sammelplätzen mit der Entschlossenheit zu handeln? Ihr klagt über Reaktion? Was ist Reaktion? Reaktion ist nichts anderes als die Entfaltung der Tätigkeit der friedlichen politischen Partei. Ist eine Reaktion möglich, wenn das Volk wach und tätig ist? Nimmermehr! Wer über Reaktion klagt, der klagt nur über seine eigene Feigheit und Untätigkeit, stellt sich selbst ein Armutszeugnis aus. Der Feind kann sich nicht erheben, wenn ich selbst ihm keine Muße, keine Zeit lasse, sich zu sammeln Während wir, die wir mit dem Schwert aufgestanden, im Stich gelassen und an den Strand geworfen waren, mit tiefem, verzehrendem Schmerz, mit dem herbsten Groll und heißem Ingrimm über die Grenze nach den waldigen Bergen, nach den schönen Tälern des Vaterlandes, das uns ausgestoßen hatte, blickten, und harrten der Tatkraft des Volkes, welches das Schiff des Volksstaates wieder flott machen und seine geächteten Söhne an Bord nehmen sollte, während wir in den aus dem tiefsten Hetzen entströmten Zurufen Ansprachen, Proklamationen neu appellierten an die Begeisterung, an die Scham, was ist geschehen? Die Menschen machen die Ereignisse, sie fallen nicht vom Himmel, hilf dir selbst, so wird dir Gott helfen; helfen kann nur die gewaltige Tat, die revolutionäre Volkstat, nicht das Hoffen und Harren, nicht papierne Adressen und Petitionen, nicht Festschmäuse und Toaste, nicht das Singen von Heckerliedern und anderen Gesängen. Mit bitterem Schmerz um Volk, Vaterland und Freiheit habe ich seit Monaten am Strande der Verbannung gelegen und zurückgeblickt auf ein bewegtes, tätiges, arbeitsames öffentliches Leben, auf den Strom der Revolution, auf welchem ich mit am Ruder gesessen (…). Ich muss ein Feld der schöpferischen Wirksamkeit, der Tätigkeit bauen, ich kann nicht müßig liegen, versiechen, verkümmern; ich kann nicht zehren und glücklich sein in der Feier meines Namens, ich bin von jeher ein Feind von Personalhuldigungen gewesen, das Volk soll sich nicht an Namen hängen, es soll sich begeistern, erglühen für die Tat der Befreiung, es soll handeln, handeln, dann können auch die Geächteten wieder unter euch treten, wieder mitarbeiten zur Errichtung des Freistaates, zur Gründung der deutschen Republik. Wer aber die Hände in den Schoß legt oder bei Wein und Schmaus nur die Faust macht und droht, „wart‘ nur, wenn die Verbannten kommen“, der hat seine Schuldigkeit nicht getan, im Gegenteil, er beweist damit, dass er ein großes Maul, aber ein kleines Herz habe, denn er weiß recht wohl, dass ein einziger Mann, dass ein Häuflein verbannter Männer allein ihm die Republik nicht bringen können, dass das Volk sie sich nehmen muss; dass der Freiheitsdrang sich tatsächlich kund geben und es uns zeigen muss, wie es ernstlich will, und so uns eine Gasse bahnen, auf dass wir wieder mitkämpfen und ringen, einreißen und bauen können. Eine bessere Musil als die Hochs und Vivats, als die Lieder und Trinksprüche ist das Klirren der Waffen für die Freiheit entschlossener Männer, ist das grollende Murren und das wilde Rufen einer versammelten, zur Durchsetzung ihres Rechtes entschlossenen Menge. Eure Tyrannen haben das Zittern noch nicht verlernt, verlernt ihr das Handeln nicht!
Aber ebenmäßig zum Überdruss wie zum Schmerze wirkt es, wenn man statt der Handlung nur großprahlerisches Maulen wahrnehmen und in der Erwartung, tätig wirken zu können, ebenso getäuscht wird, als es mit den Akklamationen, Deputationen, Versicherungen und Aufforderungen im Frühjahr vor dem Aufstande der Fall war. (…).
Die öffentlichen Blätter sagen euch, ich habe vor, eine Reise zu dem größten und freiesten der Völter zu machen, welches im Begriff steht, die am alle vier Jahre wiederkehrende, das ganz Volk in Bewegung setzende Handlung der Präsidentenwahl vorzunehmen. Die öffentlichen Blätter haben wahr geredet, und ohne mein Vorwissen hat der zweite in Rheinfelden wohnende Redakteur der „Volksfreundes“ einen Artikel abdrucken lassen, welcher einen Zweifel an meinem Vorhaben erwecken könnte.
Ja, ich will eine Reise unternehmen zu jenem gewaltigen Bürgervolk, welches von Völkern der alten Welt zuerst das Licht der Freiheit angezündet und der republikanischen Freiheit die Weltherrschaft sichern wird, ich will nicht in verzehrender Untätigkeit oder eitler Projektemacherei an den Grenzen Deutschlands müßig liegen, und zerrütten an Geist und Leib, kein verkommender und verkommener Flüchtling sein oder werden. Ich will mit eigenen Augen sehen und erforschen die Einrichtung jenes größten und freiesten der Völker, ich will und hoffe dorten tätig sein und wirken zu können für das Land, aus welchem wir republikanische Fluchtlinge ausgestoßen liegen im Exil. Erhebt sich Deutschlands Volk zur republikanischen Tat gedenkt es seiner Söhne, welche zuerst ausgezogen sind für die deutsche Republik, dann noch will es ihre Kraft benutzen, schnell ist der Ozean durchfurcht, zwei Wochen reichen hin, und die Verbannten können unter euch sein, und neu gestärkt durch das Leben unter jenen tapferen Männern der vereinigten Staaten, reich an Erfahrungen durch eigene Anschauung jenes großen Staatsverbandes von 30 Republiken, neue Kraft dem Vaterland zubringen.
Schart euch um die Männer, welche das Banner der Volkssouveränität hoch und bei demselben treue Wache halten, um die Männer der äußersten Linken zu Frankfurt a. M., schließt euch in Rat und Tat fest an die tapferen Führer der republikanischen Schilderhebung, ihre Namen seien euch feste Gedenksäulen, von ihnen werdet ihr meine Nachrichten, Berichte und briefliche Mitteilungen über die Erlebnisse in der Union erfahren.
Breitet aus die Saat, welche diesen Frühling gesät wurde, bereitet die Tat, dass die sich die Schwester- Republiken der Vereinigten Staaten Amerikas und Deutschlands die Hände reichen mögen zum festesten Verbande, den Völkern allen zur Befreiung.
Sie werde, die deutsche Republik!
Der badische Landtag von 1842, in Georg Herwegh: Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz. Kritik der preußischen Zustände, Zürich und Winterthur 1843, S. 33ff; Nachdruck Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1989, S. 108-135.
Die staatsrechtlichen Verhältnisse der Deutschkatholiken mit besonderem Hinblick auf Baden, Verlag Julius Groos, Heidelberg 1845, S. III-VIII und S. 1-38.
Nur die Republik ist Deutschlands Rettung (Flugschrift 1848). Frankfurt a. Main 1848, Universitätsbibliothek Frankfurt a. M., Signatur Sf 16/108, Nr. 1.
Die Erhebung des Volkes in Baden für die deutsche Republik im Frühjahr 1848, Reprint (der Ausg.) Schabelitz, Basel 1848; Köln: ISP, 1997.
Des Menschen Recht. Vorrede zur deutschen Ausgabe (1851) des 1791 auf Englisch erschienenen Buches von Thomas Paine: Die Rechte des Menschen. Eine Antwort auf Burke’s Angriff gegen die französische Revolution, Arnoldische Buchhandlung, Leipzig 1851.
Abschieds-Worte an das deutsche Volk, Beilage zu Nr. 15 der Dresdner Zeitung für sächsische und allgemein deutsche Zustände, 18. Oktober 1848.
Reden und Vorlesungen, Wentworth Press 2018.
Sabine Freitag: Friedrich Hecker. Biographie eines Republikaners, Franz Steiner Verlag 1998.
Kurt Hochstuhl: Friedrich Hecker. Revolutionär und Demokrat, Verlag Kohlhammer 2011.
FRIEDRICH HECKER

Abb.: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, LMZ318867
Friedrich Hecker, promovierter Jurist – ungestümer revolutionärer Vollbart, Charismatiker, genialischer Redner, der gern bewaffnet und mit breitkrempigem Hut mit roter Feder, dem „Heckerhut“, auf die Rednerbühne tritt – ist 1848 der wohl berühmteste aller deutschen Revolutionäre. Als lupenreiner Demokrat hatte er bereits vor der Revolution für Freiheit, Einheit und eine Lösung der „Soziale Frage“, für den Kampf gegen Armut und Hunger von Millionen Deutschen gestritten. Nun, ab dem Ausbruch der Revolution im Februar 1848, gilt sein Wirken nur noch einem: der Errichtung einer deutschen demokratischen und sozialen Republik. Die Menschen verehren ihn, er ist der große demokratische Star: leidenschaftlich, dabei höchst reflektiert, entschieden, aber auch die Bedenken wägend. So votiert er gegen einen bewaffneten Aufstand, als er nahe lag; erst als er und sein radikal-demokratischer Gefährte Gustav Struve von Verhaftung bedroht sind, rufen sie ihre Getreuen in Baden zu den Waffen; es folgt der sogenannte Heckerzug. Der „rechte Moment“ allerdings, nach dem sie suchten, war da wohl vorbei. Nach einem letzten verzweifelten Gefecht gelingt ihm die Flucht in die Schweiz und schließlich in die USA, wo er, hochgeachtet als „Forty Eighter“, sein demokratisches Engagement, seinen Kampf um Volkssouveränität und Menschenrechte als Offizier der Nordstaaten-Armee fortsetzt.
Friedlich Heckers Schriften zeichnen das differenzierte Bild eines Mannes, der von der fürstlichen wie liberal-konstitutionellen Propaganda als „Radikaler“, „Terrorist“ und „Verbrecher“ diffamiert wurde.
Am 28. September 1811 wird Friedrich Karl Franz Hecker in Eichtersheim geboren und wächst in einem bürgerlich-liberalen Elternhaus auf. Der Vater, Josef Hecker, ist ein königlich bayerischer Hofrat.
Nach der Schulzeit in Eichtersheim und Mannheim studiert Hecker in Heidelberg und München Jura und schließt das Studium im Juni 1834 als „Doctor iuris“ ab.
Zunächst im Staatsdienst tätig, wird Hecker 1838 am Badischen Obergericht als Advokat zugelassen; hier lernt er Gustav Struve kennen, einen Amtskollegen am selben Obergericht. Als Anwalt vertritt er u. a. die Rechtsansprüche armer Bauern gegen adelige Grundbesitzer.
Auf Empfehlung Adam von Itzsteins, einer führenden Persönlichkeit des süddeutschen Liberalismus, wird er in die Zweite Badische Kammer in Karlsruhe gewählt und steigt dort schnell zum Wortführer der demokratischen Opposition auf.
Auf der Offenburger Volksversammlung fordert er offen eine deutsche Republik und kritisiert, angesichts grassierender Hungersnöte, mit scharfen Worten das Missverhältnis zwischen arm und reich.
Die Zweite Offenburger Volksversammlung am 19. März 1848 verabschiedet zwar auf Initiative Heckers ein revolutionäres Programm, um die politische Macht zu übernehmen, doch können sich Hecker und Struve damit im Frankfurter Vorparlament (31. März bis 3. April) nicht durchsetzen. Als sie daraufhin auch nicht in die Nationalversammlung gewählt und stattdessen Mitstreiter verhaftet werden, rufen sie ihre Anhänger am 13. April zu den Waffen.
Dem „Heckerzug“, der anfänglich nur aus wenigen Dutzend Freischärlern besteht, schließen sich in der Folge rund 800 Männer an, die allerdings schlecht ausgebildet und unzureichend bewaffnet sind und von den Truppen des Deutschen Bundes bei Kandern im Südschwarzwald entscheidend geschlagen werden. Hecker gelingt die Flucht in die Schweiz und emigriert von dort aus über Straßburg am 20. September in die USA.
Hecker erwirbt eine Farm in Illinois, wo er Wein anbaut und Viehzucht betreibt, bleibt aber weiterhin politisch aktiv und engagiert sich für die Abschaffung der Sklaverei. Im Sezessionskrieg (1861-1864) setzt er als Offizier der Nordstaatenarmee seinen Kampf um Menschen- und Freiheitsrechte fort.
Friedrich Hecker stirbt im Alter von 69 Jahren. Sein Grabstein befindet sich in der Nähe seiner Farm in Summerfield/Illinois – und trägt die Inschrift: Friedrich Hecker, Kommandeur des 82. Infanterieregiments des Staates Illinois.
Antonia Grunenberg
Eigentlich müsste seine Statue vor dem alten Reichstagsgebäude in Berlin stehen, dem heutigen Bundestag: Friedrich Hecker, Demokrat der ersten Stunde, Kritiker der deutschen Reichsgründung unter preußischer Führung, hellsichtiger Mahner und begnadeter Spötter.
Als der Reichstag 1894 nach mehr als zehnjähriger Bauzeit endlich fertig war, symbolisierte er den Triumph der deutschen Monarchie über die demokratische Bewegung, deren bekanntester Kopf Friedrich Hecker 1848 gewesen war.
Doch wer kennt Friedrich Hecker heute noch, von Historikern und Historikerinnen einmal abgesehen? Einige Geschichtsliebhaber wissen, dass es ein Hecker-Lied sowie einen Hecker-Hut gibt und dass 1848 ein „Hecker-Marsch“ stattgefunden hat. Viel mehr ist über diesen unvergleichlichen Revolutionär nicht bekannt. Zu Unrecht, wie die hier versammelten Texte deutlich machen. Friedrich Hecker war ein für die Geschichte der deutschen Demokratie weit bedeutenderer Mann als Otto von Bismarck, vom deutschen Kaiser ganz zu schweigen. Weiterlesen
Friedrich Karl Franz Hecker, 1811 in Echtersheim im Großherzogtum Baden geboren und 1881 in Summerfield/Illinois gestorben, war schon überzeugter Demokrat, als in deutschen Landen die Leute begannen, von politischer Freiheit zu reden. Was trieb ihn um, den Kämpfer aus dem Badischen, der den Deutschen helfen wollte, sich aus jahrhundertelanger Unterdrückung zu befreien?
Hecker kam aus einem liberal-bürgerlichen Elternhaus, besuchte das Gymnasium und studierte Rechtswissenschaft. Seine Ausbildung führte ihn zum Anwaltsberuf. Doch sein Interesse galt der Politik. In der Folge übernahm er kleinere politische Ämter und fiel auf, weil er ebenso leidenschaftlich wie überzeugend sprechen konnte. Das brachte ihm den Posten eines Abgeordneten in der Zweiten Badischen Kammer in Karlsruhe, der Hauptstadt des Großherzogtums Baden ein.
Die zwanziger und dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, in denen er heranwuchs, sah er im Rückblick als Zeit des Stillstands, geprägt von einer Atmosphäre des „Anhündelns“; so nannte Hecker das buckelnde Postenschachern an den Fürstenhöfen. Opportunismus und Feigheit, so erinnerte er sich später, hätten in der Politik vorgeherrscht, und zwar auch und gerade in liberalen Kreisen. Einflussreiche politische Persönlichkeiten seiner Zeit bedachte er mit Invektiven wie „aufgeputzte politische Koketten“ oder „eitle, törichte Schwätzer“. Man kann sich gut vorstellen, wie Hecker in jungen Jahren mit der damaligen demokratischen Studentenbewegung sympathisierte. Er hatte ein feines Gefühl für den Zeitgeist; und der verkündete von vielen Dächern in den deutschen Ländern, dass Herzöge, Grafen und Könige rasant an Vertrauen verloren. Sehr viele im Volk, vor allem im Großherzogtum Baden, wollten nicht mehr geradestehen für den fürstlichen Prunk und die Apanagen der Hofschranzen, für die Gehälter und Pensionen ihrer Beamten.
Als aufgeklärter Bürger glaubte Hecker, der Mensch sei von Natur aus befähigt, vernünftig zu denken. Daher sollten die Bürger wichtige Entscheidungen, die das Zusammenleben aller beträfen, nicht in den Händen von Monarchen und deren Regierungen belassen. Der Advokat Hecker war überzeugt, dass seine Mit-Menschen sich selber vernünftige Gesetze für ihr Zusammenleben geben könnten.¹ Und so liegt ein Schwerpunkt seiner Reden und Schriften in der oft wiederholten Maxime: Religion ist keine Staats- und auch keine monarchische Angelegenheit, sondern Privatsache. Jedem sein eigener Gott ‒ und der war nicht politisch, weil außerhalb des Irdischen angesiedelt. Damit stellte Hecker die angeblich gottgegebene Autorität der Monarchen in Frage und setzte an ihre Stelle die naturgegebene Selbstverantwortlichkeit der Bürger. In seinen Überlegungen zur Verfassung einer freien Gesellschaft bilden diese Maximen das Fundament: Monarchie ist unvernünftig, Demokratie ist vernünftig, aber nur möglich ohne Staatsreligion. In den vierziger Jahren wuchs die demokratische Bewegung überall an. Hecker und seine Freunde Johann von Itzstein, Gustav Struve, Heinrich von Gagern oder Friedrich Bassermann taten sich mit Gleichgesinnten zusammen. Sie gründeten politische Debattierklubs und beschlossen schließlich, öffentlich für eine Verfassung einzutreten, in der die Rechte des Volkes neu geregelt würden. Es galt, in den Ländern, allen voran in Baden, eine demokratische Verfassung zu erarbeiten und eine dem Volk verantwortliche Regierung zu bestellen. Also sollte zunächst ein Vorparlament ernannt werden, dann freie Wahlen ausgeschrieben und ein ordentliches Parlament gewählt werden, aus dem heraus eine unabhängige Regierung bestellt werden konnte.
Welche juristischen und politischen Instrumente es dazu brauchte, das konnte man bei den Franzosen abschauen, die schon zwei Revolutionen hinter sich hatten und im Februar 1848 erneut gegen die Monarchie aufstanden. Oder man blickte nach Amerika, wo die Verfassung nach einem Unabhängigkeitskrieg gegen die englische Kolonialmacht in öffentlicher Debatte geschaffen worden war.
Doch an der Frage, wie man mit den angestammten Königen, Großherzögen und Grafen und deren machtgestützten Netzwerken umgehen sollte, spaltete sich die Bewegung. Die Mehrheit der Liberalen, zu denen Gagern und Bassermann gehörten, wollte einen Kompromiss: Verfassung ja, aber mit Zustimmung der Monarchen. Das Volk verursache nur Unruhe, müsse also in Schach gehalten werden, argumentierten die Liberalen. Hecker und seinen Freunden war klar, dass dieser Kompromiss faul war. Sie bestanden darauf, dass die monarchische Herrschaftsform gänzlich abgeschafft gehöre – und liefen gegen eine Wand der Ablehnung. Letztlich unterlagen sie den Ränkespielen ihrer Gegner so deutlich, dass selbst das Volk sich zurückzog. Ein letzter Versuch Heckers, mit einer Menge von bewaffneten Bürgern in die Hauptstadt des Großherzogtums Baden, nach Karlsruhe, einzuziehen, scheiterte kläglich am Mangel von Mitkämpfern. Es kamen nicht mehr als 800 Männer zusammen, die im Kampf mit den örtlichen Truppen hoffnungslos unterlagen; Hecker floh in die Schweiz.
Am Ende siegten die Liberalen im Verein mit den Monarchisten. Ihnen kam es ohnehin mehr auf den ungehinderten Warenverkehr an als auf eine freiheitliche politische Ordnung. Sie betrachteten die Politik als Wegbereiterin wirtschaftlichen Wachstums. Entscheidend waren für sie die wirtschaftspolitischen Freiheiten, die sich erst in einem einheitlichen Wirtschaftsraum entfalten könnten. Also votierten sie für den Kompromiss, den die radikalen Demokraten für grundfalsch hielten: eine konstitutionelle Monarchie unter Preußens Führung, will heißen, unter einem preußischen König. Der aber machte sich öffentlich lustig über die Abgeordneten, die ihm den Entwurf einer demokratischen Verfassung überreichen wollten.
Am Ende erreichten die Liberalen den Fortbestand der Monarchie in deutschen Ländern samt pseudoparlamentarischer Verfassung. Die Fürsten waren erleichtert, am lautesten lachte der preußische König. Die Reichseinigung unter einem preußischen Kaiser brachte dann im Jahre 1871 den deutschen Ländern den endgültigen wirtschaftlichen Zusammenschluss, aber eben nicht die politische Freiheit ihrer Bürger.
Das Programm der sogenannten radikalen Demokraten, die sich nicht von den Liberalen einfangen ließen, trug Heckers Handschrift:
- Abschaffung aller monarchischen Steuern und Abgaben; sei das geschehen, würde das Volk freiwillig Steuern nach Maßgabe des Verdienstes zahlen;
- Enteignung allen monarchischen Grundbesitzes; Überführung in Volkseigentum unter staatlicher Verwaltung mit anschließender Bodenreform inklusive Landverteilung an arme Bauern;
- Staatsbeamte (Richter und Verwaltungsbeamte) sollten vom Volk gewählt werden, ihre Entlohnung maßvoll sein; nach Ablauf ihrer Dienstzeit sollten sie ohne Pension zurück in den Privatstand treten und ihrem Beruf nachgehen;
- Bildung einer Regierung durch gewählte Volkskommissare, die von der Nationalversammlung zu bestellen seien;
- statt einem stehenden Heer solle ein Volksheer aufgestellt werden.
Dieses politische Gebäude sollte vom freien Zusammenschluss aller deutschen Länder zu einer föderalen Republik mit demokratischer Verfassung gekrönt werden.
Hinzu trat die Garantie persönlicher Freiheiten: Religionsfreiheit, Presse- und Meinungsfreiheit.
Die Eckpfeiler der auswärtigen Politik sollten durch Vertragsabschlüsse mit anderen freien Staaten (Frankreich, Amerika, Schweiz) gebildet werden.
Die Kernaufgaben des Staates fasst Hecker lakonisch in drei Punkten zusammen: Der Staat muss
1. die Religion privatisieren,
2. die Freiheitsrechte aller garantieren und
3. das Individuum vor Übergriffen, auch den staatlichen, schützen.
Das Ziel der Umwälzung der politischen Ordnung sei es, einen „menschenwürdigen Zustand der Freiheit“ zu begründen. Heckers radikale Absage an die Monarchie war mehr als nur Ausdruck eines aufklärerischen Idealismus. Er nahm die Not der Bauern und der städtischen Bevölkerung realistisch wahr; das liest man in seinen Schriften. Er wusste, was er sagte, wenn er die Abgabenlast der „Zehnten, Frohnden, Rabatte, Gülten, Zinsen, Zwangsgerechtigkeit und andere(r) Grundlasten“ für überlebt und kontraproduktiv erklärte. Schließlich lebte man mitten im beginnenden Industriezeitalter. Durch die vielen Steuern und Abgaben war das Bürgertum in seinem Tatendrang blockiert, das wurde den Handwerkern, Laden- und Manufakturbesitzern immer dann klar, wenn sie nach England blickten, wo die industrielle Revolution seit über einem halben Jahrhundert im Gange war. Weder gab es einen gemeinsamen Markt noch eine gemeinsame Währung, weder allgemein gültige Maßeinheiten noch durchgehende Eisenbahnlinien, geschweige denn Bewegungs- bzw. Reisefreiheit. Viele materielle Gründe sprachen für die Abschaffung der monarchischen Regimes in deutschen Landen. Von den armen Leuten gar nicht zu sprechen, die aufgrund der Abgaben keine Chance hatten, aus der Armut herauszukommen. Daher unterstützten vor allem in Baden nicht nur tatendurstige reiche, sondern auch mittellose arme Bürger Hecker und seine Getreuen anfangs.
Das demokratische Programm war für alle deutschen Staaten gedacht. Der Prozess der Demokratisierung war eng mit der Vereinigung der deutschen Staaten verbunden. Demokratie in nur einem der zahlreichen deutschen Staaten, das war nicht möglich, darin stimmten die Liberalen mit den Demokraten überein. Im Grunde war die deutsche Zersplitterung – 38 Staaten mit ebenso vielen monarchischen Höfen ‒ ein Überbleibsel aus dem Feudalismus. Der deutsche Staatenbund (Deutscher Bund) von 1815 hatte diese Einigung natürlich nicht erreichen können, da er nicht mehr als ein Zweckbündnis der Fürsten gegen das Volk sei, argumentierten die Demokraten.
Eine aus freiem Entschluss der Bürger erreichte deutsche Einheit war etwas völlig anderes. Das künftige Deutschland sollte ein freier föderaler „Volksstaat“ sein: also Einheit in Freiheit – und nicht Einheit ohne Freiheit, wie es dann 1871 geschah.
Zu Heckers Zeit gärte es rings um Deutschland herum. Man musste nur über den Rhein schauen, um das europäische Vorbild eines demokratischen Aufbruchs zu sehen: Frankreich. Gleichwohl mussten die Franzosen dreimal ‒ 1789, 1830 und 1848 ‒ revoltieren, ehe es ihnen gelang, eine Republik der Bürger zu etablieren. Erst die dritte Revolution brachte die Befreiung von der adeligen Pfründenwirtschaft. Das hätte Hecker und den Seinen zu denken geben können.
Die Schweiz war auf dem Weg von einem Staatenbund zu einem republikanischen Bundesstaat; aber auch dort wurde dieser Prozess regelrecht ausgekämpft. Im Habsburgischen Reich brodelte es. Der ungarische Adel und das dortige Bürgertum wollten mehr Selbständigkeit. Fast überall in Europa blühten demokratische Bewegungen auf. Die Völker spürten, dass die königliche Macht schwächer geworden war und die Monarchen sich nurmehr auf Gewalt stützten.
Vom fernen Amerika glänzte im Morgennebel die Freiheitsstatue, das Symbol eines Bundes von sich selbst regierenden Republiken mit einer gemeinsamen staatlichen Zentrale. Von den großen Persönlichkeiten des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs konnte man lernen, wie eine freiheitliche Verfassung zustande kommt und auf welchen Prinzipien sie beruht. Die Amerikaner wiederum hatten während der Französischen Revolution gelernt, was man vermeiden sollte, nämlich soziale Gleichheit durch Terror zu erzwingen.
In Baden war die demokratische Bewegung am stärksten; von dort kam Hecker ja her. Aber selbst dort trauten sich die Bürger, die sich über lange Zeit immer wieder auf ihren Marktplätzen versammelt und nach Freiheit verlangt hatten, letztlich nicht, die entscheidenden Schritte zu gehen. Vielleicht haben Hecker und seine Getreuen das Momentum verpasst, vielleicht waren es einfach zu wenige, die die Republik wollten, vielleicht lag es daran, dass sie die Hilfe der deutschen Exilanten aus Paris (unter ihnen der Journalist Georg Herwegh und seine Frau Emma), die sich mit einer Heerschar von Gesinnungsgenossen auf den Weg nach Deutschland gemacht hatten, um der Badischen Freiheitsbewegung beizustehen, nicht annahmen. Vielleicht waren aber auch die deutschen Bürger noch nicht selbstbewusst genug, trauten letztlich ihrer eigenen Kraft nicht. Und so endete diese demokratische Erhebung kläglich.
Nach der demütigenden Niederlage floh Friedrich Hecker in die Schweiz. Dort sah man ihn nicht gerne; er versuchte es in Frankreich, aber da wollte man ihn auch nicht. Es war aus seiner Sicht nur folgerichtig, in dieser ausweglosen Situation in die Vereinigten Staaten auszuwandern, dem Land, in dem die Freiheit gefestigt schien, in dem die Bürger ihre politische Zukunft selbst in die Hand genommen hatten. Er ließ sich in Illinois nieder und kaufte eine Farm, baute Wein an, betrieb Viehzucht.
Aber in den Vereinigten Staaten war die Freiheit noch keineswegs gesichert zu jener Zeit. Der Norden war für die Abschaffung der Sklaverei, die Südstaaten traten aus der Union der Vereinigten Staaten aus, um weiter Sklavenwirtschaft betreiben zu können. Sie gründeten eine eigene Konföderation der Sklavenhalter-Staaten. 1861 brach über dieser Sezession ein Bürgerkrieg zwischen den verfeindeten Staatenbünden aus. An ihm nahm Hecker wie auch viele andere deutsche Emigranten als Freiwilliger der Nordstaaten-Armee teil.
Ein einziges Mal noch, 1873, kehrte er nach Deutschland zurück – und sah dort das, was er 1848 vorausgesehen hatte: Ein mächtiges Reich, das polizeistaatlich regiert wurde.
Friedrich Hecker starb 1881 in seiner zweiten Heimat Illinois. Auf seinem Grabstein ist sein militärischer Rang als Kommandeur des 82. Infanterieregiments verzeichnet.
Der demokratische Revolutionär mit Leib und Seele ist nach seinem Tod zu einer Provinzgröße zurückgestuft worden, über die man nur in lokalen Kreisen spricht. In Mannheim machen sich die Stadtväter seit einigen Jahren Gedanken, ihm ein Denkmal zu setzen ‒ über 170 Jahre nach der demokratischen Revolution, für die er stand. In Berlin lehnte man ein Denkmal für die Revolutionäre von 1848 auf dem Schlossplatz ab und wählte stattdessen den indirekten Weg eines Denkmals für jene nach Nordamerika vertriebenen Demokraten, als deren Repräsentant Carl Schurz bestimmt wurde, auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor. Offenbar kann man deutsche Demokraten umso leichter ehren, wenn sie nach Amerika vertrieben worden sind. Friedrich Hecker wird dort unter ferner liefen firmieren.
Heckers Geschichte erzählt von Wagemut und Verrat, von hohen Zielen und den Mühen der Ebene, von Niederlagen und Siegen, vom Hinfallen und Wiederaufstehen. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, dieser Spruch aus dem Umbruchsjahr 1989 lässt sich auch umkehren: Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. Hecker kam zu früh, und dafür wurde er bestraft. Doch er hat deutliche Zeichen hinterlassen.
Wer Heckers Schriften heute liest, erschrickt manches Mal. So klar und weitsichtig lesen sich seine Analysen, so zeitgenössisch – und so zeitlos. Wie eine prophetische Voraussage klingt, was er seinen Landsleuten nach dem Scheitern des Badischen Aufstands vorhielt: „Ohne Republik stets ein zersetzender Gärungsprozess, ohne Republik keine schöpferische Entwicklung des Volkes, ohne Republik kein Wohlstand des Volkes, ohne Republik keine Einheitskraft im Innern und nach Außen, ohne Republik keine Freiheit, und keine Freiheit für die Dauer.“
Was manchen Liberalen damals wie eine leere Drohung vorgekommen sein mag, verblüfft uns heutzutage ob seiner Aktualität: Hat nicht die Gründung des Deutschen Kaiserreichs den Spaltpilz erst recht in die deutsche Gesellschaft getragen? Die Politik des Reichskanzlers Otto von Bismarck (Kulturkampf und Verfolgung der (Sozial-)Demokraten) legt jedenfalls davon Zeugnis ab.
Wie ein roter Faden zieht sich eine Lehre durch die jüngere deutsche Geschichte: Die Deutschen verzweifeln immer dann an der Freiheit, wenn die Zeiten schwer sind. Die 15 Jahre andauernde Weimarer Republik fand nicht genügend Verteidiger, die sie vor dem Ansturm der kommunistischen Bewegung auf der einen Seite, der nationalsozialistischen Erhebung auf der anderen Seite und dem mangelnden Stehvermögen des Bürgertums hätten schützen wollen.
Die Gründung der Bundesrepublik 1949 war (dem Himmel sei Dank!) ein Oktroi der westlichen Besatzungsmächte und beruhte nicht auf dem seinerzeitigen Volkswillen. Die Gründung der DDR, ebenfalls 1949, war ein als antifaschistischer Akt verkleideter kommunistischer Oktroi, den die Mehrheit der Bevölkerung begrüßte. Die friedliche Revolution von 1989, von der Mehrheit der Menschen in der ehemaligen DDR jubelnd begrüßt, wich Jahre später bei einem nicht unbeträchtlichen Teil der Bevölkerung einem Argwohn, der insinuierte, die neu errungene Demokratie sei mit Hilfe einer Siegerjustiz oktroyiert worden.
Bis heute wissen beachtliche Minderheiten in Ost und West nicht recht, ob sie nun demokratisch leben oder lieber fürsorglich bevormundet werden wollen. In Umfragen, in denen sondiert wird, wie hoch die Deutschen die soziale Sicherheit und die politische Freiheit schätzen, steht immer die soziale Sicherheit an erster Stelle, vor der Freiheit. Auch wenn andere Umfragen besagen, dass die Mehrheit der Deutschen davon überzeugt ist, langfristig werde überall auf der Welt Freiheit gegen Unfreiheit siegen, die Befunde sind nicht gerade beruhigend.
Wäre Deutschlands Weg weniger katastrophal verlaufen, wenn die Bürger 1848 mutiger gewesen wären? Wir wissen es nicht. Der Verlauf der Geschichte lässt sich weder vorwärts noch rückwärts berechnen. Doch als Frage kommt dieser Gedanke gleichwohl immer wieder auf.
Daran ist Friedrich Hecker nicht ganz unschuldig.
1 Hecker war eine Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts, daher war für ihn Politik reine Männersache; dies war in deutschen Landen nicht anders als in Frankreich, England oder den Vereinigten Staaten. Gleichwohl hat er sicher wahrgenommen, dass es Frauen gab, die ebenfalls für die Politik begabt waren, wie zum Beispiel Emma Herwegh, die Frau des ins Pariser Exil vertriebenen Dichters Georg Herwegh.
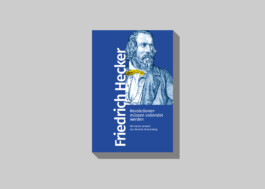
Friedrich Hecker
Revolutionen müssen vollendet werden
Erschienen am 09.02.2023
Taschenbuch mit Klappen, 176 Seiten
€ (D) 14,– / € (A) 14,40
ISBN 978-3-462-50004-2
1. Einleitung.
Der badische Landtag von 1842 bildet ohne Zweifel einen scharf bezeichneten Abschnitt in der staatlichen Entwicklung des·deutschen Volkes. Der laute Freiheitsschrei des gallischen Hahns im Jahr 1830 war verklungen, die politische Trägheit und Gleichgültigkeit hielten reiche Erne, große und kleine Klatschereien und literarischer Skandal waren die Würze zu dem Sklavenbrei des alltäglichen Schlendrians, Gelddurst und ein Rennen nach Erwerb, was man die materiellen Interessen nannte, war die Losung des Tages, und sie wurde von oben herab gnädig beäugelt und begünstigt, weil in geldgierigen Krämerseelen kein prometheischer Funke aufstrahlt und weil die Richtung der Zeit wie eine Finanzspekulation angesehen wurde: wobei man sich aber denn doch verrechnet haben möchte, da auch die materiellen Interessen der Sache der Freiheit dienen müssen und dienen. In dieser welken Zeit tauchte nur hier und da in deutschen Landen ein Wetterleuchten auf. Weiterlesen
Hannover machte ein mutiges Gesicht und wendete sich höflich an den Bundestag, der sich offiziell für inkompetent erklärte; die deutschen Kammern trugen hingegen Bedenken und predigten tauben Ohren für die Brüder in Hannover; Pressfreiheit wurde begehrt und·Zensuredikte ergingen; die Zeitungen erzählten ausführlich, dass Prinzen auch heiraten, fürstliche Kinder auch getauft werden, und Könige sterben wie Bauern. Fast allmonatlich musste ganz Deutschland deshalb entweder in der verzücktesten Exaltation oder in der tiefsten Trauer sich befinden, so dass die guten Michelinge nach den offiziellen Zeitungsnachrichten gar nicht mehr wussten, wie sie eigentlich daran waren.
In Baden hatte sich der Sinn für Freiheit und Verfassungsleben noch am wachsten erhalten. Da fuhr der Urlaubsstreit und seine Folgen wie ein Streiflicht über das Land; die wahren Abgeordneten des Volkes erhoben sich, wie Ein Mann, gegen Eingriffe in die Verfassung. Die Minister waren gewöhnt, dass man in glatten, abgedroschenen Formen sie anredete; jedes Wort wurde noch extra in Baumwolle gewickelt, damit man ihnen nicht zu wehe tue, und das nannte man: eine parlamentarische Sprache führen. Die deutschen Minister, die wohl wussten, dass ihnen das Portefeuille an den Leib gewachsen war und nur der Tod sie von ihm trennen könne, nahmen Prisen, während man sie apostrophierte, und die Reden und Vorwürfe glitten an ihnen ab wie der Hauch am Spiegel.
Da erhoben sich die badischen Deputierten und nannten die Dinge bei ihrem wahren Namen; sie sprachen mit dem Herzen; die Wörterbuhlschaft hatte ein Ende. Das war der Regierung unbequem: Es verwischte das Zwielicht ministerieller Erhabenheit; es kam einem adelichen Minister höchst auffallend vor, dass ein schlichter Landmann, ein Bürger aus der Stadt, ein Anwalt ihm unumwunden ins Gesicht sagte: „Das ist recht und das ist schlecht", denn er war ja lediglich an den Bückling des Supplicantenfracks und baumwollene Redensarten gewöhnt.
Nun entstanden eine Reihe halb offizieller Artikel, in welchen man die Abwehr der Eingriffe in Verfassungs- und Volksrechte Anmaßung und Angriff auf die Rechte. der Krone nannte; das monarchische Prinzip wurde mit der Person der Minister identifiziert, und wer einen Meister angriff, musste unfehlbar den Regenten angegriffen haben. Die Regierungsjournale versicherten auf das Bestimmteste, die deutschen Verfassungen seien samt und sonders keine repräsentativen, sondern deutsch-monarchisch-ständische. Was letzteres Wort bedeute, wurde eigentlich nicht gesagt, sondern so oft ein den Ministern unbequemer Akt vorging, hieß es immer: das ist gegen den Geist der deutsch-monarchisch-ständischen Verfassungen. lm Hintergrunde lauerte die Idee von Feudalständen, wenn's gut ginge, von Postulatlandtagen, mit denen es sich so bequem regieren lässt; aber geradezu sagen wollte man es denn doch nicht, obschon in der neuesten Zeit die Sache deutlicher ausgesprochen wurde. Eine große Unwissenheit in Verfassungsgesetzen verriet freilich eine solche Behauptung in Baden, woselbst in dem Verfassungsgesetz vom 23. Dezember 1818 die Verfassung selbst, abgesehen von ihrem Geiste, sogar eine repräsentative genannt wird; eine große Unkenntnis der Geschichte verriet das unbedingte Berufen auf die alten deutschen Landstände, da verschiedene derselben den Ständen das Recht der Steuerverweigerung ausdrücklich, ja, sogar das weitere Recht einräumten, wenn der Regent die beschworene Verfassung verletze oder bräche, sich ihm mit gewaffneter Hand zu widersetzen.
Das wichtigste Moment des badischen Landtags von 1842 ist, dass er nicht der Abglanz fremden Freiheitsgeistes, wie 1831, war, sondern dass dieser Geist sich selbstständig aus dem Volke entwickelte, während in Frankreich immer mehr und mehr-die Freiheit entschlummerte und die Minister die Deputierten wählten, nicht aber das Volk. Das war der Zustand der Dinge im Allgemeinen.
Bevor man nun zur Geschichte und Beleuchtung des Landtages von 1842 übergeht, wird es nicht überflüssig sein, auf die Zusammensetzung der zwei Kammern in Baden einen Blick zu werfen. da in der neuesten Zeit sowohl ein ehemaliger Reichsbaron in der ersten Kammer und ein Artikel der Carlsruher Zeitung, offenbar das Kind des Ministers von Blittersdorff, welcher der zweiten Kammer als Lebewohl nachgesendet wurde, so gütig waren, sich soweit herabzulassen und zu behaupten, es sei eine Anmaßung der zweiten Kammer, sich allein als-Volkskammer darstellen zu wollen; denn die Mitglieder der ersten Kammer seien auch vom Volke. Die Regierung gehöre mit allen Ministern dazu. Das war eine Manipulation, um das Wort Volk zum sachdienlichen Gebrauch in die adeliche und Ministerhand zu nehmen, wie ein deutscher Prinz kein Preußen und kein Österreich, sondern ein einiges, großes Deutschland hochleben ließ; ein Wort, das früher vor die Mainzer Kommission2 geführt hätte (…).
2. Zusammensetzung der badischen Kammern.
Die erste Kammer, welche also, wie gesagt, auch eine Volkskammer sein will, besteht nach der badischen Verfassung aus:
Das·ist denn doch kein Senat wie der belgische. Unter Volk hat man bisher immer die Staatsbürger begriffen, die sich an Rechten unbedingt gleich sind, die keine Vorzüge der Geburt, keine Vorzüge des Standes für sich in Anspruch nehmen und keinen Vorzug als den der Intelligenz anerkennen. Bisher hat man die Aristokratie immer in Gegensatz zum Volke gestellt; noch ist unter den hochadelichen Herren das Won Canaille als Bezeichnung des Bürgers nicht verschwunden; bis beute haben jene gnädigen Herren der Entlastung des Bodens sich entgegengestemmt, und gegen die Gesetze, welche sie selbst mit verfassen halfen, in dem ihre gewählten Vertreter in der ersten Kammer ihre Zustimmung gaben, (…) bis heute jedem Fortschritt. wenn er nicht von oben kommandiert war, ein starres, verstocktes Nein entgegengesetzt.
Fassen wir aber nun die Zusammensetzung dieser Kammer ins Auge, so ergibt sich, dass kein freisinniger Vorschlag, kein Vorschlag zum Fortschritt, keine Adresse an den Großherzog, worin um·etwas Zeitgemäßes gebeten wird, die Zustimmung dieser Kammer erhalten kann, wenn nicht die Regierung a priori mit der zweiten Kammer einverstanden ist, folglich eine Adresse überflüssig wird, indem die Regierung dann ohne dieses schon mit der Sache herausrücken wird. Denn nehmen wir zum Beispiel an, die zweite Kammer verlangte in einer Adresse an den Regenten Geschworenengerichte, die Regierung hätte eine Abneigung dagegen, geschwind wird die erste Kammer sie in der Abstimmung über die Adresse der zweiten Kammer teilen. Würden nämlich die·acht Grundherren als unabhängige Gutsbesitzer mit der zweiten Kammer eines Sinnes sein, was, per parenthesis gesagt, schwerlich je vorkommen wird, gleich wird ihr Votum durch die acht Staatsdiener aufgewogen; die zwei Deputierten der Universitäten würden durch die zwei geistlichen Würdenträger paralysiert; die Prinzen des Hauses werden sich mit der Regierung nicht in Opposition setzen, – und das ist eine Volkskammer?!
Es ist komisch, wie der Freiherr von Andlau in der zwölften Sitzung der ersten Kammer am 26.August, bei Gelegenheit der Großjährigkeit des Erbgroßherzogs und seiner Einführung in die erste Kammer, in einer wohlstudierten Rede sich entrüstet erklärte, dass man daran zweifle, die erste Kammer sei eine Volkskammer. Was würde der goldgeharnischte Reichsfreiherr mit dem lichtbraunen Rösslein gesagt haben, wenn ihn, den Volksrepräsentanten, ein schlichter Landmann im Kreise anderer Junker mit einem Händedruck und den Worten hätte begrüßen wollen: „O Angehöriger und Teil des Volkes u. s. w.“ Hellauf hätten die Freiherren gelacht, und verlegen hätte der Volksrepräsentant versichert, so sei es doch eigentlich nicht gemeint gewesen, sondern …
War es eines Mannes, der dem Volke angehören will, würdig, in das weiche und zugängliche Herz eines Fürstensohnes bei dessen Eintritt in das politische Leben die Verdächtigung einzugießen, als sei die andere Kammer auf dem Wege, welchen der Nationalkonvent und seine Wohlfahrts und Sicherheitsausschüsse gingen! War es würdig, den Morgen jenes politischen Lebens (und die ersten Eindrücke verwischen sich nicht leicht) mit Anspielungen auf den Tod Ludwigs XVI. zu begrüßen, Hass und Misstrauen in eine jugendliche Brust zu säen, ein unheimliches Gefühl gegen die andere Kammer in ihm heraufzubeschwören! Und wer hat denn mehr Könige gemordet als die Standesgenossen des Freiherrn? Wer hat in der jüngsten Geschichte Gustav III., wer hat die russischen Zaren gemeuchelt? (…)
Die zweite Kammer ist zusammengesetzt aus 63 Abgeordneten der Städte und Ämterbezirke. Jeder Staatsbürger, der das 25. Jahr zurückgelegt hat, im Wahldistrikt als Bürger angesessen ist, oder ein öffentliches Amt bekleidet, ist Wähler; ausgeschlossen sind bloß Hintersassen, Gewerbsgehilfen, Gesinde, Bediente.
Diese Wähler wählen Wahlmänner und diese den Abgeordneten. Abgeordneter kann jeder werden, der einer der anerkannten christlichen Konfessionen (katholische und evangelische) angehört, 30 Jahre alt, in dem Häuser-, Grund- und Gewerbesteuerkataster mit einem Kapital von 10,000 fl.3 eingetragen ist, oder eine Rente von wenigstens 1500 fl. von einem Stamm- oder Lehensgute, oder eine fixe und ständige Besoldung oder Kirchenpfründe von gleichem Betrage als Staats- oder Kirchendiener bezieht, auch in diesen beiden letzten Fällen wenigstens irgendeine direkte Steuer aus Eigentum zahlt.
Diese Wahlordnung ist nun ein Stein des Anstoßes. wie in dem acht Spalten großen Artikel der Carlsruher Zeitung, der unmittelbar nach dem Schlusse des Landtages erschien, mit vieler Gleisnerei gepredigt wird. Ebenso ist es auch die Bestimmung der Verfassungsurkunde, wonach derjenige, welcher im Gewerbesteuerkataster mit 10.000 fl. eingetragen ist, Abgeordneter werden kann. Man möchte gerne, wie in Frankreich, einen Wahlzensus eingeführt wissen; denn, wenn dieses geschehen würde, so hätte, wie in Frankreich, die Regierung gewonnenes Spiel. Die Wähler würden dann auf einige tausend reduziert; es wären meist reiche und, wie die meisten Reichen, ängstliche Leute; sie wären leicht zu bearbeiten und zu kontrollieren; wenn aber jeder Bürger Urwähler ist, geht das nicht an. Man hat wohl eingesehen, dass die Urwähler es sind, welche den Abgeordneten erküren; denn wählen die Urwähler freisinnige, unabhängige Bürger zu Wahlmännern, so hilft alle Bearbeitung der Regierung nichts, ein liberaler Abgeordneter wird gewählt. Sogar die selige oberdeutsche Zeitung ging in einer ihrer letzten Nummern in jene Ansicht ein: auch sie wurde vornehm und meinte, es sei denn doch etwas zu weit gegangen, wenn alle Bürger, ob sie etwas besäßen oder nicht, Wähler sein könnten. Es ist gut, dass ein Blatt, welches die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte lediglich von dem Besitz abhängig machen wollte, welches den ersten Menschenrechten den Krieg erklärte, aufgehört hat, zu erscheinen.
Ist denn der intelligente Mann, dem die Zufälligkeit der Glücksgüter versagt ist, ist der Bürger, welcher alle staatlichen Pflichten getreulich erfüllt, der steuert wie der Reiche, ein Paria, weil er nicht gefüllte Truhen im Hause hat? Ist der ärmere Bürger schlechter als der Reiche? Fühlt er nicht Wohl und Wehe des Vaterlandes wie jener? Ist ihm die Sache des Vaterlandes und der Freiheit weniger teuer? Und soll er mit allen edlen Gefühlen seiner Brust ausgeschlossen sein von der Ausübung staatsbürgerlicher Rechte? Sich dabei unvertreten sehen? Das ist Furcht und Feigheit, das ist Geldhochmut und Kastengeist, das ist Machiavellismus. Die Reichen und Besitzenden allein retten das bedrängte Vaterland nicht, und wenn der ärmere Bürger gut genug ist, sein Blut für das Gemeinwohl als Krieger zu verspritzen, muss er auch gut genug sein, mitzureden bei den allgemeinen Landesangelegenheiten, denn Blut ist mehr als Geld, und nur da ist ein wahres Repräsentativsystem vorhanden, wo alle Bürger an der Volksvertretung teilnehmen. Vergesst, ihr Hochmütigen, die Worte des Heilandes nicht, dass ein Kamel eher durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in das Himmelreich kommt.
(…)
4. Das Ministerium Blittersdorf und sein System
Das politische System eines Menschen hängt mit seiner Persönlichkeit und seinen Verhältnissen innig zusammen. Der Minister Blittersdorf ist ein von Haus aus armer Adelicher, das ist: ein bedeutungsvolles Subjekt und Prädikat. Seine finanziellen Verhältnisse haben sich durch Verehelichung mit einer bürgerlichen, einer Frankfurter Bankierstochter günstiger gestaltet; wenngleich noch zurzeit nicht so bedeutend, dass er, wie dieses Jahr in Kissingen der Fall gewesen sein soll, jedes Jahr 12,000 fl. verspielen könnte. Von Charakter ist er hochfahrend, herrschsüchtig und wiederum aalglatt, einschmeichelnd und listig, besitzt jene, an Gründen nicht überfließende, Leute schwächeren Geistes blendende, Salonsprache und Redegabe; daher auch Mancher hinter seinen Reden in der Kammer etwas suchte, aber bei ruhiger Analyse nichts fand, als Behauptungen ohne Beweis, Widerspruch ohne Widerlegung, eingekleidet in eine wörterglänzende Sprache. Sein politisches System verrät Frechheit, aber keine Kühnheit, Unüberlegtheit, aber keinen Mut, einen Satz Stirn an Stirn durchzukämpfen. Der Fürst Metternich soll ihm, nach glaubwürdigen Versicherungen von Männern, die auf Schloss Johannisberg, bei dem bekannten Diener, im Jahre 1841 anwesend waren, gelegentlich des von Blittersdorf angezettelten Urlaubsstreits4 gesagt haben: „Es war sehr ungeschickt. Herr von Blittersdorf, diesen Streit zu einer Zeit anzuregen, in welcher Regierung und Stände durchaus einig waren.“ Was es, ins Deutsche übersetzt, heißt, wenn Metternich etwas ungeschickt nennt, bedarf keiner Ausführung. Blittersdorf ist ein politischer Spieler. Aber er hat nicht den Mut va banque! zu rufen, er möchte um jeden Preis herrschen und Portefeuille und Gehalt nicht verlieren. Sein System ist durchaus nicht das rein monarchische. Er möchte den Fürsten von der Cotterie seiner Standesgenossen umgeben wissen, der Adel soll herrschen, der Regent dem Adel verfallen, das Volk incanailliert werden; sein Prinzip ist das aristokratische (…). Wie alle derartigen Individuen, verhehlt er die Wahrheit, verdreht sie, erregt Befürchtungen, greift jeden Moment auf, um ihn seinem Herrn als Angriff auf die Rechte der Krone darzustellen, und treibt die Ungeschicklichkeit so weit, jeden Angriff auf die Minister als einen Angriff auf die Rechte der Krone darzustellen, seine Person mit dem monarchischen Prinzip zu identifizieren. Die von ihm ausgehenden, vielen Zeitungsartikel, leicht am Stil erkenntlich, sind weniger berechnet, auf das Volk als nach oben zu wirken, weil er weiß, dass das Volk weder Minister macht noch absetzt; daher drehen sich auch alle diese Artikel um eine Achse, nämlich, alle Handlungen der Kammer als Angriffe auf die Krone darzustellen. Unterstützt wird er von seinen Standesgenossen, besonders von dem gesamten Ministerialadel, weil sie einsehen, dass er für ihre Herrschaft streitet.
Vielfach hat er schon ausgesprochen, die badische Verfassung sei keine repräsentative (eine Unwahrheit, die oben widerlegt ist), sondern eine monarchisch-ständische, d. h. eine aus den alten Feudalverfassungen allein zu interpretierende. Eine Interpretation aus analogen Verhältnissen anderer repräsentativer Staaten in Verfassungen erklärt er für hohle Theorie und politischen Schwindel. Sein Streben ist, die Verfassung zu einer feudalen Grundlage zu führen, womit folglich nur Geburts-, Geld- und Beamtenaristokratie vertreten würden, das ist in seinen Artikeln offen gesagt, das scheint durch alle seine Reden und Taten durch, und darum artikuliert er in Broschüren und Pamphleten gegen die Wahlordnung und für Einführung eines Zensus. Mit solcher Verfassung ließe sich bequem regieren. Der Fürst bliebe in seiner Stellung, die er in allen Repräsentativverfassungen einnimmt, und wonach er, nach Blittersdorf in der Kammer, gelegentlich der Erwähnung der englischen Verfassung, geäußerten Ansicht eine Null ist. Das Volk, ausgeschlossen von der unmittelbaren Teilnahme an dem Verfassungsleben, wäre ebenfalls Null, und übrig bliebe der Adel, die furchtsamen Reichen, die Geistlichkeit. Letztere kann und darf im Staate nicht herrschen, die Reichen gehen nicht dienen, taugen auch nicht, nach adeligen Begriffen, zu allen Ämtern, wenn sie bürgerlicher Herkunft sind, haben keinen Zutritt bei Hof, können folglich auch keinerlei Einfluss auf den Regenten ausüben, und so bleibt denn der Adel allein übrig, und das ist das System Blittersdorfs. Er benutzt folglich aus der konstitutionellen Staatsverfassung, was in seinen Kram taugt, ebenso aus den Feudalverfassungen und der absoluten Monarchie. Letztere wäre ihm nicht die bequemste, weil er, gegenüber der unbeschränkten fürstlichen Macht, weniger Spielraum hätte.
Das ist aber nichts Neues: so hat es der Adel aller Zehen und Orten gehalten; und der verarmte und arme Adel, erbittert über den Mangel an Glücksgütern (darum umso gefügiger und die herrschsüchtigen Pläne fein anlegend), ist es, der das Spiel um die Herrschaft unternahm. Jedes Blatt der Geschichte bestätigt diesen Satz.
(…)
1 Dieser Text ist ursprünglich für eine von Georg Herwegh geplante, aber noch vor Erscheinen verbotene Zeitschrift entstanden. Herwegh hat ihn daraufhin, mit anderen Zeitschriften-Beiträgen, 1843 in einem Sammelband veröffentlicht, dem er den Titel gab: „Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz“ – „einundzwanzig“ deshalb, weil in den Ländern des Deutschen Bundes alle Druckerzeugnisse bis zu 20 Bogen einer Vorzensur ausgesetzt waren. Das Buch wurde zu großen Teilen bereits im Drucksaal beschlagnahmt. Dennoch gelangten einige Exemplare nach Deutschland und trafen dort auf große Resonanz.
2 Das war eine Kommission zur Untersuchung „hochverräterischer Umtriebe“ als Teil des von Lothar von Metternich eingerichteten Überwachungssystems, nachdem die Staaten des Deutschen Bundes 1819 auf einer Konferenz in Carlsbad beschlossen hatten, beispielsweise Studenten und Professoren an deutschen Universitäten jede politische Betätigung zu verbieten.
3 „fl.“ Ist die Abkürzung für die süddeutsche Gulden-Währung (im Unterschied zur norddeutschen Taler-Währung). Ein Gulden (fl.) zerfiel in 60 Kreuzer zu je 4 Pfennigen, ein Pfennig waren 2 Heller.
4 Der erzkonservative Politiker setzte im Frühjahr 1841 bei Großherzog Leopold durch, dass zwei Richter, die gerade zu Abgeordneten der Liberalen gewählt worden waren, keine Freistellung („Urlaub“) erhalten, um ihr Mandat wahrzunehmen. Das führte zu einem heftigen Streit zwischen Regierung und Opposition. Anfang 1842 stimmten die Abgeordneten mehrheitlich einem Antrag Johann Adam von Itzsteins zu, der das großherzogliche Verdikt als nicht verfassungsmäßig verurteilte, woraufhin der Großherzog das Parlament auflöste und Neuwahlen ausrief, bei denen die Liberalen jedoch, weil der Urlaubsstreit ihre Wähler mobilisiert hatte, ihren Sitzanteil behaupten konnten – eine schwere Schlappe für von Blittersdorf und seine Regierung.
Die gegenwärtige Lage der Dinge in Europa bietet ein solches Chaos von gegensätzlichen Elementen, Wirren und Widersprüchen dar, dass nur wer sich seines Zieles klar bewusst ist und damit weiß, welcher Mittel man sich bedienen muss und von welcher Stärke sie sein müssen, allein imstande ist, mit Erfolg in die Gegenwart einzugreifen und über die Zukunft ein Prognostikon zu fällen. Nur zwei Parteien sind es, welchen ihr Ziel und die Mittel klar vor Augen liegen, die Partei der Republik und der Despotismus, darum muss auch eine von ihnen den Sieg davontragen, die in der Mitte stehende Partei, die sich mit den Redefiguren „gemäßigt-monarchische“, „konstitutionell-monarchische“, „monarchische Demokratie“ und mit anderen schwatzhaften Stichwörtern breit macht, hat bereits ihre völlige Rat- und Tatlosigkeit auch den Blödesten klar bewiesen. Dem denkenden Menschen war die Unnatur einer Kuppelwirtschaft, zwischen Fürstengewalt und Volksgewalt von vornherein klar, es war ihm klar, dass auf einer solchen Missehe nur krüppelhafte Bastarde hervorgehen können. Diese Partei, welche jetzt das große Wort an sich reißen und mit endloser Schwätzerei den Volksbürger regenerieren zu wollen sich vermisst, will zwar dem Volk eine Summe von Rechten auf dem Papier zusichern, sie will aber auch die Fürstengewalt beibehalten! Sie will mit einem Wort auf zwei Schultern Wasser tragen. Warum, so fragt diese nun der Mann, der nur „Ja Ja“, „Nein Nein“, nur „Wahrheit und Lüge“ und keine liederliche Verblumung des Einen oder des Anderen gelten lässt, warum erkennt ihr denn das Volk als Quelle alles seines Rechts, warum die Souveränität und Majestät des Volkes jederzeit an? Warum erkennt ihr an, dass eine konstituierende Volksversammlung allein das Recht habe, der Nation Grundgesetze zu geben, und wollt im gleichen Augenblick neben der Macht und Herrschaft des Volkes auch eine andere Macht gelten lassen und ihr Rücksichten tragen? Warum sprecht ihr von dem ewigen, ganzen, unteilbaren Recht des Volkes und verweist im nämlichen Augenblick auf seine teilweise Beraubung zugunsten alter Stegreifgeschlechter hin? Warum soll das Volk um einen Teil seiner Macht und Herrlichkeit bestohlen und ihm neben diesem politischen Raub noch ein ewiges Geschwür gemacht werden, welches die besten Kräfte seines Schweißes, seiner Arbeit verzehrt? Wir wollen es dir sagen, du großes, herrliches Volk – die Feigheit dieser Partei ist es, welche dich verkuppeln will. Weiterlesen
Während sie dem Volk, als der alleinigen Urquelle alles Rechts, aller Gewalt, aller Herrlichkeit, von seiner Freiheit und Befreiung in hohlen Phrasen vorbeilavieren, können sie sich der Furcht nicht erwehren, was daraus entstehen könnte, wenn sie den Grundsatz der Volkssouveränität in seiner ganzen, klaren, hohen Bedeutung, in seiner äußeren Form, der Republik, aussprechen. Sie zittern und schlottern in einer doppelten Furcht herum. Sie fürchten einerseits das blutige Vampir-Geschlecht der Monarchie, sie besorgen, dieses könnte mit den letzten ihm zu Gebote stehenden Mitteln unter russischer Beihilfe einen Kampf der Verzweiflung versuchen, obsiegen und sie dann heimsuchen für die Treue gegen das Volk; sie könnten dann ihre Stellen, ihre Pfründe, ihre Praxis, ihre Kunden verlieren; andererseits fürchten sie sich vor dem bewegten Leben der Volksherrschaft und seiner scharfen, wachsamen Kontrolle, wo Schönreden nichts gilt, sondern Rechtshandeln. Sie ziehen daher Samthandschuh an und streicheln links und rechts, schmeicheln rückwärts und vorwärts, nehmen Rücksichten hin und her, packen eben etwas ganz tapfer an und lassen gleich wieder nach, wenn Widerstand und Gefahr drohen; und diese aufgeputzten, politischen Koketten glauben sich berufen und imstande in einer gärenden, revolutionären Zeit, in einer Zeit, welche eine neue Gesellschaft, einen neuen Staat gebären will, zu ordnen, zu schaffen und zu bauen. Eitle, törichte Schwätzer! Nur ein klares Prinzip, ein energisches Verfolgen desselben, vermag unser Volk zu erretten. Der Kampf zwischen Menschenrecht und Menschenwürde und zwischen Knechtung und Verdummung macht seinen letzten Gang, er muss ausgekämpft werden zum letzten Schlag, und ihr wollt vermitteln! Das heißt nichts anderes, als bewusst oder unbewusst auf diplomatischem Wege die Menschheit an die Despotie verraten! Dann mögt ihr Verfassungen machen, so viel ihr wollt, mögt darin aufnehmen, was ihr wollt, setzt ihr einen Fürsten an die Spitze, so wird er trotz dem Schatten eurer Ministerverantwortlichkeit im Laufe der Zeit das Volk betrügen um sein gutes Recht, das sagen euch tausend Blätter der Geschichte.
Die sich nennende konstitutionelle Partei ist demnach ein kampfunfähiges Partei- und Parlamentärgeschlecht, welches zwar die Republik dem Grundsatz nach als die einfachste, naturgemäßeste und allein gerechte Staatsform anerkennt, aber nicht den Mut hat, sie zu proklamieren, zu erkämpfen und mit allen Mitteln zu verteidigen; ein Geschlecht, welches eben wegen seiner Feigheit nicht einmal imstande ist, sein eigenes Kind zu verteidigen, durch fortwährendes Reden, Unterhandeln und furchtsames Nachgeben dasselbe immer weiter und tiefer fürstlichem Despotismus überantwortet, wie wir nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich unter Bourbons und Orleans gesehen haben.
Eine solche Partei von Zwittern ist nun nicht imstande, Deutschland aus der grenzenlosen Verwirrung, aus der Unzufriedenheit aller Parteien, aus dem Versinken und Versiegen aller Wohlfahrts- und Reichtumsquellen zu erheben; und hätte der Despotismus es nur mit ihr zu tun, er wäre längst Sieger. Er fürchtet nur eine Partei, die Republikaner, und fast närrisch klang die feige Klage der Konstitutionellen nach Beendigung der Schilderhebung in Baden, „jetzt kommt die Reaktion“, „der Reaktion ist nun Tür und Tor geöffnet“, was ins Deutsche übersetzt nichts anderes heißt als: Vor uns braucht sich niemand zu fürchten, wir sind bloß Schwätzer, wir konnten, solange die Republikaner noch dastanden, die Esel in der Löwenhaut spielen, jetzt ist alles aus. So stehen sich also in der Tat nur zwei kämpfende, selbstbewusste Parteien gegenüber, die Republikaner und der Despotismus, die in der Mitte laufen dem nach, auf dessen Seite sich der Sieg neigt.
Die deutschen Republikaner müssen daher ihre Stellung, ihrer hohen Risiken völlig bewusst werden, sie müssen sich mit dem Gedanken identifizieren: dass die Stellung des Vaterlandes, sein Bestand, seine Größe nur allein in ihren tätigen und tatenkräftigen Hände gelegt ist. Wir müssen daher die Stellung der beiden alleinigen Gegner genauer ins Auge fassen.
Die Republikaner haben sich für die Einfachheit, Klarheit und Wahrheit ihrer Grundsätze, die eins sind mit dem Menschen in seiner vollen Berechtigung, Anerkennung und Geltung, ausgedrückt in dem Wahlspruch Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Sie haben für sich die Erfahrung. Tausendjährige Bedrückung, Knechtung, Auslaugung und Verarmung haben dem Volke die übertünchten Gräber monarchischer Staatsform aufgedeckt und es in die Tiefen voll Elend und Moder blicken lasse; während es mit wandersüchtigem Sehnen hinüberblickte auf die blühenden Freistaaten diesseits und jenseits des Meeres, an welche tausend Verbindungen des Familien- und Geschäftsverkehrs es knüpften mit stets innigeren Banden.
Sie haben für sich die Einsicht des Volkes in seine materiellen Interessen. Der schlichteste Landmann sieht ein, dass die Staatsform, welche Pracht und Luxus, müßige Müßiggänger, den ganzen Tross des Hofgesindels und Schreibervolkes, die Besoldungs- und Pensionsverzehrer in Legion erheischt, es unmöglich mache, dass der Bürger froh werde seines harten Tagewerkes. Mit einem Wort: Die weitaus größte Mehrzahl der Deutschen sind Republikaner aus Gründen der Erkenntnis, und es bedarf weiter nichts als diese Erkenntnis auf doppeltem Wege zur vollendetsten Klarheit zu bringen und zu befestigen, und sie zur Tat überzuführen. Auf doppelte Weise, indem einmal in Schrift und Tat alle und jede Bedrückung und Betrügerei, welche das Volk unter der monarchischen Staatsform erduldete oder zu gewärtigen hat, tagtäglich aufgedeckt und ihm in lebhaften Farben vorgeführt werde, und das, was es erduldet und ertragen hat, noch duldet und erträgt, ihm pünktlich vorgehalten, der Nimbus, in welchem sich die Fürstengewalt durch allerlei Taschenspielerkünste einzuhüllen strebt, zerrissen, die nackte Missgeburt bloßgestellt und deren Helfershelfer der Verachtung und dem Spott preisgegeben werden, welche ihr alleiniges Verdienst sind. Zum anderen, dass man tagtäglich als Gegensatz zu diesem Treiben der Monarchie die Einfachheit der republikanischen Staatsverwaltung, mit Beilegung von Beispielen aus den glücklich bestehenden Republiken, darlegt, wo keine spürnasige Polizei, kein Heer von Schergen den Frieden stören, wo die Beamten der Justiz und der Verwaltung lediglich Männer aus dem Volke und aus seiner Wahl hervorgegangen, nicht jede Paschadespotie deutscher Amtsleute üben dürfen, wo sie nach umlaufender Amtszeit nicht auf der Pensionsstreu tot gefüttert werden, sondern wie jeder andere Bürger ihr Fortkommen selbst suchen müssen, wo kein brutalisierender Soldatenstand existiert, vielmehr jeder Bürger selbst die Waffe führt und Haus und Herd gegen jeden Angriff schützt; wo endlich der nutzlose, verschwenderische Fürstenprunk nicht existiert und die dafür nötigen harten Taler dem Volksverkehr verbleiben.
Dieses alles also, was jeder fühlt, denkt, weiß, soll er sich täglich vorhalten und sagen, anderen mitteilen und einen Blick werfen auf unsere zerrissenen, verwildernden und verdorbenen Zustände, unsere verschuldeten Felder und unsere verpfändeten Hütten, den festen, energischen Beschluss fassen – und zur Tat werden lassen, dass in seine Hände es gelegt sei, die heimatliche Erde zu befreien, einzureißen den alten Kerkerbau und statt Kinder und Enkel mit gebundenen Händen den Drängern zu überliefern, ihnen die deutsche, befreite Erde als ein Erbe zu hinterlassen, wo sie freudig sich Hütten bauen und ihrer Arbeit froh werden können. Und ist es denn ein so großer Schritt, eine kurze Zeit entscheiden zu wollen, auszurotten die alte Wildnis, und dann für Generationen hinaus beglückend gewirkt zu haben? Fürwahr die Arbeit ist nicht größer, als einen Sumpf trocken zu legen, ein Bergfeld zu roden oder einen alten Wald anzustecken.
Und wer sind denn eure Gegner, wer sind die Despoten und ihre Knechte? Leiten auch sie jene hohen Ideen der Befreiung und Beglückung aller Menschen; leiten auch sie die süßen Gefühle, Kindern und Kindeskindern von Millionen freie, friedliche, glückliche Hütten zu bauen? Leitet sie nicht vielmehr die kaltherzige und erbarmungslose Herrschsucht, welche den Schweiß des Mannes und die Tränen der verpfändeten Witwe in schwelgerischen Gelagen, rauschenden Festen, eitlen Paraden und menschenschlächterischen Heerzügen aufgehen lässt, sind es nicht die niederen, schwarzen Leidenschaften, ist es nicht eine Höllenmacht des Herzens, mit welcher sie wirtschaften? Verflucht sei euer Sohn, welcher im Dienerrock oder Soldatenkleid sich stellt gegen das Volk, gegen Vater und Bruder, verflucht sei das Geschlecht, welches sich hergibt zur Entwürdigung des göttlichen Ebenbildes, des Menschen, und Fluch aus tiefstem, zitterndem Herzen über die, welche hereinbrechen gegen die Satzung des Menschenrechts, der ewigen Liebe, der Freiheit und der Gleichheit aller. Und ihr zögert, und ihr wählt und rechtet noch gegenüber solchem Gegner? – Zögert ihr noch und wählet, wenn der Wolf in eure Herde brechen, wenn der Räuber eure Habe vergewaltigen und eure Wohnungen niederbrennen will? Und werdet ihr nicht täglich aufgezehrt und beraubt, und steht nicht im Hintergrund der Polizeiknecht, der Wander- oder Bettelstab? Und ihr zögert und hofft auf einen Erlöser in Gestalt eines Parlaments neben 34 Fürsten und einen 35sten Kaiser. Habt ihr die Pracht und die Gewalt über euch noch nicht genug genossen? Wollt ihr schaffen noch mehr Pracht und setzen eine neue, größere Gewalt über euch?
Aber – in deine Hände, o Volk, ist gelegt deine Errettung und deine Erlösung, in deine Hand, du mutige Schar republikanischer Männer. Denn während man redet und tagt und tagt (…), sammeln die Despoten ihre bezahlten Schergen enger um sich, reichen dem Russen hinter dem Rücken des Volkes die Hand zum Bunde.
Mit hunderttausenden von Sklaven, mit Kosaken, Baschtuken und Tartaren, mit wildem Raubgesindel steht er an der Pforte, um hereinzubrechen und die Fürsten einzusetzen in die rachedurstige Macht und dich rückzuführen in eine Knechtschaft, härter als die Israels war unter Pharao, um wieder zu bauen ein verwüstetes Land.
Während in nutzlosen Einzelkämpfen das Volk nach seinen Rechten, nach Erleichterung von seinen Lasten ringt, steht der Russe lauernd an den Pforten, um über das ermattete Volk im rechten Zeitpunkt herzufallen. Mitleidlos sehen die befreiten Völker auf unsere Not, der Freie achtet nur den Freien. –
Es bleibt nur eine Wahl. Sobald den deutschen Fürsten der rechte Zeitpunkt gekommen scheint, sobald das Parlament nicht nach ihrer Pfeife tanzt, sobald der Ehrgeiz um die Oberherrschaft in Deutschland nebenbuhlerisch wird und der fürstliche Despotismus mit den Russen im Bunde auftritt, in demselben Moment rückt der Franzose in die deutschen Marken, und das deutsche Volk hat die Freien nicht zum Freunde und die Despoten zu Feinden, auf unserer Erde, mit unseren Kräften und unserem Blut werden die gewaltigen Gegner sich bekämpfen.
Friedrich Hecker
Jede Revolution, welche vom Gebiet der Tat hinübergleitet auf den Boden der Diskussion zehrt sich auf und wird von derjenigen Macht, welche durch die Revolution gestürzt werden sollte, mit den Mitteln der Intrige, der Bestechung, des Zögerns und Hinhaltens, mit einem Worte durch das Spiel politischer Betrügerei ausgebeutet und zu Grunde gerichtet.
Aufgabe eines jeden Volles, welches sich erhebt aus der tiefen Erniedrigung, aus der Knechtschaft und Unterdrückung ist es, die feindliche Macht, unter deren Druck es geschmachtet und gelitten hat, und gegen welche es sich erhebt, vollständig zu zerbrechen, provisorisch die Grundlagen des neuen Freiheitsbaues zu legen und erst, wenn die Revolution siegreich ihre Fahne wehen sieht über der zerbrochenen tyrannischen Gewalt, erst dann kann die Beratung des neuen Staatsorganismus beginnen; das alle muss so gründlich vernichtet sein, dass eine Wiederlehr nicht möglich wird, dann erst kann der junge Freiheitsbau vollendet werden. Weiterlesen
Ewig wahr ziehen die Sätze durch diese Geschichte aller Revolutionen, und alle Revolutionen gegen die menschenentwürdigende Herrschaft eines Einzelnen, gegen die Monarchie, gingen unter, wenn das Volt, statt die Revolution mit allen revolutionären Mitteln zu vollenden, sich auf das Verhandeln und Unterhandeln, auf lange Reden und bodenlose Schwätzerei einließ. Mit der Monarchie ist kein Vertrag möglich. Gegen fürstliche Tyrannei gibt es nur das einzige Mittel, völlige Vernichtung der Monarchie.
Diese durch Erfahrung von Jahrtausenden erprobten Axiome standen mir klar vor der Seele im politischen Leben, sie traten in Riesengestaltung vor mich, als Frankreich, welches alle Formen der Monarchie, von der Despotie des XIV. Ludwigs bis zu der gaukelspielerischen Betrügerei der konstitutionellen Monarchie durchlebt hat, sich erhob und das Königtum stürzte. Welchen Anteil ich an der Bewegung, an der Erhebung Süddeutschlands genommen, wie ich sie mit aller Begeisterung, Ruhelosigkeit und Energie, deren ich nach meiner geringen Kraft fähig bin, gefördert, getrieben und nur in ihr gelebt habe, das ist Vielen bekannt; es galt jetzt den Gedanken, der Tag und Nacht mein Begleiter war, zur Tatsache werden zu lassen. (…)
Der 24. Februar zuckte elektrisch durch unser unglückliches niedergeworfenes Volk, die Bewegung brach los, es verlangte klare Rechtsbriefe, die revolutionäre Kraft und Begeisterung strömten aus der Tiefe auf, die 38fache Zersplitterung hinderte die Gesamtentfaltung und die Benutzung der in 38 Staaten arbeitenden revolutionären Kraft, jedes Land und Ländchen arbeitete für seine eigene Rechnung, die zitternden Fürsten, ihre gegliederte Diplomatie und Bürokratie waren, wenn auch zurückgedrängt, eingeschüchtert, immerhin noch organisiert, und dass sie (…) ihre Verbindung umso enger knüpften, konnte man als gewiss voraussetzen, denn es galt ihrer Existenz, die Selbsterhaltung musste sie dazu treiben.
Das Volk fühlte selber diesen Zustand der Zersplitterung seiner Revolutionsarbeit, es verlangte nach einem Sammelpunkt. Einen solchen Sammelpunkt, in welchem die 38fach gespaltene revolutionäre Kraft föderiert über das Ganze der 38 Staaten zu wirken im Stande war, konnte nur eine revolutionäre Versammlung abgeben, welche mir kraft revolutionären Willens, ohne allen Anstrich einer Fußung auf den Gesetzen der alten Staatsform, zusammentrat. Diese Versammlung war das Vorparlament, dieses musste permanent bleiben; man konnte in dasselbe fort und fort neue Kräfte berufen, diese Versammlung musste das Steuer in die Hand nehmen, sie musste provisorische Dekrete erlassen und die Grundlagen legen. Aber sie musste, um letzteres zu können, permanent bleiben; und blieb sie beisammen, so musste sie mit jedem Tage energischer vorwärts gehen, denn sie stand auf keinem anderen Boden als dem der Revolution; was sie geschaffen und vollbracht, konnte sie als Erbe einem konstituierenden Konvent übergeben, der aus der Volkswahl hervorging. Ich sah es klar, dass die Revolution nur gerettet, rasch und energisch vollendet werden könne durch die Permanenz, und stellte den Antrag – er fiel, nur Waffengewalt konnte jetzt noch entscheiden. Das war meine feste Meinung. Ich bin überzeugt, dass Fürsten und Diplomaten aufatmeten, als sie sahen, dass die Permanenz verworfen worden war und die Revolution auf das Feld der lokalen Schwätzereien verwiesen werden sollte, sie hatten Zeit gewonnen, und Alle, welche gegen die Permanenz auftraten oder stimmten, haben die Revolution, haben das Volk verraten! Jetzt galt es die Revolution durch die Revolution zu retten, wir erhoben uns in Baden. Die Erkenntnis der Faulheit der üblen Zustände war in Baden, war in Deutschland vorhanden; das Volk hatte in Versammlungen und Einigungen dieses laut erklärt, es hatte zur Tat aufgefordert, es gehörte nichts als der Mut der Tat zu dem Mute des Wortes, es gehörte Aufopferungsfähigkeit dazu, und eine Erhebung in Masse hätte ohne Schwertstreich die Revolution zum Sieg geführt, das stehende Heer, dessen Disziplin gänzlich dahin war, wäre bei einem Aufstand in Masse dem Volk nicht entgegengetreten, und wäre dann unter flatternden Fahnen der Republikaner die Wahl zur konstituierenden Versammlung des deutschen Volkes vorgenommen worden, ein Nationalkonvent voll großartiger Energie und schöpferischer Kraft hätte im Bündnis mit Frankreich Europa neu gestaltet.
Wir standen auf – wir unterlagen, weil bei dem Volk der Mut der Tat nicht mit dem Mut des Wortes gleichkam.
„Wir wollen das Parlament abwarten!“
Nun, ihr habt euer Parlament! Seid ihr frei? Seid ihr glücklich? Ihr habt den Vertröstern auf das Parlament mehr Gehör geschenkt als denen, welche mit dem Schwerte auszogen und euch voraussagten, fast wörtlich voraussagten, was das Parlament euch bringen werde, und – seid ihr frei, seid ihr glücklich?
Als die Erhebung für die deutsche Republik aber unterlegen war, eu wurden die Besiegten geschmäht und gehöhnt (…). Bald sah das Volk ein, dass seine Errungenschaft sich in nichts auslösen würde, und ich habe in fast jedem meiner leitenden Artikel des Volksfreundes die Lage der Dinge und was die Zukunft bringen werde, dargelegt und vorausgesagt.
Was tat das Volk? Sorgte es für seine Bewaffnung, scharte es sich auf seinen Sammelplätzen mit der Entschlossenheit zu handeln? Ihr klagt über Reaktion? Was ist Reaktion? Reaktion ist nichts anderes als die Entfaltung der Tätigkeit der friedlichen politischen Partei. Ist eine Reaktion möglich, wenn das Volk wach und tätig ist? Nimmermehr! Wer über Reaktion klagt, der klagt nur über seine eigene Feigheit und Untätigkeit, stellt sich selbst ein Armutszeugnis aus. Der Feind kann sich nicht erheben, wenn ich selbst ihm keine Muße, keine Zeit lasse, sich zu sammeln Während wir, die wir mit dem Schwert aufgestanden, im Stich gelassen und an den Strand geworfen waren, mit tiefem, verzehrendem Schmerz, mit dem herbsten Groll und heißem Ingrimm über die Grenze nach den waldigen Bergen, nach den schönen Tälern des Vaterlandes, das uns ausgestoßen hatte, blickten, und harrten der Tatkraft des Volkes, welches das Schiff des Volksstaates wieder flott machen und seine geächteten Söhne an Bord nehmen sollte, während wir in den aus dem tiefsten Hetzen entströmten Zurufen Ansprachen, Proklamationen neu appellierten an die Begeisterung, an die Scham, was ist geschehen? Die Menschen machen die Ereignisse, sie fallen nicht vom Himmel, hilf dir selbst, so wird dir Gott helfen; helfen kann nur die gewaltige Tat, die revolutionäre Volkstat, nicht das Hoffen und Harren, nicht papierne Adressen und Petitionen, nicht Festschmäuse und Toaste, nicht das Singen von Heckerliedern und anderen Gesängen. Mit bitterem Schmerz um Volk, Vaterland und Freiheit habe ich seit Monaten am Strande der Verbannung gelegen und zurückgeblickt auf ein bewegtes, tätiges, arbeitsames öffentliches Leben, auf den Strom der Revolution, auf welchem ich mit am Ruder gesessen (…). Ich muss ein Feld der schöpferischen Wirksamkeit, der Tätigkeit bauen, ich kann nicht müßig liegen, versiechen, verkümmern; ich kann nicht zehren und glücklich sein in der Feier meines Namens, ich bin von jeher ein Feind von Personalhuldigungen gewesen, das Volk soll sich nicht an Namen hängen, es soll sich begeistern, erglühen für die Tat der Befreiung, es soll handeln, handeln, dann können auch die Geächteten wieder unter euch treten, wieder mitarbeiten zur Errichtung des Freistaates, zur Gründung der deutschen Republik. Wer aber die Hände in den Schoß legt oder bei Wein und Schmaus nur die Faust macht und droht, „wart‘ nur, wenn die Verbannten kommen“, der hat seine Schuldigkeit nicht getan, im Gegenteil, er beweist damit, dass er ein großes Maul, aber ein kleines Herz habe, denn er weiß recht wohl, dass ein einziger Mann, dass ein Häuflein verbannter Männer allein ihm die Republik nicht bringen können, dass das Volk sie sich nehmen muss; dass der Freiheitsdrang sich tatsächlich kund geben und es uns zeigen muss, wie es ernstlich will, und so uns eine Gasse bahnen, auf dass wir wieder mitkämpfen und ringen, einreißen und bauen können. Eine bessere Musil als die Hochs und Vivats, als die Lieder und Trinksprüche ist das Klirren der Waffen für die Freiheit entschlossener Männer, ist das grollende Murren und das wilde Rufen einer versammelten, zur Durchsetzung ihres Rechtes entschlossenen Menge. Eure Tyrannen haben das Zittern noch nicht verlernt, verlernt ihr das Handeln nicht!
Aber ebenmäßig zum Überdruss wie zum Schmerze wirkt es, wenn man statt der Handlung nur großprahlerisches Maulen wahrnehmen und in der Erwartung, tätig wirken zu können, ebenso getäuscht wird, als es mit den Akklamationen, Deputationen, Versicherungen und Aufforderungen im Frühjahr vor dem Aufstande der Fall war. (…).
Die öffentlichen Blätter sagen euch, ich habe vor, eine Reise zu dem größten und freiesten der Völter zu machen, welches im Begriff steht, die am alle vier Jahre wiederkehrende, das ganz Volk in Bewegung setzende Handlung der Präsidentenwahl vorzunehmen. Die öffentlichen Blätter haben wahr geredet, und ohne mein Vorwissen hat der zweite in Rheinfelden wohnende Redakteur der „Volksfreundes“ einen Artikel abdrucken lassen, welcher einen Zweifel an meinem Vorhaben erwecken könnte.
Ja, ich will eine Reise unternehmen zu jenem gewaltigen Bürgervolk, welches von Völkern der alten Welt zuerst das Licht der Freiheit angezündet und der republikanischen Freiheit die Weltherrschaft sichern wird, ich will nicht in verzehrender Untätigkeit oder eitler Projektemacherei an den Grenzen Deutschlands müßig liegen, und zerrütten an Geist und Leib, kein verkommender und verkommener Flüchtling sein oder werden. Ich will mit eigenen Augen sehen und erforschen die Einrichtung jenes größten und freiesten der Völker, ich will und hoffe dorten tätig sein und wirken zu können für das Land, aus welchem wir republikanische Fluchtlinge ausgestoßen liegen im Exil. Erhebt sich Deutschlands Volk zur republikanischen Tat gedenkt es seiner Söhne, welche zuerst ausgezogen sind für die deutsche Republik, dann noch will es ihre Kraft benutzen, schnell ist der Ozean durchfurcht, zwei Wochen reichen hin, und die Verbannten können unter euch sein, und neu gestärkt durch das Leben unter jenen tapferen Männern der vereinigten Staaten, reich an Erfahrungen durch eigene Anschauung jenes großen Staatsverbandes von 30 Republiken, neue Kraft dem Vaterland zubringen.
Schart euch um die Männer, welche das Banner der Volkssouveränität hoch und bei demselben treue Wache halten, um die Männer der äußersten Linken zu Frankfurt a. M., schließt euch in Rat und Tat fest an die tapferen Führer der republikanischen Schilderhebung, ihre Namen seien euch feste Gedenksäulen, von ihnen werdet ihr meine Nachrichten, Berichte und briefliche Mitteilungen über die Erlebnisse in der Union erfahren.
Breitet aus die Saat, welche diesen Frühling gesät wurde, bereitet die Tat, dass die sich die Schwester- Republiken der Vereinigten Staaten Amerikas und Deutschlands die Hände reichen mögen zum festesten Verbande, den Völkern allen zur Befreiung.
Sie werde, die deutsche Republik!
Der badische Landtag von 1842, in Georg Herwegh: Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz. Kritik der preußischen Zustände, Zürich und Winterthur 1843, S. 33ff; Nachdruck Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1989, S. 108-135.
Die staatsrechtlichen Verhältnisse der Deutschkatholiken mit besonderem Hinblick auf Baden, Verlag Julius Groos, Heidelberg 1845, S. III-VIII und S. 1-38.
Nur die Republik ist Deutschlands Rettung (Flugschrift 1848). Frankfurt a. Main 1848, Universitätsbibliothek Frankfurt a. M., Signatur Sf 16/108, Nr. 1.
Die Erhebung des Volkes in Baden für die deutsche Republik im Frühjahr 1848, Reprint (der Ausg.) Schabelitz, Basel 1848; Köln: ISP, 1997.
Des Menschen Recht. Vorrede zur deutschen Ausgabe (1851) des 1791 auf Englisch erschienenen Buches von Thomas Paine: Die Rechte des Menschen. Eine Antwort auf Burke’s Angriff gegen die französische Revolution, Arnoldische Buchhandlung, Leipzig 1851.
Abschieds-Worte an das deutsche Volk, Beilage zu Nr. 15 der Dresdner Zeitung für sächsische und allgemein deutsche Zustände, 18. Oktober 1848.
Reden und Vorlesungen, Wentworth Press 2018.
Sabine Freitag: Friedrich Hecker. Biographie eines Republikaners, Franz Steiner Verlag 1998.
Kurt Hochstuhl: Friedrich Hecker. Revolutionär und Demokrat, Verlag Kohlhammer 2011.
Wir nutzen Cookies und ähnliche Technologien, um Geräteinformationen zu speichern und auszuwerten. Mit deiner Zustimmung verarbeiten wir Daten wie Surfverhalten oder eindeutige IDs. Ohne Zustimmung können einige Funktionen eingeschränkt sein.