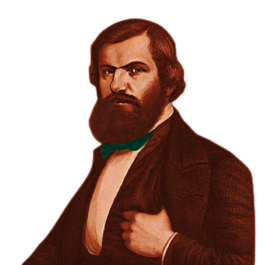
HUGO WESENDONCK
Abb.: Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, PORT_00070493_01.
Der 1817 als Sohn einer Elberfelder Kaufmannsfamilie geborene Hugo Wesendonck gehörte zu den jüngsten Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung. Während seines Studiums der Rechtswissenschaften zeigte er ein besonderes Engagement in der Studentenbewegung. Für seinen Studienabschluss wechselte er an die Berliner Universität, wo er auch einen einjährigen Militärdienst in der preußischen Armee absolvierte. Nach seinem bestandenen Staatsexamen zog er 1842 nach Düsseldorf und praktizierte dort als Anwalt. Aufgrund der von der preußischen Obrigkeit stark eingeschränkten politischen Teilhabe engagierte sich Wesendonck leidenschaftlich für den Düsseldorfer Karneval, der ihm und vielen anderen als Ersatz für die fehlende politische Öffentlichkeit diente. Gleichzeitig stellte sein Haus einen Angelpunkt der örtlichen Opposition dar. Zu Beginn der Märzrevolution stand Wesendonck an der Spitze der liberalen Bewegung in Düsseldorf und wurde zum Vorsitzenden des von ihm mitgegründeten „Vereins für demokratische Monarchie”. Als Abgeordneter in der Frankfurter Nationalversammlung rückte er von seinen zunächst noch mit der Monarchie vereinbaren Vorstellungen ab und schloss sich den Demokraten an. Bis zum Ende dem Rumpfparlament angehörend, sah sich Wesendonck nach dem Ende der Revolution des Hoch- und Staatsverrats angeklagt und floh über Umwege in die Vereinigten Staaten. Hier etablierte er sich als erfolgreicher Geschäftsmann, engagierte sich jedoch bis zu seinem Tod 1900 auf politischem und gesellschaftlichem Gebiet.
Hugo Wesendonck wurde am 24. April 1817 in Elberfeld geboren.
Im Jahr 1837 begann Hugo Wesendonck in Bonn ein Studium der Rechtswissenschaft, das er in Berlin beendete.
Hugo Wesendonck zog 1842 nach Düsseldorf, wo er fortan als Anwalt arbeitete. Bis zur Märzrevolution beteiligte er sich in zahlreichen Karnevalsvereinen.
Nach dem Ausbruch der Revolution wurde Wesendonck Vorsitzender des von ihm mitgegründeten „Vereins für demokratische Monarchie”, gehörte in der Frankfurter Nationalversammlung jedoch schließlich radikaldemokratischen Fraktionen an.
Wesendonck blieb bis zum Ende des Rumpfparlaments Angehöriger der Nationalversammlung und wurde nach deren Ende des Hochverrats angeklagt. Er floh in die Vereinigten Staaten.
Im Jahr 1868 wurde Wesendonck durch die preußische Regierung begnadigt und konnte nach zwanzig Jahren im Exil erstmals wieder in seine Heimat zurückkehren. Er bereiste Deutschland bis zu seinem Lebensende mehrere Male, behielt seinen Lebensmittelpunkt aber in den USA.
Zwei Jahre vor seinem Tod hielt er in einer kurzen Broschüre seine Erinnerungen an die Revolution und ihre Protagonisten fest.
Hugo Wesendonck starb am 19. Dezember 1900 in New York.
Christian Jansen
Hugo Maximilian Wesendonck wurde am 24.4.1817 in einer reformierten Familie geboren, die vor der Gegenreformation Ende des 16. Jahrhundert aus den Niederlanden geflohen und ins Rheinland eingewandert war. Sein Vater August Wesendonck (1785-1857) arbeitete als Seidenfärber in Elberfeld (heute Teil von Wuppertal), seine Mutter Sophia Scholten (1791-1824) stammte aus Moers. Er wuchs in bürgerlichen Verhältnissen mit vier Geschwistern auf.
Nach dem Abitur auf dem Elberfelder Gymnasium 1834 studierte Wesendonck Jura in Bonn, wo er sich im 1832 gegründeten Corps Saxonia engagierte. 1836 ging er nach Berlin, wo er parallel zur Fortsetzung seines Studiums seinen einjährig-freiwilligen Militärdienst beim Gardeschützen-Bataillon leisten konnte. Nach dem ersten juristischen Examen (1837 in Berlin) arbeitete er als unbesoldeter Auskultator, dann als Referendar am Bezirksgericht Elberfeld. Nach dem 2. Examen 1842 ließ sich Wesendonck als Anwalt in Düsseldorf nieder. Die Enteignungsverfahren für Flächen, die für den Bau der Köln-Mindener-Eisenbahngesellschaft benötigt wurden, und der Aufsehen erregende Scheidungsprozess der Gräfin Sophie von Hatzfeldt (1805-81), die er zusammen mit ihrem Lebensgefährten Ferdinand Lassalle (1825-1864) vertrat, brachten Wesendonck ein hohes Maß an öffentlicher Bekanntheit. Im Vormärz war ein prominentes Mitglied der liberalen Opposition und engagierte sich sowohl im Vorstand der 1833 gegründeten Bürgergesellschaft „Zur Ludwigsburg“, einem exklusiven bürgerlichen Herrenclub, als auch im populären „Allgemeinen Verein der Carnevalsfreunde“. Karneval war vielerorts im Rheinland ein Ventil für das durch Zensur und Vereins- und Organisationsverbote eingeschränkte politische Leben. So forderte der preußische Innenminister 1847 das Verbot der „Carnevalsfreunde“, weil der Verein prominenten liberalen Nationalisten wie Ernst Moritz Arndt und Friedrich Christoph Dahlmann künstlerisch gestaltete Ehrenurkunden verlieh, um damit die bürgerlichen Forderungen nach einem liberalen deutschen Nationalstaat zu unterstreichen. Wesendonck war 1845 führend beteiligt an dem Versuch, durch Petitionen Reformen in Preußen und einen engeren Zusammenschluss der deutschen Staaten einzufordern („Adressensturm“). In seinem Haus verkehrten radikale oppositionelle Dichter und Intellektuelle wie Wolfgang Müller von Königswinter (1816-73), ein Freund Heines, der eigentlich Peter Wilhelm Müller hieß und in Düsseldorf als praktischer Arzt arbeitete, der böhmisch-jüdische Republikaner Moritz Hartmann (1821-72), revolutionäre Lyriker Ferdinand Freiligrath (1810-76), der Tübinger Germanistikprofessor und oppositionelle Landtagsabgeordnete Ludwig Uhland (1787-1862) und der materialistische und demokratische Naturwissenschaftler Carl Vogt (1817-1895). Dieses politische und Freundesnetzwerk begleitete ihn auch in die Parlamente der Revolutionszeit – die meisten saßen wie Wesendonck im Vorparlament und/oder in der Frankfurter Nationalversammlung. Weiterlesen
Bereits 1844 hatte Hugo Wesendonck in Düsseldorf Johanna-Wilhelmine Schramm (1820-89), eine Cousine zweiten Grades und Tochter des wohlhabenden Seidenfabrikanten Johann Schramm (1783-1840) aus Krefeld, geheiratet. Das Paar hatte drei Söhne und eine Tochter, von denen die ersten beiden – Max August (1845-1932) und Otto Friedrich (1846-84) – noch in Düsseldorf geboren wurden, die jüngeren – Toni (1855-1931) und Walter (1857-1934) – schon im Exil in Philadelphia.
Vom Beginn an engagierte sich Wesendonck in der Revolution. Am 3. März nahm eine von rund 500 Bürgern besuchte Versammlung eine von ihm formulierte politische Resolution mit den literarischen Märzforderungen an. Wegen seiner militärischen Erfahrung wurde Wesendonck auch Kompaniechef in der Düsseldorfer Bürgergarde. Vor allem aber gründete er Anfang April zusammen mit dem Kaufmann Lorenz Cantador für den Regierungsbezirk Düsseldorf einen „Verein für demokratische Monarchie“, eine frühe demokratische Partei, die sich am 18.4.1848 ein Statut gab, in dessen § 1 es hier: „Der Verein bezweckt, über den Grundsatz der Volksherrschaft, mit einem Fürsten an der Spitze, [...] zu belehren, und denselben zu verbreiten.“ Jeder mindestens 21jährige „Staatsbürger“ (es waren wohl nur Männer gemeint) konnte Mitglied werden, der Mitgliedsbeitrag betrug einen Silbergroschen monatlich, also den Preis für ein Bier (in heutiger Kaufkraft etwa 5 €), war also so niedrig, dass alle, die wollten, beitreten konnten. Intern galt Gleichheit, Beschlüsse wurden mit Mehrheit der Anwesenden gefällt.¹ Als Vorsitzender des „Vereins für demokratische Monarchie“ vertrat Wesendonck am Beginn der Revolution ein gemäßigt demokratisches Programm, das sich einerseits von den liberalen Honoratioren, andererseits aber auch vom gleichzeitig in Düsseldorf gegründeten „Volksklub“ abgrenzte, der die Republik und eine „sociale Demokratie“ forderte. wollte die Idee der Volkssouveränität mit der Idee der konstitutionellen Monarchie verbinden. Dieses im weiteren Verlauf der Revolution gescheiterte politische Programm zeugte einerseits von einem beachtlichen Realismus, dass die alten Mächte nicht einfach weichen würden. Andererseits spiegelte es die bis ins demokratische Lager verbreitete Hoffnung auf die Monarchen (den „guten König“), denen die öffentliche Meinung gute Absichten unterstellte, während sie die negativen Aspekte der Fürstenherrschaft schlechten Beratern und Ministern bzw. Beamten vor Ort anlasteten. Die meisten Demokraten, die anfangs auf Kompromisse mit den Monarchen setzten, wechselten im Laufe der Revolution aus Enttäuschung über die konterrevolutionäre Härte der meisten Fürsten ins republikanische Lager. Der Düsseldorfer Verein für demokratische Monarchie gewann rund 2.000 Mitglieder – die Stadt hatte damals ca. 26.000 Einwohner. Aufgrund dieser Aktivitäten delegierte die Stadt Düsseldorf ihn (zusammen mit Müller von Königswinter) ins Frankfurter Vorparlament, wo er zusammen mit Franz Raveaux, Robert Blum und Johann Jacoby einen gemäßigten Standpunkt einnahm, in dem sie bereit waren sich Mehrheitsbeschlüssen zu unterwerfen, die ihren Ansichten zuwiderliefen, während andere Demokraten eine putschistische Strategie wählten.
Bei den Wahlen zur Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt/Main und zur (konkurrierenden) preußischen Nationalversammlung gewann der Verein für demokratische Monarchie sämtliche Düsseldorfer Mandate: in die Paulskirche entsandten die Wähler Hugo Wesendonck, in die Berliner Nationalversammlung zwei andere demokratische Aktivisten: Josef Euler (1804-1886) und Anton Bloem (1814-1884). Auch bei den Kommunalwahlen, die ebenfalls im Mai 1848 stattfanden, bei denen aber nur diejenigen wählen durften, die das Bürgerrecht hatten (etwa ein Viertel der männlichen Bevölkerung), gewannen die Kandidaten des Vereins für demokratische Monarchie 17 von 19 Mandaten. Dieser eindrucksvolle Wahlerfolg der Demokraten zeigt, dass das Bürgertum im Rheinland politisch viel weiter links stand als etwa in Berlin, wo Konservative die Kommunalwahlen gewannen und dies als Beleg gedeutet wurde, „wie sehr die Reaktion unter unserer Bürgerschaft um sich greift“² – nur zwei Monate nach dem Beginn der Revolution, die das Bürgertum zunehmend verschreckte. Im August kam es zu einem weiteren Vorfall, der die Stärke der demokratischen Bewegung, aber auch die vehementen antipreußischen Ressentiments in Düsseldorf belegt. Auf einer Hauptstraße bewarfen Demonstranten König Friedrich Wilhelm IV. bei einem Besuch mit Pferdeäpfeln. Nach der Niederschlagung der Revolution musste die Stadt die Straße „zur Sühne“ in „Königsallee“ (heute „Kö“) umbenennen.
In der Paulskirche schloss sich Wesendonck zunächst den gemäßigten Demokraten (Deutscher Hof) an, im Sommer radikalisierte er sich und wechselte zum republikanischen Donnersberg. Er blieb in der Nationalversammlung bis zur gewaltsamen Auflösung in Stuttgart am 18. Juni 1849 an und engagierte sich im Ausschuss für Gesetzgebungsangelegenheiten, u.a. für die Schaffung eines Volksheers – eines der klassischen demokratischen Vorhaben 1848/49. In den ersten Wochen der Verhandlungen in der Paulskirche meldete Wesendonck sich in fast allen wichtigen Debatten zu Wort – von der Ausarbeitung einer parlamentarischen Geschäftsordnung über die Bildung einer Zentralgewalt bis zur Pressefreiheit und dem Vereinsrecht.
Die Debatte Anfang September über den Waffenstillstand in Schleswig-Holstein markierte einen Wendepunkt für die Haltung Wesendoncks zur Paulskirche, wie für die Demokraten insgesamt. Er argumentierte wie fast alle Demokraten gegen die Annahme des Vertrags, der unter dem Druck der Großmächte die um Unabhängigkeit von Dänemark kämpfenden Schleswig-Holsteiner zur Aufgabe zwang. Vor Wesendonck hatte der liberale Unterstaatssekretär im Innenministerium der provisorischen Reichsregierung Friedrich Bassermann den Vertrag mit realpolitischen Argumenten verteidigt. Die revolutionäre Regierung sei in einer schwachen Position, die sie nicht überreizen dürfe, um nicht alle Errungenschaften und Möglichkeiten der Revolution zu verspielen. Er verwies auf die US-Revolution, die auch Rückschläge erlitten und Zugeständnisse aus Schwäche habe machen müssen, aber letztlich gesiegt habe. Wesendonck setzte gegen diese Vorsicht, die er als Angstmacherei abtat, eine rigorose Moral: „das wenige Vertrauen, welches in Deutschland zu dieser Versammlung noch herrscht,“ werde „ganz und gar zu Grabe getragen, wenn wir uns nicht einmal zu einer großen und kühnen That erheben können.“ Er beschwor „das Recht der Revolution“: es wäre „ein schmachvolles Unrecht von uns, wenn wir einem unter solchen Umständen abgeschlossenen Waffenstillstand unsere Zustimmung ertheilen wollten“. Gegen praktische und wirtschaftliche Argumente, die für den Waffenstillstand ins Feld geführt würden und denen Wesendonck zuvor zugänglich war, argumentierte er nun: „Man darf bei so großen und wichtigen Fragen nicht nach dem Geldsäckel messen, sondern nach der Ehre Deutschlands, und wir wollen uns [...] nicht bestimmen lassen, unsere Ehre zu verleugnen.“³ Die Mehrheit der Abgeordneten folgte dem nationalistischen Voluntarismus und den Vorwürfen des Verrats deutscher Interessen an die preußische Regierung, den Wesendonck und viele andere, liberale wie demokratische Nationalisten, vertraten, und lehnte den Waffenstillstand ab. Da die Abstimmung die Regierung in eine Zwickmühle brachte – nationalistische Forderungen gegen die Großmächte durchsetzen zu sollen, ohne über Machtmittel wie eine schlagkräftige Armee zu verfügen, trat sie zurück. Zehn Tage später revidierte eine knappe Mehrheit die Entscheidung unter dem Eindruck der wachsenden Gegenrevolution.
Die demokratischen Proteste gegen diesen Beschluss, den die Demokraten als Verrat an der Revolution begriffen, war die „Septemberrevolution“, ein Aufstand, bei dem zwei konservative Paulskirchenabgeordnete ums Leben kamen. Auf einer Volksversammlung mit mehr als 10.000 Teilnehmer*innen, zu der die Demokraten mobilisiert hatten, sprach auch Wesendonck. Das „rheinische Triumvirat“, zu dem neben dem Düsseldorfer +Wesendonck der Trierer Ludwig Simon und der Kölner Franz Raveaux gehörten, hatte sich unter dem Eindruck der revolutionären Massenmobilisierung – auch an anderen Orten gab es Aufstände – radikalisiert und plädierten für eine Auszug der Demokraten aus der Nationalversammlung, die sich als revolutionäre Legislative konstituieren sollten. Robert Blum konnte sie aber überzeugen, ihre Mandate weiter auszuüben. Einstweilen fuhr Wesendonck zweigleisig: er nahm Ende Oktober am 2. Demokratenkongress und am revolutionären „Gegenparlament“ in Berlin statt, das unter mangelnder Beteiligung litt, während der Kongress sich im Sektierertum radikaler, sozialistischer und kommunistischer Gruppen aufrieb.⁴ In den folgenden 14 Tagen erzielte die Gegenrevolution einen Erfolg nach dem anderen: an einem der vielen geschichtsträchtigen 9. November der deutschen Geschichte wurden die preußische Nationalversammlung nach Brandenburg/Havel verlegt und Robert Blum rechtswidrig in Wien hingerichtet, am 10. November marschierte General v. Wrangel ins revolutionäre Berlin ein, verhängte am 12. den Belagerungszustand und am 14. das Kriegsrecht. Angesichts dieses politischen Umschwungs kehrten Wesendonck und die anderen demokratischen Abgeordneten in die Paulskirche zurück und waren maßgeblich am erfolgreichen Abschluss ihrer Arbeiten beteiligt.
Trotz aller Niederlagen im Herbst 1848 gründeten sie am 21. November 1848 in Frankfurt/Main sogar eine neue demokratische Partei als „linke Einheitsfront im Kampf gegen rechts“ (Valentin): den Centralmärzverein (CMV), zu dem sich die drei demokratischen Fraktionen in der Paulskirche Westendhall, Deutscher Hof und Donnersberg zusammenschlossen. Wesendonck wurde Schriftführer dieser ersten überregionalen demokratischen Massenorganisation, die bis März 1849 ca. 950 Ortsvereine (meistens integrierten sie bestehende Volks- oder Vaterlandsvereine) mit ca. 500.000 Mitgliedern bildete. Der Centralmärzverein war die erste moderne Partei in Deutschland, auch an dieser folgenreichen politischen Innovation war Hugo Wesendonck maßgeblich beteiligt. Das CMV-Programm vom 29. November 1848 buchstabierte die Idee der Volkssouveränität noch einmal aus: „Wir wollen die Einheit Deutschlands; wir wollen, daß die Freiheit als das natürliche Eigenthum der Nation anerkannt werde, nicht als ein Geschenk oder eine Gabe, die ihm nach Belieben von irgend einer Seite zugemessen wird; wir wollen, daß die Nation die Einschränkungen dieser Freiheit selbst bestimmt und sich nicht aufdrängen läßt, daß aber ein Jeder sich diesen Einschränkungen zu unterwerfen hat; wir wollen die Berechtigung für das Gesammtvolk, wie für das Volk eines jeden einzelnen Landes, sich seine Regierungsform selbst festzusetzen und einzurichten, zu verbessern und umzugestalten, wie es ihnen zweckdienlich erscheint, weil jede Regierung nur um des Volks willen und durch seinen Willen da ist.“⁵ In seinem neuen Amt als Schriftführer des Centralmärzverein gab Wesendonck bis zur gewaltsamen Auflösung der Deutschen Nationalversammlung die „Parlamentskorrespondenz der Linken“ heraus, das wichtigste Organ für die Öffentlichkeitsarbeit der Demokraten, das wie eine Presseagentur Berichte an Lokalzeitungen lieferte. Am 5. Februar 1849 wählte der Wahlkreis Koblenz Wesendonck neben seinem Mandat in der Nationalversammlung auch noch in die Zweite Kammer des preußischen Landtags. Dass der Centralmärzverein seinen prominenten Köpfen ein solche Doppelbelastung zumutete (zwischen Berlin und Frankfurt/M. zu „pendeln“ war unter den damaligen Verkehrsverhältnissen eine Herausforderung!), lag daran, dass die Parteiführung glaubte, dass der Schwerpunkt der Entscheidungen sich nach Berlin verlagerte.
Nach der Niederschlagung der Revolution flüchtete Wesendonck über die Schweiz und Paris, wo er seine Frau und die beiden Söhne wieder traf, nach New York, wo er bereits am 6. Dezember 1849 ankam. Am 28. September 1850 verurteilte ihn ein Düsseldorfer Gericht in Abwesenheit wegen Hochverrats und Majestätsbeleidigung zum Tode. Es war eine übliche Vorgehensweise der Gerichte, abwesende Angeklagte zum Tode zu verurteilen, während anwesende Gefängnis- oder Zuchthausstrafen bekamen.
Da sein Bruder Otto im Vormärz bereits in New York als Seidenhändler gearbeitet und gute Kontakte unter den dortigen Deutschen hatte, fasste Wesendonck relativ leicht und rasch Fuß n den USA. In Philadelphia gründete er – in den Fußstapfen seines Bruders – ein schnell florierendes Handelsgeschäft mit Seide, Manufaktur- und Kurzwaren. 1858 gehörte er zu den Gründern und seitdem zum Vorstand der Deutschen Spar-Bank/German Savings Bank (seit 1918 Central Savings Bank). 1859 übersiedelte Wesendonck nach New York, wo er 1860 Präsident der Germania Life Insurance Company wurde, die vor allem Deutsche versicherte (heute Guardian Life Insurance). Er engagierte sich auch weiter politisch und war in Philadelphia 1856 Präsident des Deutschen Republikanischen Zentralklubs; in New York dann Vizepräsident der German Patriotic Aid Society (später: German Union League of New York), seit 1862 Vizepräsident der Grand German Union Rally und seit 1863 Mitglied des Exekutivkomitees der Loyal National League Mitglied der German Society of New York, außerdem in deutschen gesellig-kulturellen Vereinen wie dem German Liederkranz of New York und der German Society. In New York gründete er außerdem 1861 zusammen mit seiner Ehefrau und Gustav Kutter (1829-76) das German Hospital (seit 1918 Lenox Hill Hospital). Während des Bürgerkriegs stand er als führendes Mitglied mehrerer politischer Organisationen der Deutschamerikaner auf der Seite der Unionisten.
Im Herbst 1862 kehrte er zum ersten Mal nach Europa zurück – zur Gedenkfeier für den Breslauer Demokraten und Paulskirchenabgeordneten Heinrich Simon in Murg (Schweiz), wo sich viele prominente Achtundvierziger wiedersahen. Nach seiner Begnadigung durch den preußischen König im Jahre 1868 besuchte Wesendonck Deutschland bis 1900 regelmäßig und baute seine Geschäftsbeziehungen in die alte Heimat aus. Zum feierlichen 50. Jubiläum der Paulskirchenversammlung konnte Wesendonck 1898 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr reisen, schickte aber einen Text „Erinnerungen aus dem Jahr 1848“ (New York 1898). Erst ein Jahr zuvor, mit 80 Jahren, hatte er sich als Präsident der Germania Life Insurance Company und aus dem Vorstand der German Savings Bank in den Ruhestand zurückgezogen. Hugo Wesendonck starb am 19. Dezember 1900 und wurde auf dem Green-Wood Cemetery in Brooklyn beigesetzt.
Im Vormärz und in der Revolution verkörperte Wesendonck die demokratische Minderheitsströmung, die für eine Monarchie mit allgemeinem gleichem Wahlrecht und starkem Parlament eintrat. 1849 radikalisierte er sich angesichts der Kompromisslosigkeit der preußischen Monarchie. In den USA war er wirtschaftlich sehr erfolgreich und mit Friedrich Hecker, Carl Schurz und Lorenz Brentano ein Prominenter unter den fast 10.000 deutschen Fortyeighters, die dort Zuflucht fanden. Er bewahrte sich als Nationaldemokrat seine Bindung an Deutschland – trotz der Enttäuschung seiner politischen Hoffnungen und der rachsüchtigen Behandlung durch Preußen, das die führenden Demokraten 20 Jahre lang bespitzelte und als letzte Gruppe unter den Achtundvierziger amnestierte.
Sein Bruder Otto (1815-96) war in jungen Jahren durch Seidenhandel sehr reich geworden und wirkte als Mäzen zusammen mit seiner ebenfalls aus Elberfeld stammenden Frau Agnes Luckemeyer (1828-1902), die er 1848 heiratete und die sich auf den Wunsch ihres Gatten nach dessen früh verstorbener erster Frau Mathilde nannte. Beide unterstützten in den 1850er Jahren unter anderen den in der Dresdener Mairevolution engagierten Demokraten und Antisemiten Richard Wagner im Schweizer Exil, der sich mit Widmungen erkenntlich zeigte. 1857/58 vertonte er fünf Gedichte Mathilde Wesendoncks (die heute sehr bekannten „Wesendonck-Lieder“). Seine Beziehung zum Ehepaar Wesendonck und seine platonische Liebe zu Mathilde verarbeitete und sublimierte Wagner in „Tristan und Isolde“.
1 Faksimile unbekannter Provenienz unter https://de.wikipedia.org/wiki/Verein_f%C3%BCr_demokratische_Monarchie
2 National-Zeitung (Berlin), 22.5.1848, zit. nach Rüdiger Hachtmann: Berlin 1848. Eine Politik- und Gesellschaftsgeschichte der Revolution, Bonn 1997, S. 302.
3 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main, hrsg. von Franz Wigard, Bd. III, Frankfurt 1848, S. 1890-1892.
4 Erhellend bis heute Veit Valentin: Geschichte der deutschen Revolution (1931), Köln 1977, hier S. 254f.
5 Gründungsaufruf, in: Deutsche Allgemeine Zeitung, 1.12.1848. Zitat und Zahlen: Valentin, S. 454f.
„Erlauben Sie mir, ein Beispiel anzuführen, um darzutun, dass es wichtig ist, dass wir diesen Antrag sofort in Beratung nehmen. Bei einer anderen konstituierenden Versammlung wurde Anlass gegeben, einen Beschluss zu fassen über die Zulassung eines Mitglieds. Der Dr. Valdenaire aus Trier war angeblich wegen seiner Teilnahme an politischen Umtrieben zu Trier zur Haft gezogen worden. Es wurde bei der Versammlung in Berlin der Antrag gestellt, den Dr. Valdenaire sofort einzuberufen. Man beschloss aber stattdessen eine Kommission zu ernennen, welche diese Frage zu prüfen habe. Die Kommission wurde ernannt, sie nahm die Prüfung vor, und was ist das Resultat derselben gewesen, und zu welchem Beschluss ist die Versammlung gekommen? Man sagte so: allerdings gesetzlich sollte jeder Abgeordnete unverletzlich sein, niemals sollte ein Anderes stattfinden können, aber wir befinden uns in der eigentümlichen Lage in Preußen, dass wir eben ein solches Gesetz in diesem Augenblick nicht besitzen. Der Beschluss war der, der Gerechtigkeit den Lauf zu lassen. Wir werden in die nämliche Lage kommen. Wir wissen, dass das Schwert der Gerechtigkeit über den Häuptern einiger der Abgeordneten schwebt. Wir können nicht dafür stehen, dass nicht einer Regierung einfallen kann, irgendeinen anderen Abgeordneten zur Verantwortlichkeit zu ziehen. Gegen solche Möglichkeiten müssen wir ein Gegenmittel anwenden; es besteht darin, dass wir die Unverletzlichkeit der Abgeordneten in dem Sinne des Antrags, den der Abgeordnete Leue am 23. Mai gestellt hat, und wie er heute von Herrn Schlöffel wiederholt worden ist, zum Parlamentsbeschluss erheben, und sofort zur Beratung übergehen.”¹
1 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main, hrsg. von Franz Wigard, Bd. I, Frankfurt 1848, S. 347.
„Ich bin der Meinung, dass die Abstimmung darüber, wo das Wahlrecht ausgeübt wird, nirgends hingehört, als in das Reichswahlgesetz. Es ist allerdings richtig, dass das Recht, zu wählen, eines der vorzüglichsten politischen Rechte ist, ein Recht, das jedem gewährt werden soll; aber dieses politische Grundrecht soll ja doch nicht in diesem Paragraphen und in diesem Zusatz mit diesen wenigen Worten abgetan werden. Die Absicht ist offenbar bei diesem Zusatz bloß die, eine Beschränkung zu treffen gegen die ausdehnende Interpretation des §1., worin es heißt, dass die Grundrechte, die jedem zustehen, überall ausgeübt werden können. […] Nicht nur das Militär, welches keinen festen Aufenthalt hat, nicht nur die Dienstboten würden alsdann von dem Wahlrecht ausgeschlossen sein, sondern noch eine ganz große Anzahl sonstiger Deutscher. Ich erinnere nur an die Studenten, die auch an dem Ort, wo sie ihren Studien obliegen, ihren festen Wohnsitz nicht haben. Einen festen Wohnsitz hat man nur da, wo man in der Absicht zu bleiben sich niedergelassen hat, nicht aber da, wo man nur vorübergehend einige Monate zubringen will. Ich erinnere an die Handwerker, die sich zur Ausbildung in ihrem Gewerbe auf Reisen begeben, und die namentlich in Deutschland in großer Anzahl von ihrem Wohnsitz kürzere oder längere Zeit abwesend sind. Durch die Annahme dieses Paragraphen, so wie er gefasst ist, würden wir gewiss mehr als eine Million Deutsche vom Wahlrecht ausschließen, und es muss doch unsere Absicht sein, dieses wichtigste aller politischen Rechte, soviel als möglich, jedem zugänglich zu machen. Ich würde mich daher, wenn hier eine Bestimmung darüber getroffen werden soll, dem anschließen, was Dr. Nauwerck vorgeschlagen hat, dass nämlich das Wahlrecht ausgeübt werde da, wo man sich zur Zeit des Wahlakts wirklich befindet. Sollte aber hiergegen ein erhebliches Bedenken aufgestellt werden, so würde das für mich doch noch kein Grund sein. Ich würde nunmehr zu dem Inhalt des Paragraphen übergehen und ich würde dann das Amendement vorschlagen:
‘Das Recht, zu wählen, übt jeder da aus, wo er sich seit 14 Tagen aufgehalten hat.’ Es hat dies die Erfahrung in einem der größten deutschen Einzelstaaten, in Preußen, für sich. Hier bestand der Unterschied bei den jetzigen Wahlen, dass zur Versammlung in Berlin nur der wählen konnte, der seit sechs Monaten seinen Wohnsitz an einem bestimmten Orte hatte, zur Nationalversammlung in Frankfurt am Main aber jeder wählen durfte, der seit 14 Tagen an einem bestimmten Orte sich aufhielt. Wenn Sie dies bedenken, meine Herren, so werden Sie es nicht unvernünftig finden, denn einerseits ist das Wahlrecht für jeden gesichert, andererseits unterbleibt das, wovor gewarnt worden ist, dass man etwa in Massen sichan einen Ort begäbe, um auf das Resultat der Wahlen zu influieren.”1
1 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main, hrsg. von Franz Wigard, Bd. I, Frankfurt 1848, S. 747.
„Was dagegen den dritten Zusatz anbetrifft, wonach alle bisher dazu ermächtigten Personen zur Vornahme von Haussuchung für berechtigt erklärt werden sollen, so bin ich der Meinung, dass es gerade die Bestimmung und Bedeutung des § 8 ist, hier eine Beschränkung eintreten zu lassen. Wollten wir hier an dem bisherigen gesetzlichen Zustande nichts ändern, so würde ich auch hier einen Zusatz für überflüssig erachten. Wir wollen aber ändern, wir wollen die Befugnisse der polizeilichen Gewalt beschränken. Bis daher hat man der Polizeigewalt in Deutschland, wenigstens in vielen Ländern, das Recht der Haussuchung in sehr ausgedehntem Maße zugestanden, und gerade dieses Recht wollen wir hier aufheben. […] Ich mache daher den Vorschlag, […] den Zusatz zu machen: ‘Eine Haussuchung darf nur aufgrund des Befehls eines Richters oder eines Beamten der gerichtlichen Polizei vorgenommen werden.’ […] Dagegen wünsche ich aber noch einen anderen Zusatz, nämlich den: ‘Und in Gegenwart eines solchen Beamten vorgenommen werden.’ Es sind gerade das hauptsächlich Gründe der Beschwerde bei Haussuchungen, dass sie von Beamten der niederen Polizei ausgeführt werden, und dass dabei mit einer Brutalität verfahren wird, welche zu gerechten Beschwerden Veranlassung gibt. Es leidet auch keinen Anstand, dass ein richterlicher Beamter oder einer der gerichtlichen Polizei zugezogen werden könne. Nur auf diese Weise, glaube ich, können wir Schutz gegen diejenige Art der Haussuchungen finden, über welche so häufig Klagen vorgekommen sind.
[…]
Das erste a linea1 stellt fest, es solle ein richterlicher Befehl vorher vorhanden sein, und wenn wir dies nun einmal festhalten, so sehe ich nicht ein, aus welchem Grunde der Beamte, welcher die Haussuchung vornimmt, nicht auch zugleich verpflichtet sein soll, den richterlichen Befehl vorzuzeigen, wenn er einmal vorhanden ist. Denn ist er da, und muss er vorhanden sein, so kann er ja auch dem Beamten ohne die geringste Schwierigkeit eingehändigt werden, und dieser kann ihn ebensowohl der beteiligten Person zustellen. […] Auch bin ich noch besonders der Meinung, dass er mit Motiven versehen sei, damit die Person, welche die Haussuchung erleiden soll, auch ersehen könne, aus welchem Grunde jene Polizeimaßregel vorgenommen werde.”2
1 Alter juristischer Begriff für Zeile oder Zusatz.
2 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main, hrsg. von Franz Wigard, Bd. III, Frankfurt 1848, S. 1579f.
Erinnerungen aus dem Jahre 1848, New York 1898.
Statut des Vereins für demokratische Monarchie, Düsseldorf 1848.
Best, Heinrich/Weege, Wilhelm: Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49, Düsseldorf 1996, S. 356f.
Jansen, Christian: Wesendonck, Hugo, in: Neue Deutsche Biographie (NDB, Bd. 27), Berlin 2020, S. 874f.
HUGO WESENDONCK
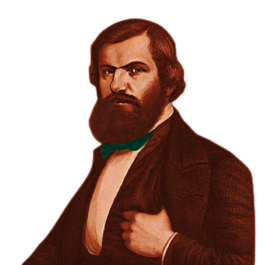
Abb.: Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, PORT_00070493_01.
Der 1817 als Sohn einer Elberfelder Kaufmannsfamilie geborene Hugo Wesendonck gehörte zu den jüngsten Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung. Während seines Studiums der Rechtswissenschaften zeigte er ein besonderes Engagement in der Studentenbewegung. Für seinen Studienabschluss wechselte er an die Berliner Universität, wo er auch einen einjährigen Militärdienst in der preußischen Armee absolvierte. Nach seinem bestandenen Staatsexamen zog er 1842 nach Düsseldorf und praktizierte dort als Anwalt. Aufgrund der von der preußischen Obrigkeit stark eingeschränkten politischen Teilhabe engagierte sich Wesendonck leidenschaftlich für den Düsseldorfer Karneval, der ihm und vielen anderen als Ersatz für die fehlende politische Öffentlichkeit diente. Gleichzeitig stellte sein Haus einen Angelpunkt der örtlichen Opposition dar. Zu Beginn der Märzrevolution stand Wesendonck an der Spitze der liberalen Bewegung in Düsseldorf und wurde zum Vorsitzenden des von ihm mitgegründeten „Vereins für demokratische Monarchie”. Als Abgeordneter in der Frankfurter Nationalversammlung rückte er von seinen zunächst noch mit der Monarchie vereinbaren Vorstellungen ab und schloss sich den Demokraten an. Bis zum Ende dem Rumpfparlament angehörend, sah sich Wesendonck nach dem Ende der Revolution des Hoch- und Staatsverrats angeklagt und floh über Umwege in die Vereinigten Staaten. Hier etablierte er sich als erfolgreicher Geschäftsmann, engagierte sich jedoch bis zu seinem Tod 1900 auf politischem und gesellschaftlichem Gebiet.
Hugo Wesendonck wurde am 24. April 1817 in Elberfeld geboren.
Im Jahr 1837 begann Hugo Wesendonck in Bonn ein Studium der Rechtswissenschaft, das er in Berlin beendete.
Hugo Wesendonck zog 1842 nach Düsseldorf, wo er fortan als Anwalt arbeitete. Bis zur Märzrevolution beteiligte er sich in zahlreichen Karnevalsvereinen.
Nach dem Ausbruch der Revolution wurde Wesendonck Vorsitzender des von ihm mitgegründeten „Vereins für demokratische Monarchie”, gehörte in der Frankfurter Nationalversammlung jedoch schließlich radikaldemokratischen Fraktionen an.
Wesendonck blieb bis zum Ende des Rumpfparlaments Angehöriger der Nationalversammlung und wurde nach deren Ende des Hochverrats angeklagt. Er floh in die Vereinigten Staaten.
Im Jahr 1868 wurde Wesendonck durch die preußische Regierung begnadigt und konnte nach zwanzig Jahren im Exil erstmals wieder in seine Heimat zurückkehren. Er bereiste Deutschland bis zu seinem Lebensende mehrere Male, behielt seinen Lebensmittelpunkt aber in den USA.
Zwei Jahre vor seinem Tod hielt er in einer kurzen Broschüre seine Erinnerungen an die Revolution und ihre Protagonisten fest.
Hugo Wesendonck starb am 19. Dezember 1900 in New York.
Christian Jansen
Hugo Maximilian Wesendonck wurde am 24.4.1817 in einer reformierten Familie geboren, die vor der Gegenreformation Ende des 16. Jahrhundert aus den Niederlanden geflohen und ins Rheinland eingewandert war. Sein Vater August Wesendonck (1785-1857) arbeitete als Seidenfärber in Elberfeld (heute Teil von Wuppertal), seine Mutter Sophia Scholten (1791-1824) stammte aus Moers. Er wuchs in bürgerlichen Verhältnissen mit vier Geschwistern auf.
Nach dem Abitur auf dem Elberfelder Gymnasium 1834 studierte Wesendonck Jura in Bonn, wo er sich im 1832 gegründeten Corps Saxonia engagierte. 1836 ging er nach Berlin, wo er parallel zur Fortsetzung seines Studiums seinen einjährig-freiwilligen Militärdienst beim Gardeschützen-Bataillon leisten konnte. Nach dem ersten juristischen Examen (1837 in Berlin) arbeitete er als unbesoldeter Auskultator, dann als Referendar am Bezirksgericht Elberfeld. Nach dem 2. Examen 1842 ließ sich Wesendonck als Anwalt in Düsseldorf nieder. Die Enteignungsverfahren für Flächen, die für den Bau der Köln-Mindener-Eisenbahngesellschaft benötigt wurden, und der Aufsehen erregende Scheidungsprozess der Gräfin Sophie von Hatzfeldt (1805-81), die er zusammen mit ihrem Lebensgefährten Ferdinand Lassalle (1825-1864) vertrat, brachten Wesendonck ein hohes Maß an öffentlicher Bekanntheit. Im Vormärz war ein prominentes Mitglied der liberalen Opposition und engagierte sich sowohl im Vorstand der 1833 gegründeten Bürgergesellschaft „Zur Ludwigsburg“, einem exklusiven bürgerlichen Herrenclub, als auch im populären „Allgemeinen Verein der Carnevalsfreunde“. Karneval war vielerorts im Rheinland ein Ventil für das durch Zensur und Vereins- und Organisationsverbote eingeschränkte politische Leben. So forderte der preußische Innenminister 1847 das Verbot der „Carnevalsfreunde“, weil der Verein prominenten liberalen Nationalisten wie Ernst Moritz Arndt und Friedrich Christoph Dahlmann künstlerisch gestaltete Ehrenurkunden verlieh, um damit die bürgerlichen Forderungen nach einem liberalen deutschen Nationalstaat zu unterstreichen. Wesendonck war 1845 führend beteiligt an dem Versuch, durch Petitionen Reformen in Preußen und einen engeren Zusammenschluss der deutschen Staaten einzufordern („Adressensturm“). In seinem Haus verkehrten radikale oppositionelle Dichter und Intellektuelle wie Wolfgang Müller von Königswinter (1816-73), ein Freund Heines, der eigentlich Peter Wilhelm Müller hieß und in Düsseldorf als praktischer Arzt arbeitete, der böhmisch-jüdische Republikaner Moritz Hartmann (1821-72), revolutionäre Lyriker Ferdinand Freiligrath (1810-76), der Tübinger Germanistikprofessor und oppositionelle Landtagsabgeordnete Ludwig Uhland (1787-1862) und der materialistische und demokratische Naturwissenschaftler Carl Vogt (1817-1895). Dieses politische und Freundesnetzwerk begleitete ihn auch in die Parlamente der Revolutionszeit – die meisten saßen wie Wesendonck im Vorparlament und/oder in der Frankfurter Nationalversammlung. Weiterlesen
Bereits 1844 hatte Hugo Wesendonck in Düsseldorf Johanna-Wilhelmine Schramm (1820-89), eine Cousine zweiten Grades und Tochter des wohlhabenden Seidenfabrikanten Johann Schramm (1783-1840) aus Krefeld, geheiratet. Das Paar hatte drei Söhne und eine Tochter, von denen die ersten beiden – Max August (1845-1932) und Otto Friedrich (1846-84) – noch in Düsseldorf geboren wurden, die jüngeren – Toni (1855-1931) und Walter (1857-1934) – schon im Exil in Philadelphia.
Vom Beginn an engagierte sich Wesendonck in der Revolution. Am 3. März nahm eine von rund 500 Bürgern besuchte Versammlung eine von ihm formulierte politische Resolution mit den literarischen Märzforderungen an. Wegen seiner militärischen Erfahrung wurde Wesendonck auch Kompaniechef in der Düsseldorfer Bürgergarde. Vor allem aber gründete er Anfang April zusammen mit dem Kaufmann Lorenz Cantador für den Regierungsbezirk Düsseldorf einen „Verein für demokratische Monarchie“, eine frühe demokratische Partei, die sich am 18.4.1848 ein Statut gab, in dessen § 1 es hier: „Der Verein bezweckt, über den Grundsatz der Volksherrschaft, mit einem Fürsten an der Spitze, [...] zu belehren, und denselben zu verbreiten.“ Jeder mindestens 21jährige „Staatsbürger“ (es waren wohl nur Männer gemeint) konnte Mitglied werden, der Mitgliedsbeitrag betrug einen Silbergroschen monatlich, also den Preis für ein Bier (in heutiger Kaufkraft etwa 5 €), war also so niedrig, dass alle, die wollten, beitreten konnten. Intern galt Gleichheit, Beschlüsse wurden mit Mehrheit der Anwesenden gefällt.¹ Als Vorsitzender des „Vereins für demokratische Monarchie“ vertrat Wesendonck am Beginn der Revolution ein gemäßigt demokratisches Programm, das sich einerseits von den liberalen Honoratioren, andererseits aber auch vom gleichzeitig in Düsseldorf gegründeten „Volksklub“ abgrenzte, der die Republik und eine „sociale Demokratie“ forderte. wollte die Idee der Volkssouveränität mit der Idee der konstitutionellen Monarchie verbinden. Dieses im weiteren Verlauf der Revolution gescheiterte politische Programm zeugte einerseits von einem beachtlichen Realismus, dass die alten Mächte nicht einfach weichen würden. Andererseits spiegelte es die bis ins demokratische Lager verbreitete Hoffnung auf die Monarchen (den „guten König“), denen die öffentliche Meinung gute Absichten unterstellte, während sie die negativen Aspekte der Fürstenherrschaft schlechten Beratern und Ministern bzw. Beamten vor Ort anlasteten. Die meisten Demokraten, die anfangs auf Kompromisse mit den Monarchen setzten, wechselten im Laufe der Revolution aus Enttäuschung über die konterrevolutionäre Härte der meisten Fürsten ins republikanische Lager. Der Düsseldorfer Verein für demokratische Monarchie gewann rund 2.000 Mitglieder – die Stadt hatte damals ca. 26.000 Einwohner. Aufgrund dieser Aktivitäten delegierte die Stadt Düsseldorf ihn (zusammen mit Müller von Königswinter) ins Frankfurter Vorparlament, wo er zusammen mit Franz Raveaux, Robert Blum und Johann Jacoby einen gemäßigten Standpunkt einnahm, in dem sie bereit waren sich Mehrheitsbeschlüssen zu unterwerfen, die ihren Ansichten zuwiderliefen, während andere Demokraten eine putschistische Strategie wählten.
Bei den Wahlen zur Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt/Main und zur (konkurrierenden) preußischen Nationalversammlung gewann der Verein für demokratische Monarchie sämtliche Düsseldorfer Mandate: in die Paulskirche entsandten die Wähler Hugo Wesendonck, in die Berliner Nationalversammlung zwei andere demokratische Aktivisten: Josef Euler (1804-1886) und Anton Bloem (1814-1884). Auch bei den Kommunalwahlen, die ebenfalls im Mai 1848 stattfanden, bei denen aber nur diejenigen wählen durften, die das Bürgerrecht hatten (etwa ein Viertel der männlichen Bevölkerung), gewannen die Kandidaten des Vereins für demokratische Monarchie 17 von 19 Mandaten. Dieser eindrucksvolle Wahlerfolg der Demokraten zeigt, dass das Bürgertum im Rheinland politisch viel weiter links stand als etwa in Berlin, wo Konservative die Kommunalwahlen gewannen und dies als Beleg gedeutet wurde, „wie sehr die Reaktion unter unserer Bürgerschaft um sich greift“² – nur zwei Monate nach dem Beginn der Revolution, die das Bürgertum zunehmend verschreckte. Im August kam es zu einem weiteren Vorfall, der die Stärke der demokratischen Bewegung, aber auch die vehementen antipreußischen Ressentiments in Düsseldorf belegt. Auf einer Hauptstraße bewarfen Demonstranten König Friedrich Wilhelm IV. bei einem Besuch mit Pferdeäpfeln. Nach der Niederschlagung der Revolution musste die Stadt die Straße „zur Sühne“ in „Königsallee“ (heute „Kö“) umbenennen.
In der Paulskirche schloss sich Wesendonck zunächst den gemäßigten Demokraten (Deutscher Hof) an, im Sommer radikalisierte er sich und wechselte zum republikanischen Donnersberg. Er blieb in der Nationalversammlung bis zur gewaltsamen Auflösung in Stuttgart am 18. Juni 1849 an und engagierte sich im Ausschuss für Gesetzgebungsangelegenheiten, u.a. für die Schaffung eines Volksheers – eines der klassischen demokratischen Vorhaben 1848/49. In den ersten Wochen der Verhandlungen in der Paulskirche meldete Wesendonck sich in fast allen wichtigen Debatten zu Wort – von der Ausarbeitung einer parlamentarischen Geschäftsordnung über die Bildung einer Zentralgewalt bis zur Pressefreiheit und dem Vereinsrecht.
Die Debatte Anfang September über den Waffenstillstand in Schleswig-Holstein markierte einen Wendepunkt für die Haltung Wesendoncks zur Paulskirche, wie für die Demokraten insgesamt. Er argumentierte wie fast alle Demokraten gegen die Annahme des Vertrags, der unter dem Druck der Großmächte die um Unabhängigkeit von Dänemark kämpfenden Schleswig-Holsteiner zur Aufgabe zwang. Vor Wesendonck hatte der liberale Unterstaatssekretär im Innenministerium der provisorischen Reichsregierung Friedrich Bassermann den Vertrag mit realpolitischen Argumenten verteidigt. Die revolutionäre Regierung sei in einer schwachen Position, die sie nicht überreizen dürfe, um nicht alle Errungenschaften und Möglichkeiten der Revolution zu verspielen. Er verwies auf die US-Revolution, die auch Rückschläge erlitten und Zugeständnisse aus Schwäche habe machen müssen, aber letztlich gesiegt habe. Wesendonck setzte gegen diese Vorsicht, die er als Angstmacherei abtat, eine rigorose Moral: „das wenige Vertrauen, welches in Deutschland zu dieser Versammlung noch herrscht,“ werde „ganz und gar zu Grabe getragen, wenn wir uns nicht einmal zu einer großen und kühnen That erheben können.“ Er beschwor „das Recht der Revolution“: es wäre „ein schmachvolles Unrecht von uns, wenn wir einem unter solchen Umständen abgeschlossenen Waffenstillstand unsere Zustimmung ertheilen wollten“. Gegen praktische und wirtschaftliche Argumente, die für den Waffenstillstand ins Feld geführt würden und denen Wesendonck zuvor zugänglich war, argumentierte er nun: „Man darf bei so großen und wichtigen Fragen nicht nach dem Geldsäckel messen, sondern nach der Ehre Deutschlands, und wir wollen uns [...] nicht bestimmen lassen, unsere Ehre zu verleugnen.“³ Die Mehrheit der Abgeordneten folgte dem nationalistischen Voluntarismus und den Vorwürfen des Verrats deutscher Interessen an die preußische Regierung, den Wesendonck und viele andere, liberale wie demokratische Nationalisten, vertraten, und lehnte den Waffenstillstand ab. Da die Abstimmung die Regierung in eine Zwickmühle brachte – nationalistische Forderungen gegen die Großmächte durchsetzen zu sollen, ohne über Machtmittel wie eine schlagkräftige Armee zu verfügen, trat sie zurück. Zehn Tage später revidierte eine knappe Mehrheit die Entscheidung unter dem Eindruck der wachsenden Gegenrevolution.
Die demokratischen Proteste gegen diesen Beschluss, den die Demokraten als Verrat an der Revolution begriffen, war die „Septemberrevolution“, ein Aufstand, bei dem zwei konservative Paulskirchenabgeordnete ums Leben kamen. Auf einer Volksversammlung mit mehr als 10.000 Teilnehmer*innen, zu der die Demokraten mobilisiert hatten, sprach auch Wesendonck. Das „rheinische Triumvirat“, zu dem neben dem Düsseldorfer +Wesendonck der Trierer Ludwig Simon und der Kölner Franz Raveaux gehörten, hatte sich unter dem Eindruck der revolutionären Massenmobilisierung – auch an anderen Orten gab es Aufstände – radikalisiert und plädierten für eine Auszug der Demokraten aus der Nationalversammlung, die sich als revolutionäre Legislative konstituieren sollten. Robert Blum konnte sie aber überzeugen, ihre Mandate weiter auszuüben. Einstweilen fuhr Wesendonck zweigleisig: er nahm Ende Oktober am 2. Demokratenkongress und am revolutionären „Gegenparlament“ in Berlin statt, das unter mangelnder Beteiligung litt, während der Kongress sich im Sektierertum radikaler, sozialistischer und kommunistischer Gruppen aufrieb.⁴ In den folgenden 14 Tagen erzielte die Gegenrevolution einen Erfolg nach dem anderen: an einem der vielen geschichtsträchtigen 9. November der deutschen Geschichte wurden die preußische Nationalversammlung nach Brandenburg/Havel verlegt und Robert Blum rechtswidrig in Wien hingerichtet, am 10. November marschierte General v. Wrangel ins revolutionäre Berlin ein, verhängte am 12. den Belagerungszustand und am 14. das Kriegsrecht. Angesichts dieses politischen Umschwungs kehrten Wesendonck und die anderen demokratischen Abgeordneten in die Paulskirche zurück und waren maßgeblich am erfolgreichen Abschluss ihrer Arbeiten beteiligt.
Trotz aller Niederlagen im Herbst 1848 gründeten sie am 21. November 1848 in Frankfurt/Main sogar eine neue demokratische Partei als „linke Einheitsfront im Kampf gegen rechts“ (Valentin): den Centralmärzverein (CMV), zu dem sich die drei demokratischen Fraktionen in der Paulskirche Westendhall, Deutscher Hof und Donnersberg zusammenschlossen. Wesendonck wurde Schriftführer dieser ersten überregionalen demokratischen Massenorganisation, die bis März 1849 ca. 950 Ortsvereine (meistens integrierten sie bestehende Volks- oder Vaterlandsvereine) mit ca. 500.000 Mitgliedern bildete. Der Centralmärzverein war die erste moderne Partei in Deutschland, auch an dieser folgenreichen politischen Innovation war Hugo Wesendonck maßgeblich beteiligt. Das CMV-Programm vom 29. November 1848 buchstabierte die Idee der Volkssouveränität noch einmal aus: „Wir wollen die Einheit Deutschlands; wir wollen, daß die Freiheit als das natürliche Eigenthum der Nation anerkannt werde, nicht als ein Geschenk oder eine Gabe, die ihm nach Belieben von irgend einer Seite zugemessen wird; wir wollen, daß die Nation die Einschränkungen dieser Freiheit selbst bestimmt und sich nicht aufdrängen läßt, daß aber ein Jeder sich diesen Einschränkungen zu unterwerfen hat; wir wollen die Berechtigung für das Gesammtvolk, wie für das Volk eines jeden einzelnen Landes, sich seine Regierungsform selbst festzusetzen und einzurichten, zu verbessern und umzugestalten, wie es ihnen zweckdienlich erscheint, weil jede Regierung nur um des Volks willen und durch seinen Willen da ist.“⁵ In seinem neuen Amt als Schriftführer des Centralmärzverein gab Wesendonck bis zur gewaltsamen Auflösung der Deutschen Nationalversammlung die „Parlamentskorrespondenz der Linken“ heraus, das wichtigste Organ für die Öffentlichkeitsarbeit der Demokraten, das wie eine Presseagentur Berichte an Lokalzeitungen lieferte. Am 5. Februar 1849 wählte der Wahlkreis Koblenz Wesendonck neben seinem Mandat in der Nationalversammlung auch noch in die Zweite Kammer des preußischen Landtags. Dass der Centralmärzverein seinen prominenten Köpfen ein solche Doppelbelastung zumutete (zwischen Berlin und Frankfurt/M. zu „pendeln“ war unter den damaligen Verkehrsverhältnissen eine Herausforderung!), lag daran, dass die Parteiführung glaubte, dass der Schwerpunkt der Entscheidungen sich nach Berlin verlagerte.
Nach der Niederschlagung der Revolution flüchtete Wesendonck über die Schweiz und Paris, wo er seine Frau und die beiden Söhne wieder traf, nach New York, wo er bereits am 6. Dezember 1849 ankam. Am 28. September 1850 verurteilte ihn ein Düsseldorfer Gericht in Abwesenheit wegen Hochverrats und Majestätsbeleidigung zum Tode. Es war eine übliche Vorgehensweise der Gerichte, abwesende Angeklagte zum Tode zu verurteilen, während anwesende Gefängnis- oder Zuchthausstrafen bekamen.
Da sein Bruder Otto im Vormärz bereits in New York als Seidenhändler gearbeitet und gute Kontakte unter den dortigen Deutschen hatte, fasste Wesendonck relativ leicht und rasch Fuß n den USA. In Philadelphia gründete er – in den Fußstapfen seines Bruders – ein schnell florierendes Handelsgeschäft mit Seide, Manufaktur- und Kurzwaren. 1858 gehörte er zu den Gründern und seitdem zum Vorstand der Deutschen Spar-Bank/German Savings Bank (seit 1918 Central Savings Bank). 1859 übersiedelte Wesendonck nach New York, wo er 1860 Präsident der Germania Life Insurance Company wurde, die vor allem Deutsche versicherte (heute Guardian Life Insurance). Er engagierte sich auch weiter politisch und war in Philadelphia 1856 Präsident des Deutschen Republikanischen Zentralklubs; in New York dann Vizepräsident der German Patriotic Aid Society (später: German Union League of New York), seit 1862 Vizepräsident der Grand German Union Rally und seit 1863 Mitglied des Exekutivkomitees der Loyal National League Mitglied der German Society of New York, außerdem in deutschen gesellig-kulturellen Vereinen wie dem German Liederkranz of New York und der German Society. In New York gründete er außerdem 1861 zusammen mit seiner Ehefrau und Gustav Kutter (1829-76) das German Hospital (seit 1918 Lenox Hill Hospital). Während des Bürgerkriegs stand er als führendes Mitglied mehrerer politischer Organisationen der Deutschamerikaner auf der Seite der Unionisten.
Im Herbst 1862 kehrte er zum ersten Mal nach Europa zurück – zur Gedenkfeier für den Breslauer Demokraten und Paulskirchenabgeordneten Heinrich Simon in Murg (Schweiz), wo sich viele prominente Achtundvierziger wiedersahen. Nach seiner Begnadigung durch den preußischen König im Jahre 1868 besuchte Wesendonck Deutschland bis 1900 regelmäßig und baute seine Geschäftsbeziehungen in die alte Heimat aus. Zum feierlichen 50. Jubiläum der Paulskirchenversammlung konnte Wesendonck 1898 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr reisen, schickte aber einen Text „Erinnerungen aus dem Jahr 1848“ (New York 1898). Erst ein Jahr zuvor, mit 80 Jahren, hatte er sich als Präsident der Germania Life Insurance Company und aus dem Vorstand der German Savings Bank in den Ruhestand zurückgezogen. Hugo Wesendonck starb am 19. Dezember 1900 und wurde auf dem Green-Wood Cemetery in Brooklyn beigesetzt.
Im Vormärz und in der Revolution verkörperte Wesendonck die demokratische Minderheitsströmung, die für eine Monarchie mit allgemeinem gleichem Wahlrecht und starkem Parlament eintrat. 1849 radikalisierte er sich angesichts der Kompromisslosigkeit der preußischen Monarchie. In den USA war er wirtschaftlich sehr erfolgreich und mit Friedrich Hecker, Carl Schurz und Lorenz Brentano ein Prominenter unter den fast 10.000 deutschen Fortyeighters, die dort Zuflucht fanden. Er bewahrte sich als Nationaldemokrat seine Bindung an Deutschland – trotz der Enttäuschung seiner politischen Hoffnungen und der rachsüchtigen Behandlung durch Preußen, das die führenden Demokraten 20 Jahre lang bespitzelte und als letzte Gruppe unter den Achtundvierziger amnestierte.
Sein Bruder Otto (1815-96) war in jungen Jahren durch Seidenhandel sehr reich geworden und wirkte als Mäzen zusammen mit seiner ebenfalls aus Elberfeld stammenden Frau Agnes Luckemeyer (1828-1902), die er 1848 heiratete und die sich auf den Wunsch ihres Gatten nach dessen früh verstorbener erster Frau Mathilde nannte. Beide unterstützten in den 1850er Jahren unter anderen den in der Dresdener Mairevolution engagierten Demokraten und Antisemiten Richard Wagner im Schweizer Exil, der sich mit Widmungen erkenntlich zeigte. 1857/58 vertonte er fünf Gedichte Mathilde Wesendoncks (die heute sehr bekannten „Wesendonck-Lieder“). Seine Beziehung zum Ehepaar Wesendonck und seine platonische Liebe zu Mathilde verarbeitete und sublimierte Wagner in „Tristan und Isolde“.
1 Faksimile unbekannter Provenienz unter https://de.wikipedia.org/wiki/Verein_f%C3%BCr_demokratische_Monarchie
2 National-Zeitung (Berlin), 22.5.1848, zit. nach Rüdiger Hachtmann: Berlin 1848. Eine Politik- und Gesellschaftsgeschichte der Revolution, Bonn 1997, S. 302.
3 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main, hrsg. von Franz Wigard, Bd. III, Frankfurt 1848, S. 1890-1892.
4 Erhellend bis heute Veit Valentin: Geschichte der deutschen Revolution (1931), Köln 1977, hier S. 254f.
5 Gründungsaufruf, in: Deutsche Allgemeine Zeitung, 1.12.1848. Zitat und Zahlen: Valentin, S. 454f.
„Erlauben Sie mir, ein Beispiel anzuführen, um darzutun, dass es wichtig ist, dass wir diesen Antrag sofort in Beratung nehmen. Bei einer anderen konstituierenden Versammlung wurde Anlass gegeben, einen Beschluss zu fassen über die Zulassung eines Mitglieds. Der Dr. Valdenaire aus Trier war angeblich wegen seiner Teilnahme an politischen Umtrieben zu Trier zur Haft gezogen worden. Es wurde bei der Versammlung in Berlin der Antrag gestellt, den Dr. Valdenaire sofort einzuberufen. Man beschloss aber stattdessen eine Kommission zu ernennen, welche diese Frage zu prüfen habe. Die Kommission wurde ernannt, sie nahm die Prüfung vor, und was ist das Resultat derselben gewesen, und zu welchem Beschluss ist die Versammlung gekommen? Man sagte so: allerdings gesetzlich sollte jeder Abgeordnete unverletzlich sein, niemals sollte ein Anderes stattfinden können, aber wir befinden uns in der eigentümlichen Lage in Preußen, dass wir eben ein solches Gesetz in diesem Augenblick nicht besitzen. Der Beschluss war der, der Gerechtigkeit den Lauf zu lassen. Wir werden in die nämliche Lage kommen. Wir wissen, dass das Schwert der Gerechtigkeit über den Häuptern einiger der Abgeordneten schwebt. Wir können nicht dafür stehen, dass nicht einer Regierung einfallen kann, irgendeinen anderen Abgeordneten zur Verantwortlichkeit zu ziehen. Gegen solche Möglichkeiten müssen wir ein Gegenmittel anwenden; es besteht darin, dass wir die Unverletzlichkeit der Abgeordneten in dem Sinne des Antrags, den der Abgeordnete Leue am 23. Mai gestellt hat, und wie er heute von Herrn Schlöffel wiederholt worden ist, zum Parlamentsbeschluss erheben, und sofort zur Beratung übergehen.”¹
„Ich bin der Meinung, dass die Abstimmung darüber, wo das Wahlrecht ausgeübt wird, nirgends hingehört, als in das Reichswahlgesetz. Es ist allerdings richtig, dass das Recht, zu wählen, eines der vorzüglichsten politischen Rechte ist, ein Recht, das jedem gewährt werden soll; aber dieses politische Grundrecht soll ja doch nicht in diesem Paragraphen und in diesem Zusatz mit diesen wenigen Worten abgetan werden. Die Absicht ist offenbar bei diesem Zusatz bloß die, eine Beschränkung zu treffen gegen die ausdehnende Interpretation des §1., worin es heißt, dass die Grundrechte, die jedem zustehen, überall ausgeübt werden können. […] Nicht nur das Militär, welches keinen festen Aufenthalt hat, nicht nur die Dienstboten würden alsdann von dem Wahlrecht ausgeschlossen sein, sondern noch eine ganz große Anzahl sonstiger Deutscher. Ich erinnere nur an die Studenten, die auch an dem Ort, wo sie ihren Studien obliegen, ihren festen Wohnsitz nicht haben. Einen festen Wohnsitz hat man nur da, wo man in der Absicht zu bleiben sich niedergelassen hat, nicht aber da, wo man nur vorübergehend einige Monate zubringen will. Ich erinnere an die Handwerker, die sich zur Ausbildung in ihrem Gewerbe auf Reisen begeben, und die namentlich in Deutschland in großer Anzahl von ihrem Wohnsitz kürzere oder längere Zeit abwesend sind. Durch die Annahme dieses Paragraphen, so wie er gefasst ist, würden wir gewiss mehr als eine Million Deutsche vom Wahlrecht ausschließen, und es muss doch unsere Absicht sein, dieses wichtigste aller politischen Rechte, soviel als möglich, jedem zugänglich zu machen. Ich würde mich daher, wenn hier eine Bestimmung darüber getroffen werden soll, dem anschließen, was Dr. Nauwerck vorgeschlagen hat, dass nämlich das Wahlrecht ausgeübt werde da, wo man sich zur Zeit des Wahlakts wirklich befindet. Sollte aber hiergegen ein erhebliches Bedenken aufgestellt werden, so würde das für mich doch noch kein Grund sein. Ich würde nunmehr zu dem Inhalt des Paragraphen übergehen und ich würde dann das Amendement vorschlagen:
‘Das Recht, zu wählen, übt jeder da aus, wo er sich seit 14 Tagen aufgehalten hat.’ Es hat dies die Erfahrung in einem der größten deutschen Einzelstaaten, in Preußen, für sich. Hier bestand der Unterschied bei den jetzigen Wahlen, dass zur Versammlung in Berlin nur der wählen konnte, der seit sechs Monaten seinen Wohnsitz an einem bestimmten Orte hatte, zur Nationalversammlung in Frankfurt am Main aber jeder wählen durfte, der seit 14 Tagen an einem bestimmten Orte sich aufhielt. Wenn Sie dies bedenken, meine Herren, so werden Sie es nicht unvernünftig finden, denn einerseits ist das Wahlrecht für jeden gesichert, andererseits unterbleibt das, wovor gewarnt worden ist, dass man etwa in Massen sichan einen Ort begäbe, um auf das Resultat der Wahlen zu influieren.”1
„Was dagegen den dritten Zusatz anbetrifft, wonach alle bisher dazu ermächtigten Personen zur Vornahme von Haussuchung für berechtigt erklärt werden sollen, so bin ich der Meinung, dass es gerade die Bestimmung und Bedeutung des § 8 ist, hier eine Beschränkung eintreten zu lassen. Wollten wir hier an dem bisherigen gesetzlichen Zustande nichts ändern, so würde ich auch hier einen Zusatz für überflüssig erachten. Wir wollen aber ändern, wir wollen die Befugnisse der polizeilichen Gewalt beschränken. Bis daher hat man der Polizeigewalt in Deutschland, wenigstens in vielen Ländern, das Recht der Haussuchung in sehr ausgedehntem Maße zugestanden, und gerade dieses Recht wollen wir hier aufheben. […] Ich mache daher den Vorschlag, […] den Zusatz zu machen: ‘Eine Haussuchung darf nur aufgrund des Befehls eines Richters oder eines Beamten der gerichtlichen Polizei vorgenommen werden.’ […] Dagegen wünsche ich aber noch einen anderen Zusatz, nämlich den: ‘Und in Gegenwart eines solchen Beamten vorgenommen werden.’ Es sind gerade das hauptsächlich Gründe der Beschwerde bei Haussuchungen, dass sie von Beamten der niederen Polizei ausgeführt werden, und dass dabei mit einer Brutalität verfahren wird, welche zu gerechten Beschwerden Veranlassung gibt. Es leidet auch keinen Anstand, dass ein richterlicher Beamter oder einer der gerichtlichen Polizei zugezogen werden könne. Nur auf diese Weise, glaube ich, können wir Schutz gegen diejenige Art der Haussuchungen finden, über welche so häufig Klagen vorgekommen sind.
[…]
Das erste a linea1 stellt fest, es solle ein richterlicher Befehl vorher vorhanden sein, und wenn wir dies nun einmal festhalten, so sehe ich nicht ein, aus welchem Grunde der Beamte, welcher die Haussuchung vornimmt, nicht auch zugleich verpflichtet sein soll, den richterlichen Befehl vorzuzeigen, wenn er einmal vorhanden ist. Denn ist er da, und muss er vorhanden sein, so kann er ja auch dem Beamten ohne die geringste Schwierigkeit eingehändigt werden, und dieser kann ihn ebensowohl der beteiligten Person zustellen. […] Auch bin ich noch besonders der Meinung, dass er mit Motiven versehen sei, damit die Person, welche die Haussuchung erleiden soll, auch ersehen könne, aus welchem Grunde jene Polizeimaßregel vorgenommen werde.”2
Erinnerungen aus dem Jahre 1848, New York 1898.
Statut des Vereins für demokratische Monarchie, Düsseldorf 1848.
Best, Heinrich/Weege, Wilhelm: Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49, Düsseldorf 1996, S. 356f.
Jansen, Christian: Wesendonck, Hugo, in: Neue Deutsche Biographie (NDB, Bd. 27), Berlin 2020, S. 874f.
Wir nutzen Cookies und ähnliche Technologien, um Geräteinformationen zu speichern und auszuwerten. Mit deiner Zustimmung verarbeiten wir Daten wie Surfverhalten oder eindeutige IDs. Ohne Zustimmung können einige Funktionen eingeschränkt sein.