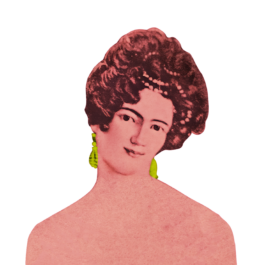
KATHINKA ZITZ-HALEIN
Schon von Kindesbeinen an kommt Kathinka Zitz-Halein mit liberalem und revolutionärem Gedankengut in Berührung: Ihre Geburtsstadt Mainz ist bis 1814 unter französischer Besatzung und durch die jakobinische Bewegung und den napoleonischen Code Civil schon früh liberal geprägt.
Erst durch Artikel und Gedichte, dann auch durch Taten wird sie selbst politisch aktiv, vor allem durch den von ihr gegründeten Frauenverein „Humania“. Dieser ist der größte und einflussreichste Frauenverein der Revolutionszeit – fast jede 10. Frau in Mainz ist Mitglied. Sie sammeln nicht nur Geld- und Sachspenden für verfolgte und gefangene Demokraten und ihre Familien, sondern stellen auch Waffen und Verbandsmaterial bereit. Für den Verein reist Zitz-Halein durch die Kampfgebiete und unterstützt politische Gefangene vor Ort. Klar ist aber immer ihr Blick auf Geschlechterrollen: Nur die Männer sollen aktiv kämpfen, Frauen sollen sie lediglich unterstützen und nicht selbst zur Waffe greifen.
Gleichzeitig ist sie eine produktive Schriftstellerin, der allein über 50 eigenständige Buchpublikationen zugerechnet werden. Weil sie auch unter Pseudonymen und anonym veröffentlicht, gibt es bis heute keine vollständige Bibliografie ihrer Werke.
Kathinka Halein wird am 4. November in Mainz geboren. Ihr Vater ist Kaufmann und, nach Haleins eigenen Darstellungen, alkoholkrank und gewalttätig. Sie erhält eine literarisch und musisch geprägte Ausbildung, lernt Französisch und kommt mit den Werken von Voltaire und politisch-historischem Wissen in Berührung.
Auf einen Zeitungsartikel des Historikers Friedrich Lehne über die Hutmode der Zeit schreibt Halein mit 15 Jahren eine humoristische Gegendarstellung und sendet sie ein. Der Artikel wird abgedruckt und Lehne selbst unterstützt Halein fortan. In der Mainzer Zeitung erscheinen einige ihrer ersten Gedichte, bereits 1823 erscheint sie erstmals in einem Lexikon deutscher Schriftstellerinnen.
Nach dem Tod ihrer Mutter und aufgrund der psychischen Erkrankung ihres Vaters muss Halein für sich und ihre schwerkranke Schwester Julia Geld verdienen – als Erzieherin und Leiterin einer Mädchenschule, aber auch mit Handarbeiten, Französischunterricht und ihrem Schreiben.
Halein besucht das Grab von Karl Ludwig Sand, dessen Mord an August von Kotzebue den Anlass für die Karlsbader Beschlüsse gegeben hatte. Dieser Besuch kann als erste Anzeichen von Haleins politischer Gesinnung gesehen werden.
Halein, fortan Kathinka Zitz oder Zitz-Halein, heiratet Dr. Franz Zitz, ein Jurist, der zu einen der radikal-demokratischen Revolutionsführern in Mainz gehört. Weil sie älter ist als ihr Mann und mittellos kursieren Gerüchte, sie habe ihn durch Selbstmorddrohungen zur Ehe gezwungen. Die Ehe mit Franz Zitz verläuft unglücklich und bereits ab 1839 lebt das Paar in Trennung; zur Scheidung kommt es nie, aber zu mehreren Prozessen, weil Zitz den Unterhalt für seine Frau nicht zahlt.
Ihre ersten politisch geprägten Gedichte werden veröffentlicht. Sie misst der politischen Literatur eine besondere Bedeutung in der Revolution bei. Von vielen wird sie, weil sie sich als Frau zu politischen Themen äußert, kritisiert oder skandalisiert.
Zitz-Halein schließt sich der deutschkatholischen Bewegung an, die sich als eine der wenigen politischen Bewegungen der Zeit auch dem Thema der Frauenemanzipation widmet.
Als der Großherzog von Hessen-Darmstadt den liberalen Code Civil abschaffen will, veröffentlicht Zitz-Halein in der „Mannheimer Abendzeitung“ mehrere Artikel über das Vorgehen und die Pressezensur, die in Mainz stärker gilt als in Baden, und prägt damit den vorrevolutionären Widerstand.
Unter der Führung von Zitz-Halein gründet sich in Mainz der Frauenverein „Humania“, nach Vorbild anderer Frauenvereine. Für ihre Arbeit und wegen ihrer Ehe mit Zitz muss sie sich mehrfach vor Gericht verantworten. Obwohl freigesprochen wird sie auch noch Jahre später als „politisch gefährlich“ im „Anzeiger für die politische Polizei“ aufgeführt.
Nach Unstimmigkeiten im Vorstand, unter anderem über Frage, wie politisch der Verein sein soll, legt Zitz-Halein ihr Amt im „Humania“-Verein nieder. Daraufhin treten immer mehr Frauen aus, sodass der Verein im folgenden Jahr aufgelöst wird. Zitz-Halein versucht weiterhin, humanitäre Arbeit zu leisten, muss sich aber aufgrund der voranschreitenden Restaurationspolitik aus der Öffentlichkeit zurückziehen und widmet sich wieder hauptsächlich dem Schreiben. In diesen Jahren veröffentlicht sie vor allem Unterhaltungsliteratur.
In ihrer Gedichtsammlung „Weltpantheon“ finden sich knapp 200 Gedichte zu berühmten Persönlichkeiten, darunter viele Frauen wie Bettina von Arnim oder Elizabeth Fry. Auch in dem drei Jahre später erschienen „Dur- und Molltönen“ widmet Zitz-Halein sich in Gedichten den Lebensgeschichten bekannter und weniger bekannter Frauen. Beide Werke finden aber wenig Anerkennung.
Ihr „Roman eines Dichterlebens“ über Johann Wolfgang von Goethe verkauft sich so gut, dass sie weitere Romane über berühmte Dichter (Heinrich Heine, Rahel Varnhagens und Lord Byron) folgen lässt. Die Wahl Heines zeigt, dass sie sich weiterhin gegen die restaurative Politik der Zeit stellt.
Im deutsch-französischen Krieg versorgt Zitz-Halein verwundete Soldaten, worunter auch ihre eigene Gesundheit stark leidet. Sie wird in das St. Vizenziuspensionat der Barmherzigen Schwestern in Mainz aufgenommen, wo sie am 8. Mai 1877 verstirbt.
Derya Özdemir
»Das weibliche Geschlecht hat es teils schon begriffen und wird es teils noch begreifen, dass sein Beruf in dieser großen Zeit ein ernsterer ist, als der des untätigen Besuchens demokratischer Vereine und Volksversammlungen, oder der Beteiligung an einer zu stickenden Fahne. Ohne aus den Schranken der Weiblichkeit heraus zu treten, können die Frauen durch ihr Wirken dem Vaterlande von bedeutendem Nutzen werden, durch tatkräftiges Wirken und Walten.«² Weiterlesen
Mit diesem Aufruf »An die Frauen und Jungfrauen von Mainz« (siehe auch „Was sie dachten und schrieben“) rief die Mainzer Schriftstellerin und Demokratin Kathinka Zitz (1801–1877) zur Gründung des Frauenvereins »Humania« auf und bewies damit Mut und Engagement in der Revolution von 1848/49. Der am 16. Mai 1849 gegründete Verein entwickelte sich unter ihrer Führung zu einem der größten und einflussreichsten Frauenvereine der Revolutionszeit.3 Zitz avancierte zu einer zentralen Figur der revolutionären Bewegung und inspirierte zahlreiche Frauen, sich aktiv politisch und gesellschaftlich zu engagieren.
Agitatorische Poesie
Schon vor der Revolution war Zitz als Schriftstellerin bekannt. Mit Ausbruch der Revolution intensivierte sie ihre schriftstellerische Tätigkeit und veröffentlichte ihre Gedichte in Zeitungen wie der Didaskalia4 oder auf Flugblättern. Ihre Lyrik war nicht nur Ausdruck persönlicher Überzeugung, sondern diente auch der politischen Mobilisierung. Besonders bekannt wurde ihr heute noch gern zitiertes Gedicht »Märzveilchen« (siehe „Was sie dachten und schrieben“), in dem sie unter anderem ein Loblied auf die Freiheit sang und zum Handeln aufrief:5 »Das Veilchen heißt Freiheit, die lang unterdrückt, / Kaum sind seit dem Umsturz zwei Monden vorbei, / Schon kränkelt das Veilchen, wir haben erst Mai. / Soll’s Veilchen dir fröhlich und frisch wieder sprießen, / So musst du es mit deinem Herzblut begießen.«6
Zitz nutzte ihre Popularität auch für humanitäre Zwecke. Als sie im April 1848 von dem Versuch der dänischen Regierung, die beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein vollständig in den dänischen Gesamtstaat einzuverleiben, erfuhr, was schließlich zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem Königreich Dänemark und der vor allem von Preußen unterstützten Nationalbewegung in den beiden Herzogtümern führte, organisierte sie in Mainz eine Spendensammlung.7 Von dem Erlös schickte sie Verbandsmaterial an die Front und fügte das Gedicht »An die Schleswig-Holsteiner« bei, in dem sie den gemeinsamen nationalen Kampf beschwor.8 Darin heißt es: »Frei will fortan der Deutsche sein / Ob er am Belt, ob er am Rhein / Er bricht mit kräft’ger Hand die Ketten!«9 An diesem Gedicht wird zweierlei deutlich: Erstens beschränkte sich Kathinka Zitz in ihren Werken geografisch nicht nur auf Mainz, sondern informierte auch über politische Aktivitäten und Ereignisse in Städten und Regionen anderer deutscher Einzelstaaten. Zweitens gibt sie sich in dem Gedicht als eine Verfechterin der deutschen Einheit zu erkennen, die die Annexion Schleswig-Holsteins durch Dänemark als unrechtmäßig hielt und als Verrat an der nationalen Einheitsbewegung Deutschlands verstand. Deshalb griff sie das politische Geschehen mit einem eigenen Gedicht auf, um im öffentlichen Meinungsbildungsprozess Stellung zu beziehen.
Zitz’ Gedichte begleiteten das wechselvolle Revolutionsgeschehen über die gesamte Dauer – von den anfänglichen Höhepunkten bis zur Niederlage am Ende – und stellten damit einen wichtigen Beitrag zur demokratischen Seite der Revolutionsöffentlichkeit dar. Beeindruckend ist vor allem das breite Themenspektrum, das sie in ihren Gedichten aufgriff und behandelte. Zitz erlebte die revolutionären Ereignisse in Mainz unmittelbar mit und verarbeitete diese Erfahrung in ihren Werken, indem sie die politische Situation sowohl im Großherzogtum Hessen-Darmstadt als auch im restlichen Deutschen Bund näher beleuchtete, Missstände anprangerte, revolutionäre Werte wie Freiheit und Demokratie propagierte und nicht zuletzt die Frage der deutschen Einheit thematisierte und in der Folge zur politischen Agitation aufrief. Mit ihrer literarisch-politischen Tätigkeit machte sie sich sicht- und wahrnehmbar und demonstrierte damit auch ihre Handlungsbereitschaft. Damit durchbrach sie die zeitgenössisch vorgegebenen Handlungsspielräume von Frauen und grenzte sich zugleich von anderen bürgerlichen Frauen ab. Letztlich bildete das Interesse von Zitz an den revolutionären Ereignissen eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung eigener aktiver politischer Handlungsspielräume.
Die Gründung der »Humania«
Am 16. Mai 1849 versammelten sich zahlreiche Mainzer Frauen zur Gründung der „Humania“. Zitz appellierte an ihre Mitstreiterinnen, das Vaterland „durch tatkräftiges Wirken und Walten“ zu unterstützen. Der Verein konzentrierte sich zunächst auf karitative Aufgaben, unterstützte verwundete Freischärler und deren Familien und sammelte Spenden. Zitz betonte dabei die Bedeutung weiblicher Solidarität und forderte die Frauen auf, sich „nicht mehr als Frauenzimmer, sondern als Bürgerinnen und Vaterlandsfreundinnen“ zu verstehen. Kathinka Zitz ging es also vorrangig um einen weiblichen Zusammenschluss, der den Bürgerinnen bei der Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Pflichten helfen, ihnen aber auch ein Engagement in der Revolution ermöglichen sollte. Auf diese Weise wollte sie die Frauen befähigen, nicht nur ihre Pflichten als Hausfrau, Mutter und Ehefrau zu erkennen und zu erfüllen, sondern auch diejenige als »Bürgerin« und »Vaterlandsfreundin«. Mit der ihnen neu zugeschriebenen, aufgewerteten Funktion als Bürgerin war vermutlich auch die Hoffnung verbunden, die Frauen für die Verwirklichung demokratischer Ziele zu gewinnen. Schließlich wies Zitz den Frauen eine politische Verantwortung zu und schuf bei ihnen damit zugleich eine Grundlage für das Bewusstsein von der besonderen Rolle und Bedeutung der Frauen in der Öffentlichkeit.
In diesem Zusammenhang appellierte sie – wie auch in der Generalversammlung im Juni und Juli 1849 – an ihre Mitstreiterinnen, »in Dörfern und Städten dafür zu wirken, daß sich überall Zweigvereine bilden«, um auf diese Weise »zu dem Bau des einigen freien Vaterlandes« beizutragen.10 So entstanden in ganz Deutschland Frauenvereine nach dem Vorbild der Mainzer Assoziation. Nur wenige Tage nach der Gründung der »Humania« entstand in Mainz-Kastel der Frauenverein »Rhenania« (Rheinland). Zitz half dem Kasteler Frauenverein – und auch anderen Frauenvereinen in verschiedenen Orten wie der Vereinigung von Therese Rauch in Landau11 – eine organisatorische Grundlage zu schaffen, indem sie ihnen zum Beispiel die Vereinsstatuten oder Gründungsreden zur Verfügung stellte.12 Zitz übernahm auch die Aufgaben der Frauenvereine in Mannheim und Heidelberg, die sich wegen Verbotes oder drohender Verfolgung aufgelöst hatten und nun die Präsidentin der »Humania« um Unterstützung und Hilfe baten.13 Weitere demokratische Vereine, die den Kontakt zu Zitz suchten, waren unter anderem die Vereine in Alzey, Bonn, Darmstadt, Frankfurt und Worms.14 Zitz' Bemühungen führten zu einem überregionalen Netzwerk, das revolutionäre Gruppen und prominente Demokratinnen und Demokraten miteinander verband, darunter den Präsidenten des Rumpfparlaments Wilhelm Loewe (1814–1886)15 oder den Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung Franz Raveaux (1810–1851)16.
Die „Missionsreisen“
Im Sommer 1849 unternahm Zitz zwei „Missionsreisen“, um gefangenen und geflüchteten Revolutionären zu helfen. In Baden (Bericht über diese Reise, siehe „Was sie dachten und schrieben“) und der Pfalz setzte sie sich für inhaftierte Freiheitskämpfer ein, organisierte humanitäre Hilfen und verhandelte mit Militärkommandanten über bessere Haftbedingungen. In der Schweiz half sie Flüchtlingen bei der Rückkehr nach Deutschland und versorgte sie mit Kleidung und Geld.17
Trotz des Scheiterns der Revolution ließ sich Kathinka Zitz in ihrem Engagement nicht beirren. Noch im August 1849 reiste sie nach Mannheim, das in den folgenden Jahren – wie viele andere deutsche Städten und Regionen – von der Reaktion beherrscht wurde.18 Aus Mannheim, wo sie sich angeblich aus privaten Gründen aufhielt, in Wirklichkeit aber an den Prozessen gegen badische und pfälzische Freischärler teilnahm, schrieb sie, wenn auch anonym,19 für den »Demokrat« ihre sogenannten »Mannheimer Briefe«, datiert vom 17. und 23. August sowie vom 9. und 13. September 1849.20 Darin prangerte sie die Brutalität der preußischen Truppen an und machte das Schicksal politischer Gefangener öffentlich.
Schlussbetrachtung
Kathinka Zitz war eine der wenigen Frauen, die sich aktiv an der Revolution von 1848/49 beteiligten. Durch ihre literarischen Werke, ihre Vereinstätigkeit und ihr humanitäres Engagement sprengte sie die gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit und prägte das politische Bewusstsein. Ihr Wirken zeigt, dass Frauen nicht nur eine passive Rolle im politischen Geschehen einnahmen, sondern aktiv an der Gestaltung demokratischer Strukturen beteiligt waren. Ihr Engagement legte den Grundstein für spätere Frauenbewegungen und verdeutlicht, dass die Revolution von 1848/49 nicht nur eine Männergeschichte war, sondern auch von mutigen Frauen wie Kathinka Zitz geprägt wurde.
Ihre Forderungen nach Freiheit, Gerechtigkeit und Partizipation sind bis heute aktuell. Frauenverbände, Menschenrechtsorganisationen und soziale Bewegungen setzen sich bis heute für die Werte ein, die Zitz bereits im 19. Jahrhundert vertrat. Historische Vorbilder wie sie erinnern uns daran, dass Demokratie ein fortlaufender Prozess ist, der kontinuierliches Engagement erfordert. In Zeiten politischer Unsicherheit oder des Erstarkens populistischer Bewegungen kann der Blick in die Vergangenheit helfen, neue Perspektiven zu gewinnen und demokratische Strukturen zu stärken.
1 Für eine ausführlichere Darstellung von Kathinka Zitz' Rolle in der Revolution von 1848/49 siehe meinen Beitrag Die »Beschützerin aller Demokraten« – Kathinka Zitz (1801–1877) und die Revolution von 1848/49 auf regionalgeschichte.net (04.03.2021), URL: https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/aufsaetze/oezdemir-derya/oezdemir-die-beschuetzerin-aller-demokraten-kathinka-zitz-1801-1877-und-die-revolution-von-184849.html. Eine kompaktere Fassung findet sich in Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte 79 (2023), S. 144–161.
2 Stadtarchiv (im Folgenden StA) Mainz, Nachlass (im Folgenden NL) Kathinka Zitz, Mappe 5 »Verein ›Humania‹«, Zeitungsausschnitt »An die Frauen und Jungfrauen von Mainz«, ohne Datum und Herkunftsangabe.
3 Vgl. Marion Freund, »Mag der Thron in Flammen glühn!« Schriftstellerinnen und die Revolution von 1848/49, Königstein i. Taunus 2004, S. 341.
4 Didaskalia war die literarische Beilage des Frankfurter Journals, die hauptsächlich von einem weiblichen Publikum gelesen wurde. Während der Revolution wurde darin insbesondere die Entwicklung der revolutionären Bewegung wiedergegeben und dabei die Rolle der Frau explizit hervorgehoben, siehe Anne-Kathrin Zehendner, Frauen im Vormärz und in der Revolution 1848/49, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte, Bd. 141/142, 2005/2006, S. 687–700, hier S. 695.
5 Vgl. Micaela Mecocci, Kathinka Zitz (1801–1877). Erinnerungen aus dem Leben der Mainzer Schriftstellerin und Patriotin, Mainz 1998, S. 67; dies., Kathinka Zitz-Halein. Ein politisches und literarisches Frauenschicksal in Mainz zur Zeit der 1848er Revolution, in: Mainzer Geschichtsblätter, 11. Jg., 1999, S. 85–108, hier S. 97.
6 StA Mainz, NL Kathinka Zitz, Mappe »Gedichtmanuskripte«, Gedicht »Märzveilchen«.
7 Vgl. Micaela Mecocci, Kathinka Zitz (1801–1877). Erinnerungen, S. 98.
8 Ebd.
9 StA Mainz, NL Kathinka Zitz, Mappe »Gedichtmanuskripte«, Gedicht »An die Schleswig-Holsteiner«.
10 Mainzer Zeitung, Nr. 165, 3. Juli 1849, Titelblatt.
11 Siehe dazu: Briefe des Landauer Frauenvereins an Kathinka Zitz, 25. Oktober 1849 und 4. Januar 1850, in: Gerlinde Hummel-Haasis (Hg.), Schwestern, zerreißt eure Ketten. Zeugnisse zur Geschichte der Frauen in der Revolution von 1848/49, München 1982, Dok. 254, S. 309–311.
12 Kasteler Beobachter, Nr. 49, 22. Mai 1849, S. 139.
13 Vgl. Marion Freund, »Mag der Thron in Flammen glühn!«, S. 311; Brief der Mitglieder des aufgelösten Frauenvereins aus Heidelberg an Kathinka Zitz, 30. Dezember 1849, in: Gerlinde Hummel-Haasis, Schwestern, zerreißt eure Ketten, Dok. 260, S. 318–319.
14 Micaela Mecocci, Kathinka Zitz (1801–1877). Erinnerungen, S. 109; Stanley Zucker, Female Civic Activism, S. 133.
15 Vgl. StA Mainz, NL Kathinka Zitz, Mappe 5 »Verein ›Humania‹«, Wilhelm Loewe an »Humania«-Verein, Bern, 8. Januar 1850, 5. März 1850, 19. April 1850.
16 Vgl. Marion Freund, »Mag der Thron in Flammen glühn!«, S. 310; Stanley Zucker, Female Civic Activism, S. 141.
17 Vgl. Kathinka Zitz, Eine Missions-Reise nach Baden und der Pfalz I, in: Der Demokrat, Nr. 48, 5. Juli 1849, S. 209–210; dies.: Eine Missions-Reise nach Baden und der Pfalz II, in: Der Demokrat, Nr. 49, 8. Juli 1849, S. 213–214. Zu diesen Reisen siehe Marion Freund, »Mag der Thron in Flammen glühn!«, S. 312; Gerlinde Hummel-Haasis, Schwestern, zerreißt eure Ketten, S. 261.
18 Micaela Mecocci, Kathinka Zitz (1801–1877). Erinnerungen, S. 121; Marion Freund, »Mag der Thron in Flammen glühn!«, S. 315.
19 Wenngleich die »Mannheimer Briefe« anonym veröffentlicht wurden, lassen sich diese doch Kathinka Zitz zuordnen, da sie die entsprechenden, fast wortgleichen Aufzeichnungen in ihren »Skizzen« (Bl. 38–44) wieder aufgenommen hat, vgl. Marion Freund, »Mag der Thron in Flammen glühn!«, S. 315, Anm. 175.
20 Vgl. Mannheimer Briefe I, in: Der Demokrat, Nr. 63, 17. August 1849, S. 269–271; Mannheimer Briefe II, in: Der Demokrat, Nr. 64, 23. August 1849, S. 273–275; Mannheimer Briefe III, in: Der Demokrat, Nr. 67, 9. September 1849, S. 285–286; Mannheimer Briefe IV, in: Der Demokrat, Nr. 68, 13. September 1849, S. 290–291.
Zu allen Zeiten, in welchen der Sturm der Weltereignisse über die Völker dahin braute, haben große Ereignisse auch große Entschlüsse hervorgerufen, und die Frauen haben noch nie gefeiert, wenn es galt, dem Vaterlande die Schuld abzutragen, zu der wir ihm Alle verpflichtet sind. Es dürfte geeignet sein, aus der Geschichte einige Beispiele hervor zu heben und einige der hervorragenden weiblichen Persönlichkeiten zu bezeichnen, deren Namen mit ehrnem Griffel in das Buch der Weltgeschichte eingegraben sind. Die israelitischen Annalen schildern uns Delila, Jael, Deborah, Judith und die Mutter der Makkabäer als Volksfreundinnen, die Alles für ihr Vaterland wagten. Unter den Spartanerinnern und Lacedämonierinnen zeichneten sich besonders aus: Koïne, die, indem sie ihren Sohn bewaffnete und umgürtete, zu demselben sprach: „Kehre mit dem Schilde, oder auf dem Schilde zurück“ – das heißt: kehre als Sieger aus der Schlacht, oder werde tot auf dem Schulde heimgetragen. – Phane, die da sagte: Was das Vaterland fordert, ist zu leisten Pflicht; es ist süß für es zu leben, doch süßer noch für es zu sterben. – Cassandra, die heilige Seherin, die die Frauen, welche ihr Leben nicht dem Wohl des Vaterlandes weihten, gemeine Sklavinnen nannte. – Hibridia, die den Spartanern zurief: Seid stolz auf Frauen, deren Seelen voll sind von Vaterlandsliebe und die stündlich bereit sind für seine Wohlfahrt zu sterben. Andere spartanische Frauen schnitten, als es einst im Kriege an Schiffsseilen fehlte, ihre langen Haare ab, um Taue daraus zu flechten. – Die römische Geschichte nennt uns Cornelia, die Mutter der Gracchen, die ihre in der Liebe zum Vaterland erzogenen Söhne ihren schönsten Schmuck nannte. – Dann Clelia, die nebst andern Römerinnen, von dem König Porsenna als Geisel mit fortgenommen, sich und ihre Gefährtinnen befreite, und mit ihnen auf geraubten Pferden über den Tiber in ihre Vaterstadt zurückfloh. – Simons Tochter, Hasilia, die ihren zum Hungertode verurteilten Vater täglich im Gefängnis besuchte, und ihn mit der Milch ihrer Brüste erhielt. – Arria, die Gattin des Pätus, die sich vor ihren ungerechten Richtern den Dolch in die Brust senkte und ihn dann dem Gatten mit den Worten reichte: „Nimm, es schmerzet nicht.“ – Epponine, die mit dem geflüchteten, zum Tode verurteilten Gatten, neun Jahre lang im Schoße der Erde verborgen lebte. – Das Mittelalter zeigt uns in Frankreich das einfache Hirtenkind Johanna d’Arc, die ihr Vaterland aus der Gewalt der eingedrungenen Engländer rettete, dem Schwächling Carl VII. die wankende Krone wieder auf das Haupt befestigte, der zum Danke dafür: (Könige sind ja so dankbar!) es ruhig geschehen ließ, dass die religiöse Absurdität sie als Hexe verbrannte – und in Deutschland sehen wir die Weiber von Weinsberg, die, als sie von den Belagerern freien Abzug erhielten, mit der Erlaubnis, soviel von ihren Kostbarkeiten mitnehmen zu dürfen, als eine Jede würde tragen können, Alles zurück ließen, um ihre Männer auf dem Rücken fortzuschleppen. In der ersten französischen Revolution tauchten viele edle weibliche Gestalten auf; z.B. die Weiber von Laval, die mutig die Festung der Stadt verteidigten und behaupteten. Charlotte Corday, das hochherzige Heldenmädchen, das dem Vaterlande sein schönes, jugendliches Leben weihte, um die Schmach des entwürdigten Vaterlandes zu rächen, indem es dem elenden Marat, dem Windischgrätz seiner Zeit, das Messer tief in das entmenschte Herz senkte. – Emilie von Sombreuil, die, um das Leben ihres greisen Vaters zu retten, aus der Hand der ein Glas voll Menschenblut annahm und es ohne Zagen austrank. – Iphigenie Dessile, die sich, um den Kindern ihre Mutter zu erhalten, an der Stelle ihrer verheirateten, zum Tode verurteilten Schwester guillotinieren ließ. – Viele Frauen, nicht zu vergessen, opferten ihren Schmuck auf dem Altare des Vaterlandes, und ein junges Mädchen verkaufte sogar sein schönes reiches Haar an einen Perückenmacher […]. Weiterlesen
Wir haben uns hier versammelt, um nach dem Beispiele unserer Mannheimer Schwestern, welche die Vereine „Concordia“ und „Germania“ ins Leben riefen, einen Unterstützungsverein zu gründen, der „Humania“ heißen mag, und dessen Zweck der sein soll, Patrioten oder deren Familien, die für die gerechte Sache des deutschen Vaterlandes kämpfen oder von den Drängern verfolgt werden, nach Kräften mit kleinen Gaben zu unterstützen. Die Regeln des Vereins, die wir nachher verlesen werden, sind der Art, dass sich alle Stände, dass sich Arme und Reiche daran beteiligen können. Das Scherflein der Witwe, der Beitrag der verlassenen Waise, die kleine Opferspende der armen Dienstbotin sollen als Liebesgabe willkommen sein. Niemand, der ein Herz für die gute Sache hat, ist ausgeschlossen. Wir kennen keinen Standes- keinen Glaubensunterschied, wir kennen nur die Liebe zum Vaterland. Wir wollen nur einen schönen schwesterlichen Bund der Menschenliebe, der Einigkeit begründen. O, lasst uns einig sein; denn nur die Einigkeit macht stark. Das einzelne Reis vermag die Hand eines jährigen Kindes zu knicken, aber ein Reisigbündel bricht selbst der stärkste Mann nicht entzwei.
Indem wir zusammentreten, muss es mit einem, aufrichtigem Herzen geschehen. Alle Sonderbündelei, alle Parteisucht, aller Vorrang, Ehrgeiz, jede Nebenabsicht muss verbannt bleiben. Wir müssen aufhören, Frauenzimmer zu sein und gänzlich Bürgerinnen und Vaterlandsfreundinnen werden. […]
Darum soll unser Verein auch nicht nur ein Unterstützungsverein sein, sondern wir machen uns auch verbindlich, wenn es not tun sollte, unsere kranken und verwundeten Brüder zu pflegen […]. Kaufen wir uns im Jahr ein Kleid oder einen Hut weniger, und wir werden viel tun können. Wir werden manchen Hunger stillen, manche Blöße zu decken, manche Träne zu trocknen vermögen.
Wer den Zweck dieses patriotischen Vereins recht begriffen hat, der wird es sich zur Ehrensache machen, ihm seine ganze Tätigkeit zuzuwenden, ja im Kreise seiner Bekannten um weitere Unterschriften zu werben, damit er die möglichst weite Verbreitung erhalte. Erhalten wir auch keinen Zufluss aus der sogenannten Hautevolée, so hoffen wir, dass sich der Sinn der Bürgerinnen um so mehr daran beteiligen wird […] Siegt die Volkssache, kehrt dereinst die Ruhe wieder und werden Siegesfeste gefeiert, dann werden wir es vielleicht erleben, dass die Dämchen, welche jetzt die Hände müßig in den Schoß legen und sich stolz von den Volksfreundinnen abwenden, auf einmal in feurige Patriotinnen verwandelt, sich in den Vordergrund drängen […] Wir aber werden das lohnende Bewusstsein haben, nützlich für die Menschheit gewirkt zu haben […]
Bevor wir die Einzeichnung in die Liste beginnen, möchte ich, nachdem wir uns über die Hauptsache geeinigt haben, der Versammlung noch einen weiteren Vorschlag tun, nämlich den, auch zur Anschaffung von Waffen beizutragen. Haben vielleicht auch manche von uns kein uns zu Gebote stehendes Geld, um irgendein Waffenstück anzukaufen, so haben wir doch alle Schmucksachen, die sich in Geld verwandeln lassen. Stellen wir diese dem demokratischen Verein zur Verfügung mit dem Ersuchen, sie zu verwerten, für den Betrag Waffenstücke anzukaufen und auf diesen den Namen der Geberin gravieren zu lassen. Eine solche Waffe wird für den Streiter, der sie empfängt, zur Ehrenwaffe werden, zu einer heiligen Oriflamme, denn wer würde der Feige sein, der eine ihm von Frauenhand zum Schutze des Vaterlandes übergebene Waffe anders als mit seinem Leben fahren ließe […] Wir aber wollen uns später Schmuck aus den den Unterdrückern abgenommenen Geschützen gießen lassen, und dieser wird uns eine edlere Zier sein als die Pracht der reichsten Diamanten. Das wenige, was ich an Schmuck besitze, lege ich […] hiermit auf den Altar des Vaterlandes nieder. Es wird immerhin zur Anschaffung einiger Gewehre hinreichen. Möchten recht viele mir nachfolgen. Unser Beispiel wird nicht verloren gehen, es wird in ganz Deutschland Nachahmung finden.
[Nachsatz im Artikel]: Als die Rednerin ihren Vortrag beendet hatte, war der Zudrang zur Einzeichnung so groß, dass die Wahl des Ausschusses nicht mehr vorgenommen werden konnte, und noch mehr Einzeichnungen sind auf die nächsten Tage versprochen.
Der Geist der Vaterlandsliebe regt sich in unserer vielbewegten Zeit auch mächtig in den Herzen der Frauen, die das Ziel und die Bedeutung der wahren Demokratie begriffen haben. Überall bilden sich Vereine zur Unterstützung der politisch Verfolgten, zur Pflege und Versorgung der verwundeten Brüder zur Anschaffung von Waffen für die kampfesmutige Jugend, die bereit ist, voll kühner Todesverachtung in den Kampf für unsere heiligsten Rechte zu ziehen. Das weibliche Geschlecht hat es teils schon begriffen und wird es teils noch begreifen, dass sein Beruf in dieser großen Zeit ein ernsterer ist, als der des untätigen Besuchens demokratischer Vereine und Volksversammlungen oder der Beteiligung an einer zu stickenden Fahne. Ohne aus den Schranken der Weiblichkeit herauszutreten, können die Frauen durch ihr Wirken dem Vaterlande von bedeutendem Nutzen werden durch tatkräftiges Wirken und Walten. Unsere Mannheimer Schwestern sind uns mit einem schönen Beispiel vorangegangen, werden die Mainzerinnen zurückstehen wollen? Lasst uns wirken und zusammenhalten in einem Bund der Liebe und des Rechtes, lasst uns durch Willen und Tat bewähren, dass wir des Namens deutscher Frauen würdig sind und dass wir da, wo es einem großen Zweck des gemeinsamen Vaterlandes gilt, auch fähig sind, dem Vaterlande Opfer zu bringen. […]
Geehrteste Bürgerinnen! Sie sind hier zusammengekommen auf die Einladung einiger Frauen und Jungfrauen, um wie die Frauen in Mainz und anderen Städten unseres immer noch in Druck und Not sich befindlichen Vaterlands einen Verein zu gründen „zur Unterstützung vaterländischer Interessen“. Ich werde nicht nötig haben, Ihnen, meine Mitschwestern, die Gründe anzugeben, welche uns alle zu diesem Entschlusse brachten, doch mag ein Grund angegeben werden, und dieser ist: Wenn unsere Männer, Brüder und Freunde hinausziehen für die heilige Sache Deutschlands, um die so sehnlichst erwartete Freiheit mit den Waffen in der Hand uns zu erringen, wir zuhause auch nicht die Hände tatlos in den Schoß legen wollen, sondern alle für die Freiheit Kämpfenden nach allen unseren Kräften zu unterstützen. Die Art und Weise der Unterstützung wird Ihnen durch die Statuten näher bezeichnet werden.
So vielerlei die vaterländischen Interessen sind, so vielerlei soll auch unsere Hilfe sein. Eine Jede von uns arbeite deshalb nach Vermögen an diesem heiligen Werke im Gedanken an das hohe zu erstrebende Ziel. […]
Jetzt aber, Ihr Frauen und Jungfrauen, jetzt muss ich mich an Eure Herzen mit der Bitte wenden: Bietet alles auf in dem schönen Zweck, unseren Verein nach Kräften zu unterstützen. Wir brauchen Geld, viel Geld, Wir brauchen Hemden und Kleidungsstücke. Es ist uns zwar diese Woche ein anonymer Brief mit der Bitte zugekommen, da jetzt viele Männer zurückgekehrt und keine bedeutenden Unterstützungen mehr nötig seien, die wöchentlichen Beiträge für die Dauer des Monats gelten zu lassen. Diese Anmutung konnte natürlich nur aus der Unkunde der Verhältnisse hervorgehen; denn nicht nur die Frauen, sondern hauptsächlich die Versprengten, die aus Patriotismus jetzt heimatlos gewordenen Männer, müssen die Mittel zu ihrem Fortkommen erhalten. Wir unterstützen in ihnen keine Aufrührer, sondern Vaterlandsfreunde, die für eine gesetzmäßige Sache kämpfen. Die Nationalversammlung war von allen Fürsten Deutschlands anerkannt. Aus ihrer Mitte ging die Reichsverfassung hervor, die sie mit allen Mitteln, selbst mit der Gewalt der Waffen, aufrecht zu erhalten gebot. Unsere Brüder kämpften für diese Reichsverfassung. Folglich waren und sind sie noch auf dem gesetzlichen Wege, und es ist daher unsere heilige Pflicht, sie zu unterstützen.
Unser Verein verfolgt keine politischen Tendenzen. Wir fordern nicht zum Aufruhr, zum Blutvergießen auf. Wir predigen keinen Fürstenhass, noch haben wir je die Guillotine herbeigewünscht. Jede Unweiblichkeit, jede exzentrische Ansicht war uns stets fern und wird uns stets fern bleiben. Unser Streben ist ein so ehrenhaftes, dass es sich überall Anerkennung verschaffen wird; denn unser Verein geht von dem rein menschlichen Gesichtspunkt aus. Er hat sich stets und wird sich stets auf dem gesetzlichen Boden bewegen. Es kann uns daher kein Gericht und keine Macht der Welt das Geringste zur Last legen, wenn wir mit mildtätigem Sinn die Männer unterstützen, die unglücklich geworden sind. Und so, meine Schwestern, fordere ich Euch denn auf, nicht zu ermatten und zu erlahmen, sondern festzuhalten an unserer Humania, an unserem Streben für das rein Menschliche.
Und Ihr, deren Verhältnisse es erlauben, tretet heran. Wir haben hier eine Liste aufgelegt zu Extrabeiträgen, die im Laufe dieser Woche von den Mitgliedern des Vereins selbst in Empfang genommen werden sollen. Bedenkt, welch einen Berg von Sorgen Ihr von der Brust mancher hilflosen Mutter, mancher verzweifelnden Gattin nehmen werdet, wenn sie weiß, meinem Sohn, meinem Mann werden die Mittel gegeben, nicht ganz hilflos über die Grenze zu kommen. Und welcher Trost wird es wieder für den Sohn, wenn er sich sagen kann: „Meine alte Mutter, meine arme Frau und meine unschuldigen Kinder sind wenigstens vor dem Hungertode geschützt. Euch, Ihr Bemittelten, ist es eine Kleinigkeit, eine Opferfreude auf dem Altar der Dürftigkeit niederzulegen, und Eure Gaben, Ihr Ärmeren, werden dereinst schwer wiegen in der Waagschale der Vergeltung. Es ist meine Absicht, mich demnächst wieder auf den Weg zu machen, um den versprengten Flüchtlingen die Gaben der Frauenwelt selbst zu überbringen und ihnen dadurch den Beweis zu geben, wie sehr wir Frauen insgesamt ihre Hingebung an das Vaterland zu würdigen wissen. […]
Ich hatte mir die Aufgabe gestellt, die Gefangenen aufzusuchen, welche in dem Kampfe bei Kirchheimbolanden von den Preußen gemacht worden waren, um mich zu überzeugen, wer von ihnen noch am Leben oder zu den Toten zu zählen sei, die durch fürchterliche Wunden entstellt, nicht hatten erkannt werden können. Vorzüglich war mein Augenmerk auf das Auffinden des jungen R.¹ gerichtet, von dem man wissen wollte, dass er sich unter den Gefangenen befände. Mit dessen Schwester und noch einer Reisegefährtin trat ich wohlgemut meine Reise an und erfuhr in Neustadt an der Haardt, dass die Gefangenen an Bayern abgeliefert und in die Festung Landau gebracht worden seien. […] In Edenkoben trafen wir mit dem eben aus Landau kommenden Postwagen zusammen und erkundigten uns, ob man ungehindert in die Festung gelangen könne. Nachdem dieses bejaht worden war, eilten wir nach Landau, fanden aber die Tore geschlossen und wenigstens 200 Personen vor denselben, welche vergebens auf Einlass harrten. Ich stieg aus und verlangte, den wachhabenden Offizier zu sprechen, welcher mit sagte, dass die Festung seit zwei Stunden wieder geschlossen worden, weil der nach Edenkoben gehende Postwagen von Freischaren angefallen und ausgeplündert worden sei. Ich bemerkte ihm, dass dieses nur auf einem Irrtum oder einer Verleumdung beruhen könne, da wir in Edenkoben mit dem Postwagen zusammengetroffen, mit den Passagieren gesprochen und auch nicht einer eines solchen Vorfalles erwähnt habe. Hierauf ersuchte ich ihn (ich reiste, da mein Name als Gattin eines Aufrührers mich nicht empfehlen konnte, unter dem Namen einer Frau Hetz), unsere Papiere an den Kommandanten zu schicken mit der Meldung, dass drei Damen da seien, welche ihn in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen wünschten. […] Weiterlesen
Der Kommandant, General Jeetze, nahm uns sehr artig auf, und nachdem er uns in sein Empfangszimmer geleitet, sagte er lachen:
„Ich muss bekennen, meine Damen, dass Sie sehr viel Mut besitzen, dass Sie sich in dieser unruhigen Zeit in eine Festung wagen.“
„General“, erwiderte ich, „wir sind in einer Festung² geboren und erzogen. Wir fürchten den Anblick des Geschützes nicht, und zudem ist unsere Festung viel größer als die Ihrige.“
Nachdem ich ihm den Wunsch vorgetragen hatte, zu erfahren, ob sich der junge R. unter der Zahl der Gefangenen befände, bejahte er dieses mit der freundlichsten Bereitwilligung, indem er hinzusetzte:
„Ich kann Ihnen die Versicherung geben, dass der junge Mann gesund und wohl ist und so gut behandelt wird, als es die Umstände irgend zulassen.“
Ich stellte ihm hierauf R.s Schwester vor mit der Frage, ob es ihr erlaubt sei, ihren Bruder zu sehen. Dieses versicherte der General jedoch nicht gestatten zu dürfen, da die Leute in den Kasematten seien, in welche niemand eingelassen werden dürfe. „Es wäre ein anderes“, setzte er hinzu, „wenn er krank oder verwundert im Spital läge, dann würde ich Ihnen augenblicklich die Erlaubnis erteilen, zu ihm zu gehen, so aber kann es nicht sein.“
„General“, sprach ich darauf bittend, „seien Sie einmal recht gut, und lassen Sie den jungen Mann auf eine halbe Stunde krank werden. Nachher können Sie ihn ja wieder in den Kasematten brummen lassen.“
Der General lachte herzlich, meinte aber doch, dass das nicht anginge.
Es wäre um so unbescheidener gewesen, weiter in ihn zu dringen, da er sich selbst sehr zuvorkommend erwies, indem er uns erlaubte, die Gefangenen mit Wäsche und Kleidungsstücken, sogar mit Zigarren, jedoch nicht mit Geld zu versehen, da dieses gegen die Vorschrift sei.
„Werden Sie denn die Güte haben, dem jungen Mann sagen zu lassen, dass seine Schwester hier war, dass seine um ihn besorgten Landsleute ihn nicht vergessen haben?“
„Nein, das werde ich nicht“, sagte er. Dann setzte er mit dem Ausdruck großer Gemütlichkeit hinzu: „aber ich werde heut noch selbst zu ihm gehen und ihm alles mitteilen.“ […]
1 Joseph Agnon Regnier
2 Mainz
Ich saß noch bei Tische, als ein Gendarm mit einem unanständigen Fetzen Papier in der Hand vor mir erschien, worauf der Name Kathinka Zitz in unleserlicher Schrift geschrieben stand.
Er fragte, ob ich so hieße, und als ich bejahte, forderte er mich auf, auf der königlich-preußischen Kommandantur zu erscheinen. Ich verfügte mich an den bezeichneten Ort, wo ich etwa sechs Offiziere fand. Ein beschnurrbarteter Leutnant, der, wie ich später erfuhr, von Schweinitz hieß und Adjutant des Obersten von Brandenstein war, übernahm das Amt des Inquisitors und fragte mich schnaubend: „Sind Sie die Frau des berüchtigten Zitz?“ Ich erwiderte, dass Ich die Frau des Dr. Zitz in Mainz sei, protestierte aber gegen das beleidigende Beiwort und werde stets gegen jede Herabsetzung protestieren, solange die ihm zur Last gelegten Anschuldigungen nicht erwiesen sind und dieses sind sie in keinerlei Hinsicht [...] Nachdem er Zitz noch als einen wahren Popanz und Heidengreuel hingestellt hatte, sagte er: „Glauben Sie etwa, Madame, wir wüssten nicht, dass Sie eine Volksversammlung in der Fruchthalle präsidiert und den Freischaren mehr als 10000 Pfund Charpie¹ geschickt haben?“ Da hatte der gute Mann eine Glocke läuten hören, ohne zu wissen wo; denn ich habe nie eine Volksversammlung in der Fruchthalle präsidiert. Ich bedeutete ihm, dass ich allerdings einen wohltätigen Frauenverein gegründet hätte, welcher 1700 Mitglieder zähle, dass aber das Wirken des Vereins derart sei, dass ihm selbst der absoluteste Monarch seine Achtung nicht versagen könne. Wir haben keine Kämpfer geworben und hinausgeschickt. Wir haben aber zurückgelassene Frauen unterstützt. Charpie hat das rheinhessische Korps nur solange von uns erhalten, als es in der Pfalz stand […] Weiterlesen
1 Wundverbandmaterial
Da es die Pflicht der Vereinsmitglieder ist, sich auch nach den Gefangenen zu erkundigen, so fragte ich den Leutnant nach einem jungen Manne aus Mombach, von dem ich gehört hatte, dass er in Karlsruhe gefangen säße, und ersuchte ihn, mir, sofern es nicht gegen die Vorschrift sei, Auskunft zu geben, ob sich auch Mainzer unter den Inhaftierten befänden. Aber der Leutnant, von dem ich mir ein Ja oder Nein und höchstens einige Namen in Anspruch nahm, schien zu glauben, dass ich die Absicht habe, meine Truppen gegen das Gefängnis marschieren zu lassen und die Kostgänger des Profossen gewaltsam zu befreien. „Madame“, rief er zornsprudelnd, „wir haben nichts mehr mit Ihnen zu reden. Sie können gehen.“ Ich machte eine höfliche Verbeugung und empfahl mich nach allen Regeln der guten Lebensart. Mein Gruß wurde nicht erwidert, und ich konnte noch sehen, wie der Leutnant samt einem älteren Offizier in rasender Hast die Treppe hinaufstürzte, um dem Kommandanten, Obersten von Brandenstein, Bericht über die Verbrechen zu erstatten.
Eine halbe Stunde später ließ sich der Polizeikommissar bei mir melden und ersuchte mich, mit der größten Artigkeit und unter tausend Entschuldigungen wegen seiner peinlichen Amtspflicht, am folgenden Morgen auf dem Polizeibüro zu erscheinen, indem die preußische Kommandantur meine Ausweisung verlangt habe. [...] Ich wurde am folgenden Morgen mit gleicher Artigkeit von dem Polizeidirektor empfangen, welcher mir das Schreiben des Kommandanten vorlegte, worin dieser auf meine Ausweisung antrug. Es lautet: „Eine Person, die sich Kathinka Zitz nennt und im weißen Bären logiert, ist augenblicklich auszuweisen.“ […] Auf dem Weg nach meinem Gasthause traf ich einen Polizeidiener, der mir andeutete, dass er Befehl habe, meine Abreise zu überwachen. In mein Zimmer gekommen, waren meine aus einem unverschlossenen Nachtsack und einem Regenschirm bestehenden Effekten fort. Ich ging in den Gastsaal, wo ich sie bei dem Wirt in Gegenwart eines untergeordneten Werkzeugs der Gewalt reklamierte. Er gab vor, sie bereits herunter haben bringen zu lassen. Sie waren während meiner Abwesenheit durchsucht worden und siehe, die bei mir gefundenen hochverräterischen Papiere bestanden aus alten Zeitungen, in welche meine Toilettgegenstände eingewickelt waren und meine Waffen aus einer in meiner Reisenecessaire enthaltenen Schere! […] Das Komische bei der Sache ist, dass ich ohne diese Ausweisung die königlich-preußische Kommandanturstadt drei Stunden früher verlassen haben würde als es der Formalitäten dieser Ausweisung wegen geschehen konnte.
Er [Rumpelstilzchen] begann in den auf meinem Nachttische liegenden Büchern und Journalen zu blättern. Das Erste, was ihm in die Hand fiel, waren Hoffmanns von Fallersleben unpolitische Lieder und die rheinische Zeitung. „Ei“, sagte er in Absicht, dem Gespräche eine andere Wendung zu geben: „Ei, sieh da, du nimmst auch Anteil an der Politik“ […] „Ich bin ein Kind des Jahrhunderts, Zweifel und Trostlosigkeit begleiten mich. Der Instinkt zu aller großen Dinge liegt in mir, aber ich bin kein Titane; ich denke nicht daran den Himmel zu stürmen, ich beschränke mich darauf ihn anzuklagen, weil er mich nicht zum Manne werden ließ. […] Die Freiheit ist die Gottheit, die ich in stiller Ehrfurcht verehre und anbete; hätte ich aber das Glück ein Mann zu sein, so müsste sie meine Geliebte werden, der ich Blut und Leben, Zeit und Gut zum Opfer brächte; die edelsten Kräfte meiner Seele, würde ich an das Glück und die Verherrlichung meines Vaterlandes setzen. O! Mein schönes Vaterland, welches nicht nur das in meiner dermaligen Verzauberung von mir bewohnte kleine Fürstentum, sondern das gesamte Deutschland ist, wann werden deine Wunden einmal aufhören zu bluten? Wann werden deine so oft getäuschten Hoffnungen erfüllt, wann deine Männer ihrer Kraft bewusst werden, und eine große Idee der Einigkeit durch alle deine Gauen herrschen!“ „Ei“, rief Rumpelstilzchen mit einem billigenden Beifallslächeln, das seinen ironischen Worten offenbar widersprach: „Ei, das sind ja sonderbare Gesinnungen für eine feudalistische Prinzessin, die noch aus den Zeiten der Leibeigenschaft herstammt?“
Es sprach ein Fürst von Glut entbrannt:
Kein Österreich, kein Preußen,
ein einzig, freies, deutsches Land,
so soll es künftig heißen.
Das fest wie seine Berge steht,
wenn es des Krieges Sturm umweht.
O! Deutsches Volk, hab‘ Einigkeit,
dann stehst du hoch vor Allen –
Zum Kampf gerüstet, siegbereit,
kannst du dann nicht mehr fallen;
hast in den Adern Löwenmark,
und bist durch eigne Kräfte stark.
[…]
Wir haben Männer die voll Mut,
für’s Recht den Tod nicht scheuen,
und die sich mit Begeisterungsglut
den Zeitintressen weihen. […]
Ein Hoch den Männern, die so kühn
Des Volkes Recht vertreten,
ihr Ruhmeskranz wird ewig blüh’n;
[…]
Ein Hoch auch jener Dichterschar,
die den Impuls gegeben;
vor ihren Blicken stand es klar:
Jetzt gilt es: Weiterstreben!
Hör‘ Deutschland, auf den Geist der Zeit.
Und sei jetzt stark in Einigkeit.
1 Das Gedicht zeigt, für wie wichtig Kathinka Halein den Einfluss von Dichtern und politischer Literatur im politischen Kampf hielt
In einem schön geschmückten Zimmer
Stand eine Vase von Porzlan,
sehr reich verziert mit Goldesflimmer,
ein jeder sah sie staunend an.
Gleich neben in der Küche stand,
ein Topf, von schlechtem Ton gebrannt,
der rußig, aber nützlich war,
er diente Tag für Tag im Jahr,
und ward der Suppentopf genannt.
Einst standen offen alle Türen,
der schwarze Topf tat ein Gelüst‘
in seinem Inneren verspüren,
die Vase auf dem Prunkgerüst‘,
die da stand auf vier goldnen Füßen,
einmal recht brüderlich zu grüßen.
Er neigte freundlich sich vor ihr. –
O Topf, das war sehr frech von dir,
denn du in deinem schwarzen Kleide
du warst ihr keine Augenweide. –
Die Vase blieb ganz stocksteif steh’n
Und tat als hätt‘ sie nicht geseh’n,
dass einer der gemeinen, niedern
gebrannten Töpfe sie gegrüßt
auf ihrem hohen Prunkgerüst.
Auch kam es ihr nicht in den Sinn,
den Gruß des Topfes zu erwiedern.
Am Abend brach nun in dem Haus
Ganz unvermutet Feuer aus.
Einer jeder suchte, was er rette,
und brachte von der Unglücksstätte
mach groß und kleinen Gegenstand
in Sicherheit mit flinker Hand.
Es gab ein großes Durcheinander,
und Topf und Vase kam selbander
in einem Korb zugleich gerafft,
und zu dem Nachbar hingeschafft,
urplötzlich Seit‘ an Seit‘ zu steh’n –
hier galt kein Voneinanderdreh’n.
Es war ein Glück, dass ohne Sprung
Sie beide aus der Not gekommen,
und dass des Nachbars Kammer sie
in ihren Raum hat aufgenommen.
Die Goldne nahm es sich zu Herzen,
dass sie nicht mehr im Prunkgemacht
sich brüsten konnt‘, und manches Ach!
stieß sie jetzt aus mit bittern Schmerzen.
Dann wandt‘ sie an den Schwarzen sich
Mit gar trübseligen Geberden,
und sprach: „Ach lieber Bruder, sprich!
Was soll nun aus uns beiden werden?“
So geht es gar zu oft im Leben,
drum merkt euch, ob ihr arm, ob reich:
Das Unglück nähret alle Menschen,
und machet alle Stände gleich.
Im März dieses Jahres da ist über Nacht
Ein herrliches Veilchen zum Leben erwacht,
Verbreitet den Balsam all' Enden und Orten,
Ganz Deutschland das ist bald berauscht davon worden.
Das Veilchen heißt Freiheit, die lang unterdrückt,
Sich schüchtern ins Gras unter Blätter gebückt,
Die oft von gewaltigen Füßen getreten,
Nicht wagte zu handeln, nicht wagte zu reden.
Weiterlesen
1 Das Gedicht ist eine Reaktion von Kathinka Zitz-Halein auf blutige Kämpfe zwischen Bürgerwehr und preußischen Soldaten im Mai 1848.
Doch als nun die Blume die Knospe gesprengt,
Als sie sich voll Leben zur Sonne gedrängt,
Wie sind da die Düfte im Länderdurchwallen,
Den fürstlichen Herrn auf die Nerven gefallen.
Wie sprachen sie freundlich zum Volk: »Hab' Geduld,
Wir zahlen dir nächstens die säumige Schuld.
Wir wollen dich huldvoll mit Rechten begaben,
Und was du verlangst, das sollst du auch haben.«
Schon reckt die Gewalt wieder kecklich das Ohr,
Wir tragen die Lasten noch jetzt wie zuvor,
Und was wir als Vorspiel einstweilen bekommen,
Das hat man in Baden zurück schon genommen.
Dort nahm man dem Volke die Waffen gleich ab,
Die man ihm als Spielwerk zu Händen erst gab;
Dort sitzen die Männer gefangen in Zellen,
Die's wagten den Wortpfeil vom Bogen zu schnellen.
Kaum sind seit dem Umsturz zwei Monden vorbei,
Schon kränkelt das Veilchen, wir haben erst Mai.
Wie ist's zu erhalten in künftigen Tagen?
Es kann wohl die fürstliche Sonn' nicht vertragen.
Wir haben die günstige Stunde versäumt,
Drum heißt's nun: Sie haben von Freiheit geträumt.
Wir schicken die Unseren zum Parlamente,
Die machen dem Treiben ein baldiges Ende.«
Hab Acht, o mein Volk, sei beständig auf Hut;
Laß ein dir nicht schüchtern den männlichen Muth.
Soll's Veilchen dir fröhlich und frisch wieder sprießen,
So mußt du es mit deinem Herzblut begießen.
Vorwärts! rufen die Lichtbekenner,
Lasst uns Fackeln der Wahrheit sein.
Rückwärts! heulen die Dunkelmänner,
Meidet jeglichen hellen Schein.
Vorwärts gehe stets unser Streben,
Tatendrang ist in uns erwacht.
Rückwärts sichert uns Gut und Leben,
Haltet fest an der alten Nacht.
[…]
Vorwärts! die Geschichte beweist es,
Freiheit sei das edelste Los.
Rückwärts! nähret den Bauch statt des Geistes,
Und ihr ziehet euch Sklaven groß.
Vorwärts! aber belügen und trügen
Sollen unsere Lippen nie.
Rückwärts! wir werden dennoch siegen,
Es gibt noch gar viel Menschenvieh.
Wenn ich ein König wäre, säh′ ich des Volkes Schmerzen,
Und tiefe Trauer trüg′ ich alsdann in meinem Herzen,
Ich wäre nicht erblindet für seine große Not,
Nicht taub für seine Klagen, wenn ihm Verderben droht.
Ich säh′ die Einen schwelgen in ihren Prunkgemächern,
Sie edle Weine schlürfen aus Gold- und Silberbechern,
In Duhnenbetten ruhen, mit Seide zugedeckt,
Bis sie die hohe Sonne aus süßem Schlummer weckt.
Weiterlesen
In säh′, wie sie den Lüsten, den eitlen, Opfer zollen.
Von Rossen stolz gezogen, vom Fest zur Oper rollen,
Wie sie dann sorglos schlafen in sichrer Gegenwart,
Vertrauend auf die Zukunft, die ihrer Tage harrt.
Doch säh′ ich auch die Andern in ungesunden Räumen,
Die fort und fort beschäftigt, die nimmer müßig säumen,
Die unterm Dache wohnend, gebettet sind auf Stroh,
Von Lumpen kaum bedecket, die nie des Lebens froh,
Durch Fleiß und saure Mühe nicht so viel sich erwerben,
Zu sättigen die Kinder, die fast vor Hunger sterben,
Zu wärmen nur die Kleinen, die′s friert bei Nacht und Tag,
Und die doch leben müssen, weil sie der Tod nicht mag.
Ihr Leben voll Entbehrung, voll Kummer und voll Sorgen,
Bekrönt als Schmerzensstachel, die Furcht vorm andern Morgen,
Da sie nicht wissen können, ob er das dürft′ge Brot
Den Armen wird bescheren, ob größer wird die Not.
Und säh′ ich so die Reichen, und säh′ ich so die Armen,
So würd′ ich mich der Letztern mit mildem Sinn erbarmen;
Mit jenen die da leiden, mit jenen litt auch ich,
Ihr Schicksal zu verbessern, das nähm′ ich stolz auf mich.
So lang in meinem Reiche noch Bettler vor sich fänden,
So lange noch Arbeiter mit starken fleiß′gen Händen,
Vergebens an Werkstätten um Arbeit klopfen an,
So lange würd′ ich glauben, ich hätte nichts getan.
Den lügenden Ministern, die sich oft dreist erfrechen,
Vom Wohlstand eines Landes mit feiler Zung′ zu sprechen,
Würd′ ich nicht Glauben schenken, so lang des Armen Schweiß,
Den Reichen Früchte bringet, von denen er nichts weiß.
[…]
Des Volkes laute Klagen, die Tränen, die da fallen,
Die würden mir im Herzen beständig widerhallen.
Ich könnte nimmer ruhen, bis ich den Grund erschaut,
Bis denen ich geholfen, die mir ihr Glück vertraut.
Und würd′ es mir gelingen da Wohlstand zu verbreiten,
Wo jetzt die Armut waltet, wo Noth und Elend streiten,
Hätt′ ich die Volksverblutung mit milder Hand gestillt,
Ja, dann erst würd′ ich glauben, sei meine Pflicht erfüllt.
Und wenn mich Der beriefe, der alle Spaltung schlichtet,
Der Könige und Bettler mit gleicher Strenge richtet,
Bät′ ich vor Gottes Throne in jenem Geisterland:
"O Herr! beschütz′ die Völker, die Vater mich genannt."
Einst noch in späten Zeiten wird die Geschichte melden
Von Kirchheim-Bolands Garten und von den dreißig Helden,
Die in ihm eingeschlossen, sich mit dem Feind gerauft,
Und dort im Freiheitskampfe die Erd' mit Blut getauft.
Um ihren Waffenbrüdern den Rückzug kühn zu decken,
Sind sie zurück geblieben, und kämpften ohne Schrecken
Voll Mut zum Tod entschlossen, mit Feinden allzumal,
Die ihnen überlegen wohl tausendfach an Zahl.
Weiterlesen
1 Das Gedicht bezieht sich auf den gewaltsamen Tod von 17 Freischärlern durch preußische Truppen in Kirchheimbolanden. Den Erlös aus den Drucken des Gedichts spendet Kathinka Zitz-Halein zur Errichtung eines Gedenksteins für die Toten. Für die Einnahme von Spenden wirbt sie auch in den letzten drei Strophen des Gedichts.
Sie hielten sich im Kampfe drei lange, lange Stunden,
Da fielen siebzehn Männer an den erhalt 'nen Wunden.
Fürwahr solch' tapf'res Ringen sah die Geschichte nie,
Sie stritten wie die Löwen, wie Helden fielen sie.
Dies war die blut'ge Taufe der deutschen Muttererde,
Damit der Reichsverfassung die volle Geltung werde.
Es war ein edles Ringen, ein heil 'ges Märtyrtum –
Es kamen die Blutzeugen für deutsche Freiheit um.
Für deutsche Freiheit! - wehe! – sie ward im Keim erstickt,
Doch ward sie nicht besieget, sie ward vom Feind erdrückt.
Der Sieg ward nicht errungen durch Muth und Tapferkeit,
Die Übermacht allein nur entschied den Bruderstreit.
Denn dort - es ist die Wahrheit - im kleinen Lande Baden,
Da kämpfen gegen einen - ihr wisst es - zehen Staaten.
'S ist keine Kunst zu siegen auf blutgetränktem Feld,
Da wo man gegen Einen zum Kampfe Fünfzig stellt.
Gar viele sind gefangen, gar viele, viele Braven,
Die tun den langen Schlummer im Schoß der Erde schlafen.
Sie hatten ihre Pflichten als Deutschlands Söhn' erkannt,
Und kann man schöner sterben, als für das Vaterland?
Doch ist darum die Freiheit, um die wir kühn geworben,
Das stolze Göttermädchen, mit ihnen nicht gestorben,
Sie liegt jetzt nur im Schlummer und in der Zeiten Lauf
Wacht sie einst neu gekräftet und schöner wieder auf.
Auch Christus ist gestorben, er lag in Grabesbanden,
Doch ist er nach drei Tagen zum Leben auferstanden.
D'rum laßt den Muth nicht sinken, erhebt die Blicke frei,
Die Sonne strahlet wieder, so oft die Nacht vorbei.
Und Ihr, Ihr Frauen und Mädchen, ihr kennet ja die Kunde
Von Frauenlob dem Sänger, sie geht von Mund zu Munde,
Der einst vor grauen Zeiten so süß und liebebang,
Den Wert der edlen Frauen in schönen Liedern sang.
Als er darauf gestorben, tut die Geschichte sagen,
Da haben ihn die Frauen zum Grabe hin getragen;
Sie warfen Blumenkränze, sie gossen edeln Wein
Ihm mit betränten Augen in seine Gruft hinein.
Und ihrer tut mit Liebe man heute noch gedenken,
Dem Wirken edler Frauen muss jeder Achtung schenken.
D'rum folget ihrem Beispiel – wer wirkt durch Tat und Wort,
Der lebt in der Geschichte durch alle Zeiten fort.
Nicht sollt Ihr einen Dichter in seinem Grabe kränzen
Nicht sollen eure Tränen für einen Sänger glänzen,
Nicht sollet auf den Schultern zur letzten ew'gen Ruh
Ihr eure Toten tragen – wer mutet euch das zu –
Doch die in Kirchheims Garten den Heldentod gestorben,
Die haben heil 'ge Rechte auf Euern Dank erworben,
Es wird ihr Angedenken, euch ewig teuer sein,
Setzt ihnen, Mainzer Frauen, d'rum einen Leichenstein.
Und auf dem Stein, dem kalten, da sei es groß zu lesen,
Wie tapfer und wie mutig die Siebzehn sind gewesen
Wie sie um zu erwerben der Freiheit hohes Gut
Ihr Leben aufgeopfert, verspritzt ihr heil 'ges Blut.
Dann wird in fernen Tagen, wenn wir einst nicht mehr leben,
Der Vater seinem Sohne von euch noch Kunde geben;
Das Denkmal das ihr setztet, sagt dann dem ganzen Land
Wie Mainzer Frau'n die Größe stets ehrend anerkannt.
Phantasieblüten und Tändeleien. Gedichte, Mainz 1826.
Sonderbare Geschichten aus den Feenländern. Eine unterhaltsame Lektüre für Alt und Jung. Erstes Bändchen, Nürnberg 1844.
Sonderbare Geschichten aus den Feenländern. Eine unterhaltende Lektüre für Alt und Jung. Zweites Bändchen, Nürnberg 1844.
Erzählungen und Novellen. Fremd und Eigen. Erstes Bändchen, Nürnberg 1845.
Erzählungen und Novellen. Fremd und Eigen. Zweites Bändchen, Nürnberg 1845.
Herbstrosen in Poesie und Prosa, Mainz 1850.
Variationen in humoristischen Märchenbildern, Mainz 1849.
Der alte Robinson Crusoe. Nach dem ersten englischen Original neu erzählt, Mainz ca. 1849.
Robinson Crusoe. Für die Jugend bearbeitet von Kathinka Zitz, Mainz 1849.
Donner und Blitz. Erzählung, Mainz 1850.
Süß und sauer, Mainz 1851.
Neue Rheinsandkörner. Ein Novellen-Zyklus, Mainz 1852.
Letzte Rheinsandkörner, Mainz 1854.
Erzählungen und Novellen, Mainz 1854.
Ernste und heitere Lebensbilder. Erzählungen, 3 Bände, Berlin 1854.
Die Najaden des Soolsprudels zu Nauheim nebst anderen Novellen und Erzählungen, Mainz 1854.
Kaiserin Josephine, Mainz 1855.
Neue Erzählungen, Mainz 1855.
Schillers Laura, nebst anderen Erzählungen und Novellen, Mainz 1855.
Welt-Pantheon. Eine Festgabe (Gedichte), Mainz 1856.
Beiträge zur Unterhaltungsliteratur, Mainz 1856.
Magdalene Horix oder Vor und während der Klubistenzeit. Ein Zeitbild, Mainz 1858.
Dur- und Molltöne. Neuere Gedichte, Mainz 1859.
Die Entdeckung und Eroberung von Amerika durch Columbus, Cortez und Pizzaro, Mainz ca. 1860.
Spiegelbilder in belehrenden und warnenden Beispielen, Mainz 1861.
Juwelenkästchen für Kinder, die gut und brav werden wollen, Mainz 1862.
Der Roman eines Dichterlebens, Leipzig 1863:
Der Roman eines Dichterlebens. 1. Abteilung: Goethes Jugendjahre (1759-1775), Leipzig 1863.
Der Roman eines Dichterlebens. 2. Abteilung: Goethes Männerjahre (1775-1806), Leipzig 1863.
Der Roman eines Dichterlebens. 3. Abteilung: Goethes Greisenalter (1807-1832), Leipzig 1863.
Heinrich Heine, der Liederdichter. Ein romantisches Lebensbild, Leipzig 1864.
Abteilung: Herbstschauer und Winterkälte
Rahel oder dreiunddreißig Jahre aus einem edlen Frauenleben, Roman, 6 Bände, Leipzig 1864.
Lord Byron. Romantische Skizzen aus einem vielbewegten Leben, 5 Bände, Mannheim 1866.
Bock, Oliver: Kathinka Zitz-Halein. Leben und Werk, Hamburg 2010.
Brüchert, Hedwig: Kathinka Zitz-Halein, 2021, https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/biographien/zitz-halein-kathinka.html.
Erbar, Ralph: Kathinka Zitz-Halein (1801-1877). Ein Leben voller Enttäuschen, in: Frauen in Rheinhessen – 1816 bis heute, hg. von Susanne Kern / Petra Plättner, Mainz 2015, S. 31-36.
Grimminger, Birgit: Kathinka Zitz und Johanna Kinkel. Solidarität und Freundschaft im Spannungsfeld der 48er Revolution, Mainz 2018.
Hübel, Marlene: Erfolgreich, aber vergessen: Adelheid von Stolterfoth und Kathinka Zitz, in: Romantik, Reisen, Realitäten. Frauenleben am Rhein, hg. von Bettina Bab / Marianne Pitzen, Bonn 2002, S. 58-65.
Keim, Anton Marie: Kathinka Zitz und Mathilde Hitzfeld. Frauen zwischen Revolution und Reaktion, in: Frauen in der Geschichte, Lebendiges Rheinland-Pfalz. Zeitschrift für Kultur und Geschichte, 2, 1986, S. 44-50.
Liedtke, Christian: Kathinka Zitz-Halein (1801-1877) – Zeitschriftstellerin und „Beschützerin aller Demokraten“, in: Vom Salon zur Barrikade: Frauen der Heinezeit, hg. von Irina Hundt, Stuttgart / Weimar 2002, S. 223-239.
Mecocci, Micaela: Kathinka Zitz (1801-1877). Erinnerungen aus dem Leben der Mainzer Schriftstellerin und Patriotin, Mainz 1998.
Mecocci, Micaela: Kathinka Zitz-Halein. Ein politisches und literarisches Frauenschicksal in Mainz zur Zeit der 1848er Revolution, in: Mainz und Rheinhessen in der Revolution von 1848/49 (Mainzer Geschichtsblätter 11), hg. von Hedwig Brüchert, Mainz 1999, S. 85-108.
Noering, Dietmar: Kathinka Halein: Ein Leben in schwerer Zeit, in: Zitz, Katinka: Wahre Freiheit. Gedichte und Prosa, hg. von Dietmar Noering, Frankfurt a.M. 1987, S. 101-122.
Özdemir, Derya: Die "Beschützerin aller Demokraten" - Kathinka Zitz (1801-1877) und die Revolution von 1848/49, in: https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/aufsaetze/oezdemir-derya/oezdemir-die-beschuetzerin-aller-demokraten-kathinka-zitz-1801-1877-und-die-revolution-von-184849.html.
Schmidt, Sabine: Dichterin = Ausgestoßene. Weibliches Leben und Schreiben zwischen Vormärz und Deutschem Reich – das Beispiel Kathinka Zitz-Halein (1801-1877), in: Schwellenüberschreitungen. Politik in der Literatur von deutschsprachigen Frauen 1780-1918, hg. von Caroline Bland / Elisa Müller-Adams, Bielefeld 2007, S. 169-188.
Wende, Angelika: Kämpferisch, einsam und verletzt. Kathinka Zitz (1801-1877), in: Federführend. 19 Autorinnen vom Rhein, hg. von Marlene Hübel / Jens Frederiksen, Ingelheim 2003, S. 149-158.
Zehendner, Anne-Kathrin: Kathinka Zitz (geb. Halein) 1801-1877, in: Mainz – Menschen, Bauten, Ereignisse. Eine Stadtgeschichte, hg. von Franz Dumont / Ferdinand Scherf, Mainz 2010, S. 141f.
Zucker, Stanley: Femal Political Opposition in Pre-1848 Germany. The Role of Kathinka Zitz-Halein, in: German Women in the Nineteenth Century. A social history, hg. Von John C. Fout, New York / London 1984, S. 133-150.
Zucker, Stanley: German Women and the Revolution of 1848: Kathinka Zitz-Halein and the Humania Association, in: Central European History, Nr. 13, 1980, S. 237-254.
Zucker, Stanley: Kathinka Zitz-Halein and Female Civic Activsm in Mid-Nineteenth-Century Germany, Carbondale 1991.
KATHINKA ZITZ-HALEIN
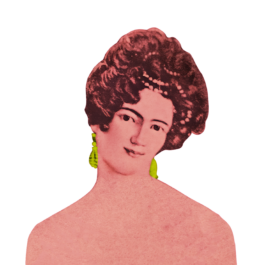
Schon von Kindesbeinen an kommt Kathinka Zitz-Halein mit liberalem und revolutionärem Gedankengut in Berührung: Ihre Geburtsstadt Mainz ist bis 1814 unter französischer Besatzung und durch die jakobinische Bewegung und den napoleonischen Code Civil schon früh liberal geprägt.
Erst durch Artikel und Gedichte, dann auch durch Taten wird sie selbst politisch aktiv, vor allem durch den von ihr gegründeten Frauenverein „Humania“. Dieser ist der größte und einflussreichste Frauenverein der Revolutionszeit – fast jede 10. Frau in Mainz ist Mitglied. Sie sammeln nicht nur Geld- und Sachspenden für verfolgte und gefangene Demokraten und ihre Familien, sondern stellen auch Waffen und Verbandsmaterial bereit. Für den Verein reist Zitz-Halein durch die Kampfgebiete und unterstützt politische Gefangene vor Ort. Klar ist aber immer ihr Blick auf Geschlechterrollen: Nur die Männer sollen aktiv kämpfen, Frauen sollen sie lediglich unterstützen und nicht selbst zur Waffe greifen.
Gleichzeitig ist sie eine produktive Schriftstellerin, der allein über 50 eigenständige Buchpublikationen zugerechnet werden. Weil sie auch unter Pseudonymen und anonym veröffentlicht, gibt es bis heute keine vollständige Bibliografie ihrer Werke.
Kathinka Halein wird am 4. November in Mainz geboren. Ihr Vater ist Kaufmann und, nach Haleins eigenen Darstellungen, alkoholkrank und gewalttätig. Sie erhält eine literarisch und musisch geprägte Ausbildung, lernt Französisch und kommt mit den Werken von Voltaire und politisch-historischem Wissen in Berührung.
Auf einen Zeitungsartikel des Historikers Friedrich Lehne über die Hutmode der Zeit schreibt Halein mit 15 Jahren eine humoristische Gegendarstellung und sendet sie ein. Der Artikel wird abgedruckt und Lehne selbst unterstützt Halein fortan. In der Mainzer Zeitung erscheinen einige ihrer ersten Gedichte, bereits 1823 erscheint sie erstmals in einem Lexikon deutscher Schriftstellerinnen.
Nach dem Tod ihrer Mutter und aufgrund der psychischen Erkrankung ihres Vaters muss Halein für sich und ihre schwerkranke Schwester Julia Geld verdienen – als Erzieherin und Leiterin einer Mädchenschule, aber auch mit Handarbeiten, Französischunterricht und ihrem Schreiben.
Halein besucht das Grab von Karl Ludwig Sand, dessen Mord an August von Kotzebue den Anlass für die Karlsbader Beschlüsse gegeben hatte. Dieser Besuch kann als erste Anzeichen von Haleins politischer Gesinnung gesehen werden.
Halein, fortan Kathinka Zitz oder Zitz-Halein, heiratet Dr. Franz Zitz, ein Jurist, der zu einen der radikal-demokratischen Revolutionsführern in Mainz gehört. Weil sie älter ist als ihr Mann und mittellos kursieren Gerüchte, sie habe ihn durch Selbstmorddrohungen zur Ehe gezwungen. Die Ehe mit Franz Zitz verläuft unglücklich und bereits ab 1839 lebt das Paar in Trennung; zur Scheidung kommt es nie, aber zu mehreren Prozessen, weil Zitz den Unterhalt für seine Frau nicht zahlt.
Ihre ersten politisch geprägten Gedichte werden veröffentlicht. Sie misst der politischen Literatur eine besondere Bedeutung in der Revolution bei. Von vielen wird sie, weil sie sich als Frau zu politischen Themen äußert, kritisiert oder skandalisiert.
Zitz-Halein schließt sich der deutschkatholischen Bewegung an, die sich als eine der wenigen politischen Bewegungen der Zeit auch dem Thema der Frauenemanzipation widmet.
Als der Großherzog von Hessen-Darmstadt den liberalen Code Civil abschaffen will, veröffentlicht Zitz-Halein in der „Mannheimer Abendzeitung“ mehrere Artikel über das Vorgehen und die Pressezensur, die in Mainz stärker gilt als in Baden, und prägt damit den vorrevolutionären Widerstand.
Unter der Führung von Zitz-Halein gründet sich in Mainz der Frauenverein „Humania“, nach Vorbild anderer Frauenvereine. Für ihre Arbeit und wegen ihrer Ehe mit Zitz muss sie sich mehrfach vor Gericht verantworten. Obwohl freigesprochen wird sie auch noch Jahre später als „politisch gefährlich“ im „Anzeiger für die politische Polizei“ aufgeführt.
Nach Unstimmigkeiten im Vorstand, unter anderem über Frage, wie politisch der Verein sein soll, legt Zitz-Halein ihr Amt im „Humania“-Verein nieder. Daraufhin treten immer mehr Frauen aus, sodass der Verein im folgenden Jahr aufgelöst wird. Zitz-Halein versucht weiterhin, humanitäre Arbeit zu leisten, muss sich aber aufgrund der voranschreitenden Restaurationspolitik aus der Öffentlichkeit zurückziehen und widmet sich wieder hauptsächlich dem Schreiben. In diesen Jahren veröffentlicht sie vor allem Unterhaltungsliteratur.
In ihrer Gedichtsammlung „Weltpantheon“ finden sich knapp 200 Gedichte zu berühmten Persönlichkeiten, darunter viele Frauen wie Bettina von Arnim oder Elizabeth Fry. Auch in dem drei Jahre später erschienen „Dur- und Molltönen“ widmet Zitz-Halein sich in Gedichten den Lebensgeschichten bekannter und weniger bekannter Frauen. Beide Werke finden aber wenig Anerkennung.
Ihr „Roman eines Dichterlebens“ über Johann Wolfgang von Goethe verkauft sich so gut, dass sie weitere Romane über berühmte Dichter (Heinrich Heine, Rahel Varnhagens und Lord Byron) folgen lässt. Die Wahl Heines zeigt, dass sie sich weiterhin gegen die restaurative Politik der Zeit stellt.
Im deutsch-französischen Krieg versorgt Zitz-Halein verwundete Soldaten, worunter auch ihre eigene Gesundheit stark leidet. Sie wird in das St. Vizenziuspensionat der Barmherzigen Schwestern in Mainz aufgenommen, wo sie am 8. Mai 1877 verstirbt.
Derya Özdemir
»Das weibliche Geschlecht hat es teils schon begriffen und wird es teils noch begreifen, dass sein Beruf in dieser großen Zeit ein ernsterer ist, als der des untätigen Besuchens demokratischer Vereine und Volksversammlungen, oder der Beteiligung an einer zu stickenden Fahne. Ohne aus den Schranken der Weiblichkeit heraus zu treten, können die Frauen durch ihr Wirken dem Vaterlande von bedeutendem Nutzen werden, durch tatkräftiges Wirken und Walten.«² Weiterlesen
Mit diesem Aufruf »An die Frauen und Jungfrauen von Mainz« (siehe auch „Was sie dachten und schrieben“) rief die Mainzer Schriftstellerin und Demokratin Kathinka Zitz (1801–1877) zur Gründung des Frauenvereins »Humania« auf und bewies damit Mut und Engagement in der Revolution von 1848/49. Der am 16. Mai 1849 gegründete Verein entwickelte sich unter ihrer Führung zu einem der größten und einflussreichsten Frauenvereine der Revolutionszeit.3 Zitz avancierte zu einer zentralen Figur der revolutionären Bewegung und inspirierte zahlreiche Frauen, sich aktiv politisch und gesellschaftlich zu engagieren.
Agitatorische Poesie
Schon vor der Revolution war Zitz als Schriftstellerin bekannt. Mit Ausbruch der Revolution intensivierte sie ihre schriftstellerische Tätigkeit und veröffentlichte ihre Gedichte in Zeitungen wie der Didaskalia4 oder auf Flugblättern. Ihre Lyrik war nicht nur Ausdruck persönlicher Überzeugung, sondern diente auch der politischen Mobilisierung. Besonders bekannt wurde ihr heute noch gern zitiertes Gedicht »Märzveilchen« (siehe „Was sie dachten und schrieben“), in dem sie unter anderem ein Loblied auf die Freiheit sang und zum Handeln aufrief:5 »Das Veilchen heißt Freiheit, die lang unterdrückt, / Kaum sind seit dem Umsturz zwei Monden vorbei, / Schon kränkelt das Veilchen, wir haben erst Mai. / Soll’s Veilchen dir fröhlich und frisch wieder sprießen, / So musst du es mit deinem Herzblut begießen.«6
Zitz nutzte ihre Popularität auch für humanitäre Zwecke. Als sie im April 1848 von dem Versuch der dänischen Regierung, die beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein vollständig in den dänischen Gesamtstaat einzuverleiben, erfuhr, was schließlich zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem Königreich Dänemark und der vor allem von Preußen unterstützten Nationalbewegung in den beiden Herzogtümern führte, organisierte sie in Mainz eine Spendensammlung.7 Von dem Erlös schickte sie Verbandsmaterial an die Front und fügte das Gedicht »An die Schleswig-Holsteiner« bei, in dem sie den gemeinsamen nationalen Kampf beschwor.8 Darin heißt es: »Frei will fortan der Deutsche sein / Ob er am Belt, ob er am Rhein / Er bricht mit kräft’ger Hand die Ketten!«9 An diesem Gedicht wird zweierlei deutlich: Erstens beschränkte sich Kathinka Zitz in ihren Werken geografisch nicht nur auf Mainz, sondern informierte auch über politische Aktivitäten und Ereignisse in Städten und Regionen anderer deutscher Einzelstaaten. Zweitens gibt sie sich in dem Gedicht als eine Verfechterin der deutschen Einheit zu erkennen, die die Annexion Schleswig-Holsteins durch Dänemark als unrechtmäßig hielt und als Verrat an der nationalen Einheitsbewegung Deutschlands verstand. Deshalb griff sie das politische Geschehen mit einem eigenen Gedicht auf, um im öffentlichen Meinungsbildungsprozess Stellung zu beziehen.
Zitz’ Gedichte begleiteten das wechselvolle Revolutionsgeschehen über die gesamte Dauer – von den anfänglichen Höhepunkten bis zur Niederlage am Ende – und stellten damit einen wichtigen Beitrag zur demokratischen Seite der Revolutionsöffentlichkeit dar. Beeindruckend ist vor allem das breite Themenspektrum, das sie in ihren Gedichten aufgriff und behandelte. Zitz erlebte die revolutionären Ereignisse in Mainz unmittelbar mit und verarbeitete diese Erfahrung in ihren Werken, indem sie die politische Situation sowohl im Großherzogtum Hessen-Darmstadt als auch im restlichen Deutschen Bund näher beleuchtete, Missstände anprangerte, revolutionäre Werte wie Freiheit und Demokratie propagierte und nicht zuletzt die Frage der deutschen Einheit thematisierte und in der Folge zur politischen Agitation aufrief. Mit ihrer literarisch-politischen Tätigkeit machte sie sich sicht- und wahrnehmbar und demonstrierte damit auch ihre Handlungsbereitschaft. Damit durchbrach sie die zeitgenössisch vorgegebenen Handlungsspielräume von Frauen und grenzte sich zugleich von anderen bürgerlichen Frauen ab. Letztlich bildete das Interesse von Zitz an den revolutionären Ereignissen eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung eigener aktiver politischer Handlungsspielräume.
Die Gründung der »Humania«
Am 16. Mai 1849 versammelten sich zahlreiche Mainzer Frauen zur Gründung der „Humania“. Zitz appellierte an ihre Mitstreiterinnen, das Vaterland „durch tatkräftiges Wirken und Walten“ zu unterstützen. Der Verein konzentrierte sich zunächst auf karitative Aufgaben, unterstützte verwundete Freischärler und deren Familien und sammelte Spenden. Zitz betonte dabei die Bedeutung weiblicher Solidarität und forderte die Frauen auf, sich „nicht mehr als Frauenzimmer, sondern als Bürgerinnen und Vaterlandsfreundinnen“ zu verstehen. Kathinka Zitz ging es also vorrangig um einen weiblichen Zusammenschluss, der den Bürgerinnen bei der Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Pflichten helfen, ihnen aber auch ein Engagement in der Revolution ermöglichen sollte. Auf diese Weise wollte sie die Frauen befähigen, nicht nur ihre Pflichten als Hausfrau, Mutter und Ehefrau zu erkennen und zu erfüllen, sondern auch diejenige als »Bürgerin« und »Vaterlandsfreundin«. Mit der ihnen neu zugeschriebenen, aufgewerteten Funktion als Bürgerin war vermutlich auch die Hoffnung verbunden, die Frauen für die Verwirklichung demokratischer Ziele zu gewinnen. Schließlich wies Zitz den Frauen eine politische Verantwortung zu und schuf bei ihnen damit zugleich eine Grundlage für das Bewusstsein von der besonderen Rolle und Bedeutung der Frauen in der Öffentlichkeit.
In diesem Zusammenhang appellierte sie – wie auch in der Generalversammlung im Juni und Juli 1849 – an ihre Mitstreiterinnen, »in Dörfern und Städten dafür zu wirken, daß sich überall Zweigvereine bilden«, um auf diese Weise »zu dem Bau des einigen freien Vaterlandes« beizutragen.10 So entstanden in ganz Deutschland Frauenvereine nach dem Vorbild der Mainzer Assoziation. Nur wenige Tage nach der Gründung der »Humania« entstand in Mainz-Kastel der Frauenverein »Rhenania« (Rheinland). Zitz half dem Kasteler Frauenverein – und auch anderen Frauenvereinen in verschiedenen Orten wie der Vereinigung von Therese Rauch in Landau11 – eine organisatorische Grundlage zu schaffen, indem sie ihnen zum Beispiel die Vereinsstatuten oder Gründungsreden zur Verfügung stellte.12 Zitz übernahm auch die Aufgaben der Frauenvereine in Mannheim und Heidelberg, die sich wegen Verbotes oder drohender Verfolgung aufgelöst hatten und nun die Präsidentin der »Humania« um Unterstützung und Hilfe baten.13 Weitere demokratische Vereine, die den Kontakt zu Zitz suchten, waren unter anderem die Vereine in Alzey, Bonn, Darmstadt, Frankfurt und Worms.14 Zitz' Bemühungen führten zu einem überregionalen Netzwerk, das revolutionäre Gruppen und prominente Demokratinnen und Demokraten miteinander verband, darunter den Präsidenten des Rumpfparlaments Wilhelm Loewe (1814–1886)15 oder den Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung Franz Raveaux (1810–1851)16.
Die „Missionsreisen“
Im Sommer 1849 unternahm Zitz zwei „Missionsreisen“, um gefangenen und geflüchteten Revolutionären zu helfen. In Baden (Bericht über diese Reise, siehe „Was sie dachten und schrieben“) und der Pfalz setzte sie sich für inhaftierte Freiheitskämpfer ein, organisierte humanitäre Hilfen und verhandelte mit Militärkommandanten über bessere Haftbedingungen. In der Schweiz half sie Flüchtlingen bei der Rückkehr nach Deutschland und versorgte sie mit Kleidung und Geld.17
Trotz des Scheiterns der Revolution ließ sich Kathinka Zitz in ihrem Engagement nicht beirren. Noch im August 1849 reiste sie nach Mannheim, das in den folgenden Jahren – wie viele andere deutsche Städten und Regionen – von der Reaktion beherrscht wurde.18 Aus Mannheim, wo sie sich angeblich aus privaten Gründen aufhielt, in Wirklichkeit aber an den Prozessen gegen badische und pfälzische Freischärler teilnahm, schrieb sie, wenn auch anonym,19 für den »Demokrat« ihre sogenannten »Mannheimer Briefe«, datiert vom 17. und 23. August sowie vom 9. und 13. September 1849.20 Darin prangerte sie die Brutalität der preußischen Truppen an und machte das Schicksal politischer Gefangener öffentlich.
Schlussbetrachtung
Kathinka Zitz war eine der wenigen Frauen, die sich aktiv an der Revolution von 1848/49 beteiligten. Durch ihre literarischen Werke, ihre Vereinstätigkeit und ihr humanitäres Engagement sprengte sie die gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit und prägte das politische Bewusstsein. Ihr Wirken zeigt, dass Frauen nicht nur eine passive Rolle im politischen Geschehen einnahmen, sondern aktiv an der Gestaltung demokratischer Strukturen beteiligt waren. Ihr Engagement legte den Grundstein für spätere Frauenbewegungen und verdeutlicht, dass die Revolution von 1848/49 nicht nur eine Männergeschichte war, sondern auch von mutigen Frauen wie Kathinka Zitz geprägt wurde.
Ihre Forderungen nach Freiheit, Gerechtigkeit und Partizipation sind bis heute aktuell. Frauenverbände, Menschenrechtsorganisationen und soziale Bewegungen setzen sich bis heute für die Werte ein, die Zitz bereits im 19. Jahrhundert vertrat. Historische Vorbilder wie sie erinnern uns daran, dass Demokratie ein fortlaufender Prozess ist, der kontinuierliches Engagement erfordert. In Zeiten politischer Unsicherheit oder des Erstarkens populistischer Bewegungen kann der Blick in die Vergangenheit helfen, neue Perspektiven zu gewinnen und demokratische Strukturen zu stärken.
Zu allen Zeiten, in welchen der Sturm der Weltereignisse über die Völker dahin braute, haben große Ereignisse auch große Entschlüsse hervorgerufen, und die Frauen haben noch nie gefeiert, wenn es galt, dem Vaterlande die Schuld abzutragen, zu der wir ihm Alle verpflichtet sind. Es dürfte geeignet sein, aus der Geschichte einige Beispiele hervor zu heben und einige der hervorragenden weiblichen Persönlichkeiten zu bezeichnen, deren Namen mit ehrnem Griffel in das Buch der Weltgeschichte eingegraben sind. Die israelitischen Annalen schildern uns Delila, Jael, Deborah, Judith und die Mutter der Makkabäer als Volksfreundinnen, die Alles für ihr Vaterland wagten. Unter den Spartanerinnern und Lacedämonierinnen zeichneten sich besonders aus: Koïne, die, indem sie ihren Sohn bewaffnete und umgürtete, zu demselben sprach: „Kehre mit dem Schilde, oder auf dem Schilde zurück“ – das heißt: kehre als Sieger aus der Schlacht, oder werde tot auf dem Schulde heimgetragen. – Phane, die da sagte: Was das Vaterland fordert, ist zu leisten Pflicht; es ist süß für es zu leben, doch süßer noch für es zu sterben. – Cassandra, die heilige Seherin, die die Frauen, welche ihr Leben nicht dem Wohl des Vaterlandes weihten, gemeine Sklavinnen nannte. – Hibridia, die den Spartanern zurief: Seid stolz auf Frauen, deren Seelen voll sind von Vaterlandsliebe und die stündlich bereit sind für seine Wohlfahrt zu sterben. Andere spartanische Frauen schnitten, als es einst im Kriege an Schiffsseilen fehlte, ihre langen Haare ab, um Taue daraus zu flechten. – Die römische Geschichte nennt uns Cornelia, die Mutter der Gracchen, die ihre in der Liebe zum Vaterland erzogenen Söhne ihren schönsten Schmuck nannte. – Dann Clelia, die nebst andern Römerinnen, von dem König Porsenna als Geisel mit fortgenommen, sich und ihre Gefährtinnen befreite, und mit ihnen auf geraubten Pferden über den Tiber in ihre Vaterstadt zurückfloh. – Simons Tochter, Hasilia, die ihren zum Hungertode verurteilten Vater täglich im Gefängnis besuchte, und ihn mit der Milch ihrer Brüste erhielt. – Arria, die Gattin des Pätus, die sich vor ihren ungerechten Richtern den Dolch in die Brust senkte und ihn dann dem Gatten mit den Worten reichte: „Nimm, es schmerzet nicht.“ – Epponine, die mit dem geflüchteten, zum Tode verurteilten Gatten, neun Jahre lang im Schoße der Erde verborgen lebte. – Das Mittelalter zeigt uns in Frankreich das einfache Hirtenkind Johanna d’Arc, die ihr Vaterland aus der Gewalt der eingedrungenen Engländer rettete, dem Schwächling Carl VII. die wankende Krone wieder auf das Haupt befestigte, der zum Danke dafür: (Könige sind ja so dankbar!) es ruhig geschehen ließ, dass die religiöse Absurdität sie als Hexe verbrannte – und in Deutschland sehen wir die Weiber von Weinsberg, die, als sie von den Belagerern freien Abzug erhielten, mit der Erlaubnis, soviel von ihren Kostbarkeiten mitnehmen zu dürfen, als eine Jede würde tragen können, Alles zurück ließen, um ihre Männer auf dem Rücken fortzuschleppen. In der ersten französischen Revolution tauchten viele edle weibliche Gestalten auf; z.B. die Weiber von Laval, die mutig die Festung der Stadt verteidigten und behaupteten. Charlotte Corday, das hochherzige Heldenmädchen, das dem Vaterlande sein schönes, jugendliches Leben weihte, um die Schmach des entwürdigten Vaterlandes zu rächen, indem es dem elenden Marat, dem Windischgrätz seiner Zeit, das Messer tief in das entmenschte Herz senkte. – Emilie von Sombreuil, die, um das Leben ihres greisen Vaters zu retten, aus der Hand der ein Glas voll Menschenblut annahm und es ohne Zagen austrank. – Iphigenie Dessile, die sich, um den Kindern ihre Mutter zu erhalten, an der Stelle ihrer verheirateten, zum Tode verurteilten Schwester guillotinieren ließ. – Viele Frauen, nicht zu vergessen, opferten ihren Schmuck auf dem Altare des Vaterlandes, und ein junges Mädchen verkaufte sogar sein schönes reiches Haar an einen Perückenmacher […]. Weiterlesen
Wir haben uns hier versammelt, um nach dem Beispiele unserer Mannheimer Schwestern, welche die Vereine „Concordia“ und „Germania“ ins Leben riefen, einen Unterstützungsverein zu gründen, der „Humania“ heißen mag, und dessen Zweck der sein soll, Patrioten oder deren Familien, die für die gerechte Sache des deutschen Vaterlandes kämpfen oder von den Drängern verfolgt werden, nach Kräften mit kleinen Gaben zu unterstützen. Die Regeln des Vereins, die wir nachher verlesen werden, sind der Art, dass sich alle Stände, dass sich Arme und Reiche daran beteiligen können. Das Scherflein der Witwe, der Beitrag der verlassenen Waise, die kleine Opferspende der armen Dienstbotin sollen als Liebesgabe willkommen sein. Niemand, der ein Herz für die gute Sache hat, ist ausgeschlossen. Wir kennen keinen Standes- keinen Glaubensunterschied, wir kennen nur die Liebe zum Vaterland. Wir wollen nur einen schönen schwesterlichen Bund der Menschenliebe, der Einigkeit begründen. O, lasst uns einig sein; denn nur die Einigkeit macht stark. Das einzelne Reis vermag die Hand eines jährigen Kindes zu knicken, aber ein Reisigbündel bricht selbst der stärkste Mann nicht entzwei.
Indem wir zusammentreten, muss es mit einem, aufrichtigem Herzen geschehen. Alle Sonderbündelei, alle Parteisucht, aller Vorrang, Ehrgeiz, jede Nebenabsicht muss verbannt bleiben. Wir müssen aufhören, Frauenzimmer zu sein und gänzlich Bürgerinnen und Vaterlandsfreundinnen werden. […]
Darum soll unser Verein auch nicht nur ein Unterstützungsverein sein, sondern wir machen uns auch verbindlich, wenn es not tun sollte, unsere kranken und verwundeten Brüder zu pflegen […]. Kaufen wir uns im Jahr ein Kleid oder einen Hut weniger, und wir werden viel tun können. Wir werden manchen Hunger stillen, manche Blöße zu decken, manche Träne zu trocknen vermögen.
Wer den Zweck dieses patriotischen Vereins recht begriffen hat, der wird es sich zur Ehrensache machen, ihm seine ganze Tätigkeit zuzuwenden, ja im Kreise seiner Bekannten um weitere Unterschriften zu werben, damit er die möglichst weite Verbreitung erhalte. Erhalten wir auch keinen Zufluss aus der sogenannten Hautevolée, so hoffen wir, dass sich der Sinn der Bürgerinnen um so mehr daran beteiligen wird […] Siegt die Volkssache, kehrt dereinst die Ruhe wieder und werden Siegesfeste gefeiert, dann werden wir es vielleicht erleben, dass die Dämchen, welche jetzt die Hände müßig in den Schoß legen und sich stolz von den Volksfreundinnen abwenden, auf einmal in feurige Patriotinnen verwandelt, sich in den Vordergrund drängen […] Wir aber werden das lohnende Bewusstsein haben, nützlich für die Menschheit gewirkt zu haben […]
Bevor wir die Einzeichnung in die Liste beginnen, möchte ich, nachdem wir uns über die Hauptsache geeinigt haben, der Versammlung noch einen weiteren Vorschlag tun, nämlich den, auch zur Anschaffung von Waffen beizutragen. Haben vielleicht auch manche von uns kein uns zu Gebote stehendes Geld, um irgendein Waffenstück anzukaufen, so haben wir doch alle Schmucksachen, die sich in Geld verwandeln lassen. Stellen wir diese dem demokratischen Verein zur Verfügung mit dem Ersuchen, sie zu verwerten, für den Betrag Waffenstücke anzukaufen und auf diesen den Namen der Geberin gravieren zu lassen. Eine solche Waffe wird für den Streiter, der sie empfängt, zur Ehrenwaffe werden, zu einer heiligen Oriflamme, denn wer würde der Feige sein, der eine ihm von Frauenhand zum Schutze des Vaterlandes übergebene Waffe anders als mit seinem Leben fahren ließe […] Wir aber wollen uns später Schmuck aus den den Unterdrückern abgenommenen Geschützen gießen lassen, und dieser wird uns eine edlere Zier sein als die Pracht der reichsten Diamanten. Das wenige, was ich an Schmuck besitze, lege ich […] hiermit auf den Altar des Vaterlandes nieder. Es wird immerhin zur Anschaffung einiger Gewehre hinreichen. Möchten recht viele mir nachfolgen. Unser Beispiel wird nicht verloren gehen, es wird in ganz Deutschland Nachahmung finden.
[Nachsatz im Artikel]: Als die Rednerin ihren Vortrag beendet hatte, war der Zudrang zur Einzeichnung so groß, dass die Wahl des Ausschusses nicht mehr vorgenommen werden konnte, und noch mehr Einzeichnungen sind auf die nächsten Tage versprochen.
Der Geist der Vaterlandsliebe regt sich in unserer vielbewegten Zeit auch mächtig in den Herzen der Frauen, die das Ziel und die Bedeutung der wahren Demokratie begriffen haben. Überall bilden sich Vereine zur Unterstützung der politisch Verfolgten, zur Pflege und Versorgung der verwundeten Brüder zur Anschaffung von Waffen für die kampfesmutige Jugend, die bereit ist, voll kühner Todesverachtung in den Kampf für unsere heiligsten Rechte zu ziehen. Das weibliche Geschlecht hat es teils schon begriffen und wird es teils noch begreifen, dass sein Beruf in dieser großen Zeit ein ernsterer ist, als der des untätigen Besuchens demokratischer Vereine und Volksversammlungen oder der Beteiligung an einer zu stickenden Fahne. Ohne aus den Schranken der Weiblichkeit herauszutreten, können die Frauen durch ihr Wirken dem Vaterlande von bedeutendem Nutzen werden durch tatkräftiges Wirken und Walten. Unsere Mannheimer Schwestern sind uns mit einem schönen Beispiel vorangegangen, werden die Mainzerinnen zurückstehen wollen? Lasst uns wirken und zusammenhalten in einem Bund der Liebe und des Rechtes, lasst uns durch Willen und Tat bewähren, dass wir des Namens deutscher Frauen würdig sind und dass wir da, wo es einem großen Zweck des gemeinsamen Vaterlandes gilt, auch fähig sind, dem Vaterlande Opfer zu bringen. […]
Geehrteste Bürgerinnen! Sie sind hier zusammengekommen auf die Einladung einiger Frauen und Jungfrauen, um wie die Frauen in Mainz und anderen Städten unseres immer noch in Druck und Not sich befindlichen Vaterlands einen Verein zu gründen „zur Unterstützung vaterländischer Interessen“. Ich werde nicht nötig haben, Ihnen, meine Mitschwestern, die Gründe anzugeben, welche uns alle zu diesem Entschlusse brachten, doch mag ein Grund angegeben werden, und dieser ist: Wenn unsere Männer, Brüder und Freunde hinausziehen für die heilige Sache Deutschlands, um die so sehnlichst erwartete Freiheit mit den Waffen in der Hand uns zu erringen, wir zuhause auch nicht die Hände tatlos in den Schoß legen wollen, sondern alle für die Freiheit Kämpfenden nach allen unseren Kräften zu unterstützen. Die Art und Weise der Unterstützung wird Ihnen durch die Statuten näher bezeichnet werden.
So vielerlei die vaterländischen Interessen sind, so vielerlei soll auch unsere Hilfe sein. Eine Jede von uns arbeite deshalb nach Vermögen an diesem heiligen Werke im Gedanken an das hohe zu erstrebende Ziel. […]
Jetzt aber, Ihr Frauen und Jungfrauen, jetzt muss ich mich an Eure Herzen mit der Bitte wenden: Bietet alles auf in dem schönen Zweck, unseren Verein nach Kräften zu unterstützen. Wir brauchen Geld, viel Geld, Wir brauchen Hemden und Kleidungsstücke. Es ist uns zwar diese Woche ein anonymer Brief mit der Bitte zugekommen, da jetzt viele Männer zurückgekehrt und keine bedeutenden Unterstützungen mehr nötig seien, die wöchentlichen Beiträge für die Dauer des Monats gelten zu lassen. Diese Anmutung konnte natürlich nur aus der Unkunde der Verhältnisse hervorgehen; denn nicht nur die Frauen, sondern hauptsächlich die Versprengten, die aus Patriotismus jetzt heimatlos gewordenen Männer, müssen die Mittel zu ihrem Fortkommen erhalten. Wir unterstützen in ihnen keine Aufrührer, sondern Vaterlandsfreunde, die für eine gesetzmäßige Sache kämpfen. Die Nationalversammlung war von allen Fürsten Deutschlands anerkannt. Aus ihrer Mitte ging die Reichsverfassung hervor, die sie mit allen Mitteln, selbst mit der Gewalt der Waffen, aufrecht zu erhalten gebot. Unsere Brüder kämpften für diese Reichsverfassung. Folglich waren und sind sie noch auf dem gesetzlichen Wege, und es ist daher unsere heilige Pflicht, sie zu unterstützen.
Unser Verein verfolgt keine politischen Tendenzen. Wir fordern nicht zum Aufruhr, zum Blutvergießen auf. Wir predigen keinen Fürstenhass, noch haben wir je die Guillotine herbeigewünscht. Jede Unweiblichkeit, jede exzentrische Ansicht war uns stets fern und wird uns stets fern bleiben. Unser Streben ist ein so ehrenhaftes, dass es sich überall Anerkennung verschaffen wird; denn unser Verein geht von dem rein menschlichen Gesichtspunkt aus. Er hat sich stets und wird sich stets auf dem gesetzlichen Boden bewegen. Es kann uns daher kein Gericht und keine Macht der Welt das Geringste zur Last legen, wenn wir mit mildtätigem Sinn die Männer unterstützen, die unglücklich geworden sind. Und so, meine Schwestern, fordere ich Euch denn auf, nicht zu ermatten und zu erlahmen, sondern festzuhalten an unserer Humania, an unserem Streben für das rein Menschliche.
Und Ihr, deren Verhältnisse es erlauben, tretet heran. Wir haben hier eine Liste aufgelegt zu Extrabeiträgen, die im Laufe dieser Woche von den Mitgliedern des Vereins selbst in Empfang genommen werden sollen. Bedenkt, welch einen Berg von Sorgen Ihr von der Brust mancher hilflosen Mutter, mancher verzweifelnden Gattin nehmen werdet, wenn sie weiß, meinem Sohn, meinem Mann werden die Mittel gegeben, nicht ganz hilflos über die Grenze zu kommen. Und welcher Trost wird es wieder für den Sohn, wenn er sich sagen kann: „Meine alte Mutter, meine arme Frau und meine unschuldigen Kinder sind wenigstens vor dem Hungertode geschützt. Euch, Ihr Bemittelten, ist es eine Kleinigkeit, eine Opferfreude auf dem Altar der Dürftigkeit niederzulegen, und Eure Gaben, Ihr Ärmeren, werden dereinst schwer wiegen in der Waagschale der Vergeltung. Es ist meine Absicht, mich demnächst wieder auf den Weg zu machen, um den versprengten Flüchtlingen die Gaben der Frauenwelt selbst zu überbringen und ihnen dadurch den Beweis zu geben, wie sehr wir Frauen insgesamt ihre Hingebung an das Vaterland zu würdigen wissen. […]
Ich hatte mir die Aufgabe gestellt, die Gefangenen aufzusuchen, welche in dem Kampfe bei Kirchheimbolanden von den Preußen gemacht worden waren, um mich zu überzeugen, wer von ihnen noch am Leben oder zu den Toten zu zählen sei, die durch fürchterliche Wunden entstellt, nicht hatten erkannt werden können. Vorzüglich war mein Augenmerk auf das Auffinden des jungen R.¹ gerichtet, von dem man wissen wollte, dass er sich unter den Gefangenen befände. Mit dessen Schwester und noch einer Reisegefährtin trat ich wohlgemut meine Reise an und erfuhr in Neustadt an der Haardt, dass die Gefangenen an Bayern abgeliefert und in die Festung Landau gebracht worden seien. […] In Edenkoben trafen wir mit dem eben aus Landau kommenden Postwagen zusammen und erkundigten uns, ob man ungehindert in die Festung gelangen könne. Nachdem dieses bejaht worden war, eilten wir nach Landau, fanden aber die Tore geschlossen und wenigstens 200 Personen vor denselben, welche vergebens auf Einlass harrten. Ich stieg aus und verlangte, den wachhabenden Offizier zu sprechen, welcher mit sagte, dass die Festung seit zwei Stunden wieder geschlossen worden, weil der nach Edenkoben gehende Postwagen von Freischaren angefallen und ausgeplündert worden sei. Ich bemerkte ihm, dass dieses nur auf einem Irrtum oder einer Verleumdung beruhen könne, da wir in Edenkoben mit dem Postwagen zusammengetroffen, mit den Passagieren gesprochen und auch nicht einer eines solchen Vorfalles erwähnt habe. Hierauf ersuchte ich ihn (ich reiste, da mein Name als Gattin eines Aufrührers mich nicht empfehlen konnte, unter dem Namen einer Frau Hetz), unsere Papiere an den Kommandanten zu schicken mit der Meldung, dass drei Damen da seien, welche ihn in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen wünschten. […] Weiterlesen
Der Kommandant, General Jeetze, nahm uns sehr artig auf, und nachdem er uns in sein Empfangszimmer geleitet, sagte er lachen:
„Ich muss bekennen, meine Damen, dass Sie sehr viel Mut besitzen, dass Sie sich in dieser unruhigen Zeit in eine Festung wagen.“
„General“, erwiderte ich, „wir sind in einer Festung² geboren und erzogen. Wir fürchten den Anblick des Geschützes nicht, und zudem ist unsere Festung viel größer als die Ihrige.“
Nachdem ich ihm den Wunsch vorgetragen hatte, zu erfahren, ob sich der junge R. unter der Zahl der Gefangenen befände, bejahte er dieses mit der freundlichsten Bereitwilligung, indem er hinzusetzte:
„Ich kann Ihnen die Versicherung geben, dass der junge Mann gesund und wohl ist und so gut behandelt wird, als es die Umstände irgend zulassen.“
Ich stellte ihm hierauf R.s Schwester vor mit der Frage, ob es ihr erlaubt sei, ihren Bruder zu sehen. Dieses versicherte der General jedoch nicht gestatten zu dürfen, da die Leute in den Kasematten seien, in welche niemand eingelassen werden dürfe. „Es wäre ein anderes“, setzte er hinzu, „wenn er krank oder verwundert im Spital läge, dann würde ich Ihnen augenblicklich die Erlaubnis erteilen, zu ihm zu gehen, so aber kann es nicht sein.“
„General“, sprach ich darauf bittend, „seien Sie einmal recht gut, und lassen Sie den jungen Mann auf eine halbe Stunde krank werden. Nachher können Sie ihn ja wieder in den Kasematten brummen lassen.“
Der General lachte herzlich, meinte aber doch, dass das nicht anginge.
Es wäre um so unbescheidener gewesen, weiter in ihn zu dringen, da er sich selbst sehr zuvorkommend erwies, indem er uns erlaubte, die Gefangenen mit Wäsche und Kleidungsstücken, sogar mit Zigarren, jedoch nicht mit Geld zu versehen, da dieses gegen die Vorschrift sei.
„Werden Sie denn die Güte haben, dem jungen Mann sagen zu lassen, dass seine Schwester hier war, dass seine um ihn besorgten Landsleute ihn nicht vergessen haben?“
„Nein, das werde ich nicht“, sagte er. Dann setzte er mit dem Ausdruck großer Gemütlichkeit hinzu: „aber ich werde heut noch selbst zu ihm gehen und ihm alles mitteilen.“ […]
1 Joseph Agnon Regnier
2 Mainz
Ich saß noch bei Tische, als ein Gendarm mit einem unanständigen Fetzen Papier in der Hand vor mir erschien, worauf der Name Kathinka Zitz in unleserlicher Schrift geschrieben stand.
Er fragte, ob ich so hieße, und als ich bejahte, forderte er mich auf, auf der königlich-preußischen Kommandantur zu erscheinen. Ich verfügte mich an den bezeichneten Ort, wo ich etwa sechs Offiziere fand. Ein beschnurrbarteter Leutnant, der, wie ich später erfuhr, von Schweinitz hieß und Adjutant des Obersten von Brandenstein war, übernahm das Amt des Inquisitors und fragte mich schnaubend: „Sind Sie die Frau des berüchtigten Zitz?“ Ich erwiderte, dass Ich die Frau des Dr. Zitz in Mainz sei, protestierte aber gegen das beleidigende Beiwort und werde stets gegen jede Herabsetzung protestieren, solange die ihm zur Last gelegten Anschuldigungen nicht erwiesen sind und dieses sind sie in keinerlei Hinsicht [...] Nachdem er Zitz noch als einen wahren Popanz und Heidengreuel hingestellt hatte, sagte er: „Glauben Sie etwa, Madame, wir wüssten nicht, dass Sie eine Volksversammlung in der Fruchthalle präsidiert und den Freischaren mehr als 10000 Pfund Charpie¹ geschickt haben?“ Da hatte der gute Mann eine Glocke läuten hören, ohne zu wissen wo; denn ich habe nie eine Volksversammlung in der Fruchthalle präsidiert. Ich bedeutete ihm, dass ich allerdings einen wohltätigen Frauenverein gegründet hätte, welcher 1700 Mitglieder zähle, dass aber das Wirken des Vereins derart sei, dass ihm selbst der absoluteste Monarch seine Achtung nicht versagen könne. Wir haben keine Kämpfer geworben und hinausgeschickt. Wir haben aber zurückgelassene Frauen unterstützt. Charpie hat das rheinhessische Korps nur solange von uns erhalten, als es in der Pfalz stand […] Weiterlesen
Da es die Pflicht der Vereinsmitglieder ist, sich auch nach den Gefangenen zu erkundigen, so fragte ich den Leutnant nach einem jungen Manne aus Mombach, von dem ich gehört hatte, dass er in Karlsruhe gefangen säße, und ersuchte ihn, mir, sofern es nicht gegen die Vorschrift sei, Auskunft zu geben, ob sich auch Mainzer unter den Inhaftierten befänden. Aber der Leutnant, von dem ich mir ein Ja oder Nein und höchstens einige Namen in Anspruch nahm, schien zu glauben, dass ich die Absicht habe, meine Truppen gegen das Gefängnis marschieren zu lassen und die Kostgänger des Profossen gewaltsam zu befreien. „Madame“, rief er zornsprudelnd, „wir haben nichts mehr mit Ihnen zu reden. Sie können gehen.“ Ich machte eine höfliche Verbeugung und empfahl mich nach allen Regeln der guten Lebensart. Mein Gruß wurde nicht erwidert, und ich konnte noch sehen, wie der Leutnant samt einem älteren Offizier in rasender Hast die Treppe hinaufstürzte, um dem Kommandanten, Obersten von Brandenstein, Bericht über die Verbrechen zu erstatten.
Eine halbe Stunde später ließ sich der Polizeikommissar bei mir melden und ersuchte mich, mit der größten Artigkeit und unter tausend Entschuldigungen wegen seiner peinlichen Amtspflicht, am folgenden Morgen auf dem Polizeibüro zu erscheinen, indem die preußische Kommandantur meine Ausweisung verlangt habe. [...] Ich wurde am folgenden Morgen mit gleicher Artigkeit von dem Polizeidirektor empfangen, welcher mir das Schreiben des Kommandanten vorlegte, worin dieser auf meine Ausweisung antrug. Es lautet: „Eine Person, die sich Kathinka Zitz nennt und im weißen Bären logiert, ist augenblicklich auszuweisen.“ […] Auf dem Weg nach meinem Gasthause traf ich einen Polizeidiener, der mir andeutete, dass er Befehl habe, meine Abreise zu überwachen. In mein Zimmer gekommen, waren meine aus einem unverschlossenen Nachtsack und einem Regenschirm bestehenden Effekten fort. Ich ging in den Gastsaal, wo ich sie bei dem Wirt in Gegenwart eines untergeordneten Werkzeugs der Gewalt reklamierte. Er gab vor, sie bereits herunter haben bringen zu lassen. Sie waren während meiner Abwesenheit durchsucht worden und siehe, die bei mir gefundenen hochverräterischen Papiere bestanden aus alten Zeitungen, in welche meine Toilettgegenstände eingewickelt waren und meine Waffen aus einer in meiner Reisenecessaire enthaltenen Schere! […] Das Komische bei der Sache ist, dass ich ohne diese Ausweisung die königlich-preußische Kommandanturstadt drei Stunden früher verlassen haben würde als es der Formalitäten dieser Ausweisung wegen geschehen konnte.
1 Wundverbandmaterial
Er [Rumpelstilzchen] begann in den auf meinem Nachttische liegenden Büchern und Journalen zu blättern. Das Erste, was ihm in die Hand fiel, waren Hoffmanns von Fallersleben unpolitische Lieder und die rheinische Zeitung. „Ei“, sagte er in Absicht, dem Gespräche eine andere Wendung zu geben: „Ei, sieh da, du nimmst auch Anteil an der Politik“ […] „Ich bin ein Kind des Jahrhunderts, Zweifel und Trostlosigkeit begleiten mich. Der Instinkt zu aller großen Dinge liegt in mir, aber ich bin kein Titane; ich denke nicht daran den Himmel zu stürmen, ich beschränke mich darauf ihn anzuklagen, weil er mich nicht zum Manne werden ließ. […] Die Freiheit ist die Gottheit, die ich in stiller Ehrfurcht verehre und anbete; hätte ich aber das Glück ein Mann zu sein, so müsste sie meine Geliebte werden, der ich Blut und Leben, Zeit und Gut zum Opfer brächte; die edelsten Kräfte meiner Seele, würde ich an das Glück und die Verherrlichung meines Vaterlandes setzen. O! Mein schönes Vaterland, welches nicht nur das in meiner dermaligen Verzauberung von mir bewohnte kleine Fürstentum, sondern das gesamte Deutschland ist, wann werden deine Wunden einmal aufhören zu bluten? Wann werden deine so oft getäuschten Hoffnungen erfüllt, wann deine Männer ihrer Kraft bewusst werden, und eine große Idee der Einigkeit durch alle deine Gauen herrschen!“ „Ei“, rief Rumpelstilzchen mit einem billigenden Beifallslächeln, das seinen ironischen Worten offenbar widersprach: „Ei, das sind ja sonderbare Gesinnungen für eine feudalistische Prinzessin, die noch aus den Zeiten der Leibeigenschaft herstammt?“
Es sprach ein Fürst von Glut entbrannt:
Kein Österreich, kein Preußen,
ein einzig, freies, deutsches Land,
so soll es künftig heißen.
Das fest wie seine Berge steht,
wenn es des Krieges Sturm umweht.
O! Deutsches Volk, hab‘ Einigkeit,
dann stehst du hoch vor Allen –
Zum Kampf gerüstet, siegbereit,
kannst du dann nicht mehr fallen;
hast in den Adern Löwenmark,
und bist durch eigne Kräfte stark.
[…]
Wir haben Männer die voll Mut,
für’s Recht den Tod nicht scheuen,
und die sich mit Begeisterungsglut
den Zeitintressen weihen. […]
Ein Hoch den Männern, die so kühn
Des Volkes Recht vertreten,
ihr Ruhmeskranz wird ewig blüh’n;
[…]
Ein Hoch auch jener Dichterschar,
die den Impuls gegeben;
vor ihren Blicken stand es klar:
Jetzt gilt es: Weiterstreben!
Hör‘ Deutschland, auf den Geist der Zeit.
Und sei jetzt stark in Einigkeit.
1 Das Gedicht zeigt, für wie wichtig Kathinka Halein den Einfluss von Dichtern und politischer Literatur im politischen Kampf hielt
In einem schön geschmückten Zimmer
Stand eine Vase von Porzlan,
sehr reich verziert mit Goldesflimmer,
ein jeder sah sie staunend an.
Gleich neben in der Küche stand,
ein Topf, von schlechtem Ton gebrannt,
der rußig, aber nützlich war,
er diente Tag für Tag im Jahr,
und ward der Suppentopf genannt.
Einst standen offen alle Türen,
der schwarze Topf tat ein Gelüst‘
in seinem Inneren verspüren,
die Vase auf dem Prunkgerüst‘,
die da stand auf vier goldnen Füßen,
einmal recht brüderlich zu grüßen.
Er neigte freundlich sich vor ihr. –
O Topf, das war sehr frech von dir,
denn du in deinem schwarzen Kleide
du warst ihr keine Augenweide. –
Die Vase blieb ganz stocksteif steh’n
Und tat als hätt‘ sie nicht geseh’n,
dass einer der gemeinen, niedern
gebrannten Töpfe sie gegrüßt
auf ihrem hohen Prunkgerüst.
Auch kam es ihr nicht in den Sinn,
den Gruß des Topfes zu erwiedern.
Am Abend brach nun in dem Haus
Ganz unvermutet Feuer aus.
Einer jeder suchte, was er rette,
und brachte von der Unglücksstätte
mach groß und kleinen Gegenstand
in Sicherheit mit flinker Hand.
Es gab ein großes Durcheinander,
und Topf und Vase kam selbander
in einem Korb zugleich gerafft,
und zu dem Nachbar hingeschafft,
urplötzlich Seit‘ an Seit‘ zu steh’n –
hier galt kein Voneinanderdreh’n.
Es war ein Glück, dass ohne Sprung
Sie beide aus der Not gekommen,
und dass des Nachbars Kammer sie
in ihren Raum hat aufgenommen.
Die Goldne nahm es sich zu Herzen,
dass sie nicht mehr im Prunkgemacht
sich brüsten konnt‘, und manches Ach!
stieß sie jetzt aus mit bittern Schmerzen.
Dann wandt‘ sie an den Schwarzen sich
Mit gar trübseligen Geberden,
und sprach: „Ach lieber Bruder, sprich!
Was soll nun aus uns beiden werden?“
So geht es gar zu oft im Leben,
drum merkt euch, ob ihr arm, ob reich:
Das Unglück nähret alle Menschen,
und machet alle Stände gleich.
Im März dieses Jahres da ist über Nacht
Ein herrliches Veilchen zum Leben erwacht,
Verbreitet den Balsam all' Enden und Orten,
Ganz Deutschland das ist bald berauscht davon worden.
Das Veilchen heißt Freiheit, die lang unterdrückt,
Sich schüchtern ins Gras unter Blätter gebückt,
Die oft von gewaltigen Füßen getreten,
Nicht wagte zu handeln, nicht wagte zu reden.
Weiterlesen
Doch als nun die Blume die Knospe gesprengt,
Als sie sich voll Leben zur Sonne gedrängt,
Wie sind da die Düfte im Länderdurchwallen,
Den fürstlichen Herrn auf die Nerven gefallen.
Wie sprachen sie freundlich zum Volk: »Hab' Geduld,
Wir zahlen dir nächstens die säumige Schuld.
Wir wollen dich huldvoll mit Rechten begaben,
Und was du verlangst, das sollst du auch haben.«
Schon reckt die Gewalt wieder kecklich das Ohr,
Wir tragen die Lasten noch jetzt wie zuvor,
Und was wir als Vorspiel einstweilen bekommen,
Das hat man in Baden zurück schon genommen.
Dort nahm man dem Volke die Waffen gleich ab,
Die man ihm als Spielwerk zu Händen erst gab;
Dort sitzen die Männer gefangen in Zellen,
Die's wagten den Wortpfeil vom Bogen zu schnellen.
Kaum sind seit dem Umsturz zwei Monden vorbei,
Schon kränkelt das Veilchen, wir haben erst Mai.
Wie ist's zu erhalten in künftigen Tagen?
Es kann wohl die fürstliche Sonn' nicht vertragen.
Wir haben die günstige Stunde versäumt,
Drum heißt's nun: Sie haben von Freiheit geträumt.
Wir schicken die Unseren zum Parlamente,
Die machen dem Treiben ein baldiges Ende.«
Hab Acht, o mein Volk, sei beständig auf Hut;
Laß ein dir nicht schüchtern den männlichen Muth.
Soll's Veilchen dir fröhlich und frisch wieder sprießen,
So mußt du es mit deinem Herzblut begießen.
1 Das Gedicht ist eine Reaktion von Kathinka Zitz-Halein auf blutige Kämpfe zwischen Bürgerwehr und preußischen Soldaten im Mai 1848.
Vorwärts! rufen die Lichtbekenner,
Lasst uns Fackeln der Wahrheit sein.
Rückwärts! heulen die Dunkelmänner,
Meidet jeglichen hellen Schein.
Vorwärts gehe stets unser Streben,
Tatendrang ist in uns erwacht.
Rückwärts sichert uns Gut und Leben,
Haltet fest an der alten Nacht.
[…]
Vorwärts! die Geschichte beweist es,
Freiheit sei das edelste Los.
Rückwärts! nähret den Bauch statt des Geistes,
Und ihr ziehet euch Sklaven groß.
Vorwärts! aber belügen und trügen
Sollen unsere Lippen nie.
Rückwärts! wir werden dennoch siegen,
Es gibt noch gar viel Menschenvieh.
Wenn ich ein König wäre, säh′ ich des Volkes Schmerzen,
Und tiefe Trauer trüg′ ich alsdann in meinem Herzen,
Ich wäre nicht erblindet für seine große Not,
Nicht taub für seine Klagen, wenn ihm Verderben droht.
Ich säh′ die Einen schwelgen in ihren Prunkgemächern,
Sie edle Weine schlürfen aus Gold- und Silberbechern,
In Duhnenbetten ruhen, mit Seide zugedeckt,
Bis sie die hohe Sonne aus süßem Schlummer weckt.
Weiterlesen
In säh′, wie sie den Lüsten, den eitlen, Opfer zollen.
Von Rossen stolz gezogen, vom Fest zur Oper rollen,
Wie sie dann sorglos schlafen in sichrer Gegenwart,
Vertrauend auf die Zukunft, die ihrer Tage harrt.
Doch säh′ ich auch die Andern in ungesunden Räumen,
Die fort und fort beschäftigt, die nimmer müßig säumen,
Die unterm Dache wohnend, gebettet sind auf Stroh,
Von Lumpen kaum bedecket, die nie des Lebens froh,
Durch Fleiß und saure Mühe nicht so viel sich erwerben,
Zu sättigen die Kinder, die fast vor Hunger sterben,
Zu wärmen nur die Kleinen, die′s friert bei Nacht und Tag,
Und die doch leben müssen, weil sie der Tod nicht mag.
Ihr Leben voll Entbehrung, voll Kummer und voll Sorgen,
Bekrönt als Schmerzensstachel, die Furcht vorm andern Morgen,
Da sie nicht wissen können, ob er das dürft′ge Brot
Den Armen wird bescheren, ob größer wird die Not.
Und säh′ ich so die Reichen, und säh′ ich so die Armen,
So würd′ ich mich der Letztern mit mildem Sinn erbarmen;
Mit jenen die da leiden, mit jenen litt auch ich,
Ihr Schicksal zu verbessern, das nähm′ ich stolz auf mich.
So lang in meinem Reiche noch Bettler vor sich fänden,
So lange noch Arbeiter mit starken fleiß′gen Händen,
Vergebens an Werkstätten um Arbeit klopfen an,
So lange würd′ ich glauben, ich hätte nichts getan.
Den lügenden Ministern, die sich oft dreist erfrechen,
Vom Wohlstand eines Landes mit feiler Zung′ zu sprechen,
Würd′ ich nicht Glauben schenken, so lang des Armen Schweiß,
Den Reichen Früchte bringet, von denen er nichts weiß.
[…]
Des Volkes laute Klagen, die Tränen, die da fallen,
Die würden mir im Herzen beständig widerhallen.
Ich könnte nimmer ruhen, bis ich den Grund erschaut,
Bis denen ich geholfen, die mir ihr Glück vertraut.
Und würd′ es mir gelingen da Wohlstand zu verbreiten,
Wo jetzt die Armut waltet, wo Noth und Elend streiten,
Hätt′ ich die Volksverblutung mit milder Hand gestillt,
Ja, dann erst würd′ ich glauben, sei meine Pflicht erfüllt.
Und wenn mich Der beriefe, der alle Spaltung schlichtet,
Der Könige und Bettler mit gleicher Strenge richtet,
Bät′ ich vor Gottes Throne in jenem Geisterland:
"O Herr! beschütz′ die Völker, die Vater mich genannt."
Einst noch in späten Zeiten wird die Geschichte melden
Von Kirchheim-Bolands Garten und von den dreißig Helden,
Die in ihm eingeschlossen, sich mit dem Feind gerauft,
Und dort im Freiheitskampfe die Erd' mit Blut getauft.
Um ihren Waffenbrüdern den Rückzug kühn zu decken,
Sind sie zurück geblieben, und kämpften ohne Schrecken
Voll Mut zum Tod entschlossen, mit Feinden allzumal,
Die ihnen überlegen wohl tausendfach an Zahl.
Weiterlesen
Sie hielten sich im Kampfe drei lange, lange Stunden,
Da fielen siebzehn Männer an den erhalt 'nen Wunden.
Fürwahr solch' tapf'res Ringen sah die Geschichte nie,
Sie stritten wie die Löwen, wie Helden fielen sie.
Dies war die blut'ge Taufe der deutschen Muttererde,
Damit der Reichsverfassung die volle Geltung werde.
Es war ein edles Ringen, ein heil 'ges Märtyrtum –
Es kamen die Blutzeugen für deutsche Freiheit um.
Für deutsche Freiheit! - wehe! – sie ward im Keim erstickt,
Doch ward sie nicht besieget, sie ward vom Feind erdrückt.
Der Sieg ward nicht errungen durch Muth und Tapferkeit,
Die Übermacht allein nur entschied den Bruderstreit.
Denn dort - es ist die Wahrheit - im kleinen Lande Baden,
Da kämpfen gegen einen - ihr wisst es - zehen Staaten.
'S ist keine Kunst zu siegen auf blutgetränktem Feld,
Da wo man gegen Einen zum Kampfe Fünfzig stellt.
Gar viele sind gefangen, gar viele, viele Braven,
Die tun den langen Schlummer im Schoß der Erde schlafen.
Sie hatten ihre Pflichten als Deutschlands Söhn' erkannt,
Und kann man schöner sterben, als für das Vaterland?
Doch ist darum die Freiheit, um die wir kühn geworben,
Das stolze Göttermädchen, mit ihnen nicht gestorben,
Sie liegt jetzt nur im Schlummer und in der Zeiten Lauf
Wacht sie einst neu gekräftet und schöner wieder auf.
Auch Christus ist gestorben, er lag in Grabesbanden,
Doch ist er nach drei Tagen zum Leben auferstanden.
D'rum laßt den Muth nicht sinken, erhebt die Blicke frei,
Die Sonne strahlet wieder, so oft die Nacht vorbei.
Und Ihr, Ihr Frauen und Mädchen, ihr kennet ja die Kunde
Von Frauenlob dem Sänger, sie geht von Mund zu Munde,
Der einst vor grauen Zeiten so süß und liebebang,
Den Wert der edlen Frauen in schönen Liedern sang.
Als er darauf gestorben, tut die Geschichte sagen,
Da haben ihn die Frauen zum Grabe hin getragen;
Sie warfen Blumenkränze, sie gossen edeln Wein
Ihm mit betränten Augen in seine Gruft hinein.
Und ihrer tut mit Liebe man heute noch gedenken,
Dem Wirken edler Frauen muss jeder Achtung schenken.
D'rum folget ihrem Beispiel – wer wirkt durch Tat und Wort,
Der lebt in der Geschichte durch alle Zeiten fort.
Nicht sollt Ihr einen Dichter in seinem Grabe kränzen
Nicht sollen eure Tränen für einen Sänger glänzen,
Nicht sollet auf den Schultern zur letzten ew'gen Ruh
Ihr eure Toten tragen – wer mutet euch das zu –
Doch die in Kirchheims Garten den Heldentod gestorben,
Die haben heil 'ge Rechte auf Euern Dank erworben,
Es wird ihr Angedenken, euch ewig teuer sein,
Setzt ihnen, Mainzer Frauen, d'rum einen Leichenstein.
Und auf dem Stein, dem kalten, da sei es groß zu lesen,
Wie tapfer und wie mutig die Siebzehn sind gewesen
Wie sie um zu erwerben der Freiheit hohes Gut
Ihr Leben aufgeopfert, verspritzt ihr heil 'ges Blut.
Dann wird in fernen Tagen, wenn wir einst nicht mehr leben,
Der Vater seinem Sohne von euch noch Kunde geben;
Das Denkmal das ihr setztet, sagt dann dem ganzen Land
Wie Mainzer Frau'n die Größe stets ehrend anerkannt.
1 Das Gedicht bezieht sich auf den gewaltsamen Tod von 17 Freischärlern durch preußische Truppen in Kirchheimbolanden. Den Erlös aus den Drucken des Gedichts spendet Kathinka Zitz-Halein zur Errichtung eines Gedenksteins für die Toten. Für die Einnahme von Spenden wirbt sie auch in den letzten drei Strophen des Gedichts.
Phantasieblüten und Tändeleien. Gedichte, Mainz 1826.
Sonderbare Geschichten aus den Feenländern. Eine unterhaltsame Lektüre für Alt und Jung. Erstes Bändchen, Nürnberg 1844.
Sonderbare Geschichten aus den Feenländern. Eine unterhaltende Lektüre für Alt und Jung. Zweites Bändchen, Nürnberg 1844.
Erzählungen und Novellen. Fremd und Eigen. Erstes Bändchen, Nürnberg 1845.
Erzählungen und Novellen. Fremd und Eigen. Zweites Bändchen, Nürnberg 1845.
Herbstrosen in Poesie und Prosa, Mainz 1850.
Variationen in humoristischen Märchenbildern, Mainz 1849.
Der alte Robinson Crusoe. Nach dem ersten englischen Original neu erzählt, Mainz ca. 1849.
Robinson Crusoe. Für die Jugend bearbeitet von Kathinka Zitz, Mainz 1849.
Donner und Blitz. Erzählung, Mainz 1850.
Süß und sauer, Mainz 1851.
Neue Rheinsandkörner. Ein Novellen-Zyklus, Mainz 1852.
Letzte Rheinsandkörner, Mainz 1854.
Erzählungen und Novellen, Mainz 1854.
Ernste und heitere Lebensbilder. Erzählungen, 3 Bände, Berlin 1854.
Die Najaden des Soolsprudels zu Nauheim nebst anderen Novellen und Erzählungen, Mainz 1854.
Kaiserin Josephine, Mainz 1855.
Neue Erzählungen, Mainz 1855.
Schillers Laura, nebst anderen Erzählungen und Novellen, Mainz 1855.
Welt-Pantheon. Eine Festgabe (Gedichte), Mainz 1856.
Beiträge zur Unterhaltungsliteratur, Mainz 1856.
Magdalene Horix oder Vor und während der Klubistenzeit. Ein Zeitbild, Mainz 1858.
Dur- und Molltöne. Neuere Gedichte, Mainz 1859.
Die Entdeckung und Eroberung von Amerika durch Columbus, Cortez und Pizzaro, Mainz ca. 1860.
Spiegelbilder in belehrenden und warnenden Beispielen, Mainz 1861.
Juwelenkästchen für Kinder, die gut und brav werden wollen, Mainz 1862.
Der Roman eines Dichterlebens, Leipzig 1863:
Der Roman eines Dichterlebens. 1. Abteilung: Goethes Jugendjahre (1759-1775), Leipzig 1863.
Der Roman eines Dichterlebens. 2. Abteilung: Goethes Männerjahre (1775-1806), Leipzig 1863.
Der Roman eines Dichterlebens. 3. Abteilung: Goethes Greisenalter (1807-1832), Leipzig 1863.
Heinrich Heine, der Liederdichter. Ein romantisches Lebensbild, Leipzig 1864.
Abteilung: Herbstschauer und Winterkälte
Rahel oder dreiunddreißig Jahre aus einem edlen Frauenleben, Roman, 6 Bände, Leipzig 1864.
Lord Byron. Romantische Skizzen aus einem vielbewegten Leben, 5 Bände, Mannheim 1866.
Bock, Oliver: Kathinka Zitz-Halein. Leben und Werk, Hamburg 2010.
Brüchert, Hedwig: Kathinka Zitz-Halein, 2021, https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/biographien/zitz-halein-kathinka.html.
Erbar, Ralph: Kathinka Zitz-Halein (1801-1877). Ein Leben voller Enttäuschen, in: Frauen in Rheinhessen – 1816 bis heute, hg. von Susanne Kern / Petra Plättner, Mainz 2015, S. 31-36.
Grimminger, Birgit: Kathinka Zitz und Johanna Kinkel. Solidarität und Freundschaft im Spannungsfeld der 48er Revolution, Mainz 2018.
Hübel, Marlene: Erfolgreich, aber vergessen: Adelheid von Stolterfoth und Kathinka Zitz, in: Romantik, Reisen, Realitäten. Frauenleben am Rhein, hg. von Bettina Bab / Marianne Pitzen, Bonn 2002, S. 58-65.
Keim, Anton Marie: Kathinka Zitz und Mathilde Hitzfeld. Frauen zwischen Revolution und Reaktion, in: Frauen in der Geschichte, Lebendiges Rheinland-Pfalz. Zeitschrift für Kultur und Geschichte, 2, 1986, S. 44-50.
Liedtke, Christian: Kathinka Zitz-Halein (1801-1877) – Zeitschriftstellerin und „Beschützerin aller Demokraten“, in: Vom Salon zur Barrikade: Frauen der Heinezeit, hg. von Irina Hundt, Stuttgart / Weimar 2002, S. 223-239.
Mecocci, Micaela: Kathinka Zitz (1801-1877). Erinnerungen aus dem Leben der Mainzer Schriftstellerin und Patriotin, Mainz 1998.
Mecocci, Micaela: Kathinka Zitz-Halein. Ein politisches und literarisches Frauenschicksal in Mainz zur Zeit der 1848er Revolution, in: Mainz und Rheinhessen in der Revolution von 1848/49 (Mainzer Geschichtsblätter 11), hg. von Hedwig Brüchert, Mainz 1999, S. 85-108.
Noering, Dietmar: Kathinka Halein: Ein Leben in schwerer Zeit, in: Zitz, Katinka: Wahre Freiheit. Gedichte und Prosa, hg. von Dietmar Noering, Frankfurt a.M. 1987, S. 101-122.
Özdemir, Derya: Die "Beschützerin aller Demokraten" - Kathinka Zitz (1801-1877) und die Revolution von 1848/49, in: https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/aufsaetze/oezdemir-derya/oezdemir-die-beschuetzerin-aller-demokraten-kathinka-zitz-1801-1877-und-die-revolution-von-184849.html.
Schmidt, Sabine: Dichterin = Ausgestoßene. Weibliches Leben und Schreiben zwischen Vormärz und Deutschem Reich – das Beispiel Kathinka Zitz-Halein (1801-1877), in: Schwellenüberschreitungen. Politik in der Literatur von deutschsprachigen Frauen 1780-1918, hg. von Caroline Bland / Elisa Müller-Adams, Bielefeld 2007, S. 169-188.
Wende, Angelika: Kämpferisch, einsam und verletzt. Kathinka Zitz (1801-1877), in: Federführend. 19 Autorinnen vom Rhein, hg. von Marlene Hübel / Jens Frederiksen, Ingelheim 2003, S. 149-158.
Zehendner, Anne-Kathrin: Kathinka Zitz (geb. Halein) 1801-1877, in: Mainz – Menschen, Bauten, Ereignisse. Eine Stadtgeschichte, hg. von Franz Dumont / Ferdinand Scherf, Mainz 2010, S. 141f.
Zucker, Stanley: Femal Political Opposition in Pre-1848 Germany. The Role of Kathinka Zitz-Halein, in: German Women in the Nineteenth Century. A social history, hg. Von John C. Fout, New York / London 1984, S. 133-150.
Zucker, Stanley: German Women and the Revolution of 1848: Kathinka Zitz-Halein and the Humania Association, in: Central European History, Nr. 13, 1980, S. 237-254.
Zucker, Stanley: Kathinka Zitz-Halein and Female Civic Activsm in Mid-Nineteenth-Century Germany, Carbondale 1991.
Wir nutzen Cookies und ähnliche Technologien, um Geräteinformationen zu speichern und auszuwerten. Mit deiner Zustimmung verarbeiten wir Daten wie Surfverhalten oder eindeutige IDs. Ohne Zustimmung können einige Funktionen eingeschränkt sein.