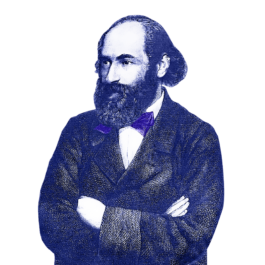
MORITZ HARTMANN
Als verfolgter Dichter und Teil des „Jungen Österreichs“ schreibt Moritz Hartmann für Freiheit und Demokratie, als Mitglied der Nationalversammlung setzt er sich für deren Umsetzung ein, an der Seite von Robert Blum riskiert er im Wiener Oktoberaufstand sein Leben – und muss schließlich erleben, wie das, wofür er gekämpft hat, von der reaktionären Bewegung eingestampft wird. Am Ende bleiben Enttäuschung und Frustration über den Ausgang der Revolution, denen er in seinem wohl berühmtesten Werk, der satirischen „Reimchronik des Pfaffen Maurizius“, Luft macht. Danach wird sein Schreiben unpolitischer und der einst bekannte Schriftsteller gerät mehr und mehr in Vergessenheit.
Für ihn überwiegt die Enttäuschung, vielleicht auch die Resignation – wir heute wissen, wie die Geschichte weitergeht: Hartmanns Sohn Ludo wird 1919 beratendes Mitglied der Weimarer Nationalversammlung und sieht die Demokratie-Hoffnungen seines Vaters damit Jahrzehnte später verwirklicht.
Moritz Hartmann wird am 15. Oktober im böhmischen Duschnik (heutiges Tschechien) geboren. Sein Vater ist Hammerwerksbesitzer und Privatgelehrter.
Nach dem Besuch von Gymnasium und Lateinschule beginnt Hartmann ein Medizinstudium und Prag und Leipzig, das er aber nie abschließt.
Hartmann wird Teil der literarischen Szene in Wien rund um Nikolaus Lenau und Anastasius Grün. In den folgenden Jahren arbeitet er als Publizist und Privatlehrer und hat unter anderem Kontakt zu Heinrich Heine.
Hartmanns erster Gedichtband „Kelch und Schwert“ erscheint. Er wird aufgrund von Verstößen gegen die geltenden Zensurbestimmungen polizeilich verfolgt und, nach Veröffentlichung eines weiteren Gedichtbands („Neuere Gedichte“) 1847 verhaftet. Durch die ausbrechende Revolution 1848 bleibt ein Urteil aber aus.
Hartmann gehört der literarischen Bewegung "Junges Österreich" an und gilt als einer ihrer Hauptvertreter.
Nach seiner Wahl in die Frankfurter Nationalversammlung schließt sich Hartmann der links außen stehenden Fraktion Donnersberg an. Er setzt sich für eine konsequente demokratische Staatsordnung ein und ist als einer der wenigen Abgeordneten, der sich explizit gegen die Wahl eines Reichsverwesers ausspricht.
Hartmann kämpft in der Gruppe rund um Robert Blum im Wiener Oktoberaufstand mit und gehört damit zu dem kleinen Teil der für die Durchsetzung der Demokratie zur Gewalt bereiten Demokratiebewegung. Nach der Niederschlagung des Aufstandes kann Hartmann fliehen und entgeht der Hinrichtung.
Hartmann beteiligt sich an der badischen Revolution, berät das Stuttgarter Rumpfparlament und flieht nach deren Niederschlagung nach Frankreich. Dort schreibt er, enttäuscht über den Ausgang der Revolution, die satirische „Reimchronik des Pfaffen Maurizius“. Unter anderem dieses Werk führt 1850 zu einem Strafverfahren wegen Hoch- und Staatsverrats gegen ihn.
Hartmann unternimmt in den 1850er Jahren zahlreiche Reisen und schreibt für Zeitungen und Zeitschriften. Während des Krimkriegs ist Hartmann 1854/55 Korrespondent für die „Kölner Zeitung“. Seine Dichtungen und Erzählungen werden zunehmend unpolitisch und nach dem kurzen Ruhm, erreicht vor allem durch die „Reimchronik des Pfaffen Mauritius“, gerät er als Schriftsteller bald wieder in Vergessenheit.
Nach der Hochzeit mit Bertha Rödiger 1860 kommt der gemeinsame Sohn Ludo Moritz Hartmann zur Welt.
Hartmann wird von Österreich amnestiert und zieht nach Wien, wo er für die „Neuen Freien Pressen“ als Feuilletonredakteur arbeitet.
Hartmann stirbt am 13. Mai in Oberdöbling bei Wien.
Was soll das ew’ge Streiten, nach Außen und nach Innen?
Ein’s haben wir verloren, Ein’s gilt es zu gewinnen;
Verloren ist das alte, das angestammte Recht.
Es ist nur zu gewinnen im männlichsten Gefecht.
Was soll das ew’ge Singen, darob kein Fürst errötet?
Ihr habt mit allen Liedern noch keinen Traum getötet.
Ihr habt wie Kinderleichen die Klagen hingestreu’t,
Es hat d’rob keine Herrschgier am Weg zurückgescheu’t.
Wohl dring Dein Lied, o Deutscher! aus tiefster Herzenskammer;
Ein Fürstenherz zu sprengen, ist’s nicht der rechte Hammer.
Wohl ist’s ein heil’ges Feuer, das Dich zu singen drängt,
Doch an gesalbten Häuptern hat’s noch kein Haar versengt.
Du wirst mit schönen Worten lang‘ keine Taten säen,
du reich an lahmen Führern, doch dürftig an Tyrtäen!
So klingt Dein Lied nach Freiheit als wie ein Liebesbrief
Nach einem geilen Weibe, das deinem Arm entlief.
Du wusstest nicht die Freiheit, ächt männlich stets zu halten,
Bei Worten nur und Worten musst‘ ihre Lieb‘ erkalten;
Das glüh’ndste Weib erkaltet, wo nichts als Liebesschwur,
Du musst es heiß umfassen, und es nicht lieben nur.
Ein Freiheitslied mag klingen zum Sturze von Bastillen,
Als Requiescat schließ‘ es des Zwingherrn letzten Willen
In Nächsten, wie die Nacht war vor Grochow trüb und still
Die stürmisch wie die Nacht war, als sang Rouget de Lisle-
Nach ausgekämpften Schlachten, nur unter Friedenspalmen
Tönt wohl ein ächtes Schlachtlied und stimmen Freiheitspsalmen;
Doch an den Strömen Babels lässt man das Liedern sein, -
die Harfen an die Weiden, - da blas‘ der Sturm darein!
Wohlgeborener Herr!
Wir waren in Wien so sehr von Geschäften überhäuft, dass es uns in der Tat nicht möglich war, meinem Versprechen, Ihnen von dort aus zu schreiben, nachzukommen. Aber es war auch nicht viel zu berichten. Wir machten nur die traurige Erfahrung, dass wir eine durchaus schwache Regierung haben, die mit der Feigheit der Schwäche es mit keiner Partei verderben will und jeder schmeichelt. – Doch haben wir es bei Pillersdorf dahingebracht, dass er uns unser Recht, für Frankfurt zu wählen, zugestehen und sagen musste, dass wir, wenn wir wollen, nur sofort wählen sollten. Keinesfalls aber sind diese Wahlen der Regierung angenehm, weil sie es nicht mit den Slawen verderben will und vom Frankfurter Parlament zu viel Gutes für die Völker erwartet. Keinesfalls aber dürfen wir uns davon abhalten lassen. Die Slawen werden immer übermütiger; sie werden beim Landtag wie beim Reichstag in überwiegender Majorität vertreten sein und denken schon an nichts als die allgemeine Slawisierung Österreichs. Schon um einen mächtigen Rückhalt zu haben, wenn auch nicht noch andere Ursachen da wären, müssen wir uns aufs innigste an Deutschland anschließen, sonst sind wir verloren. Das Frankfurter Parlament aber wird so stark sein, dass es uns gegen Landtag und Reichstag zu schützen imstande sein wird. – Auch dürfen wir uns durch allerlei Vorspiegelungen und Hindernisse nicht abhalten lassen, den ersten Tag in Frankfurt zu beschicken. – Dieses erste Mal nachgegeben oder aufgehalten, und wir haben unsere Kraft für alle Zukunft verloren. Über all das sind wir mit den Komitees in Wien und Prag einig geworden. Also, verehrtester Herr, keine Zeit verloren – rasch ans Werk, an die Wahlen. Ich selbst präsentiere mich als bescheidenen Kandidaten, und da jeder Kandidat verdammt ist, sich selbst zu rühmen und eine Tugenden aufzuzählen, so kann ich auch nicht umhin, mich selbst einen ehrenwerten Menschen mit bestem Willen zu nennen, dem Gott einen guten Namen und manche Talente gegeben, welche derselbe im Dienste der guten Sache, im Dienste der Bildung, des beständigen Fortschritts anzuwenden wünscht und eigentlich nie anders angewendet hat. Wenn (ich darf es wohl sagen, ohne unbescheiden zu sein) mein sehr guter Ruf in ganz Deutschland, mein jahrelanger Aufenthalt in den verschiedensten konstitutionellen Ländern und endlich meine persönlichen Bekanntschaften und Freundschaften mit den besten Männern, die im Frankfurter Parlamente sitzen werden – geben mir vielleicht ein Recht, mich um eine so ehrenvolle Wahl zu bewerben, um so mehr, da ich die feste Zuversicht hege, meinem Vaterlande dienen und Ehre machen zu können. Ich bitte Sie also, verehrtester Herr Doktor, mich beim Wahlkomitee in Leitmeritz als Kandidaten anzumelden.
Ergebenster
Moritz Hartmann
Mein verehrtes Fräulein!
[…]
Die deutsche Nationalversammlung ist leider nicht so gut zusammengesetzt, wie wir von Anfang hofften. Der größte Teil der Wahlen fand unter dem Deutschland schreckenden Einfall Heckers statt und fiel dazu konservativ aus. Ein großes Unglück für Deutschland! Das Volk, das mit Vertrauen die Nationalversammlung zusammentreten sah, wird dieses nach und nach verlieren und, nachdem es sich überzeugt haben wird, dass ihm diese nicht hilft, wieder die Ereignisse außerhalb derselben ihren Gang haben, und dieser wird kein friedlicher sein. Doch gewinnen wir von der Linken von Tag zu Tag mehr Boden, und vielleicht wird dann noch alles gut. Letzten Sonnabend haben wir einen großen Sieg erfochten, welcher die Nationalversammlung über alle Fürsten stellt. Sollten diese die Früchte des Sieges vereiteln wollen und blind sein, wie es die ganze Rechte ist, dann graben sie sich ihr eigenes Grab und legen den ersten Grundstein zur deutschen Republik. Das Streben nach Einheit ist jetzt das gewaltigste in Deutschland. – Die Fürsten stemmen sich dem entgegen, können aber eben dadurch zugrunde gehen, wie sie in ihrer alten Macht zugrunde gingen, als sie sich der Freiheitsidee entgegensetzten. Sie sind aber blind und sehen nicht ein, dass, wenn sie nicht ihre Souveränität der Oberhoheit des Frankfurter Parlaments unterordnen, die Einheit Deutschlands nur durch eine Föderativrepublik erzielt werden kann. Wenn der Herr die Könige verderben will, schlägt er sie mit Blindheit, heißt es in der Schrift, die im ganzen noch immer bessere Politik doziert als Dahlmann, Welcker und die anderen Doktrinäre, die wir in der Versammlung haben. Diese Doktrinäre, die am geschriebenen Wort und am Staatsrecht hängen wie die Kletten und nicht einsehen, dass die neue Zeit ein Volksrecht will und nicht ein Staatsrecht –, diese sind unser Unglück und machen, dass wir noch immer in der Minorität sind. Indessen, der Geist der Zeiten ist immer in der Minorität und siegt auch in der Minorität. Erst nach dem Siege tritt er in die Majorität – dann aber ist er schon veraltet und von einem neuen Zeitgeist verdrängt.
Aber, aber, aber!!! Da schreibe ich eine Abhandlung über Politik und soll und will Ihnen für Ihr liebes Schreiben und für die Einladung zum Balle danken. Wie gern hätte ich letztere angenommen, wenn sie nicht zu spät und zu einer anderen Zeit gekommen wäre. […]
Meine Herren! Es gibt Wahrheiten, die, wiewohl klar und sonnenhell wie der Tag, doch schon so oft besprochen worden sind, dass man sich eigentlich schämt, sie nochmals auszusprechen. Seit 60 Jahren wurde über den Adel und über die Abschaffung desselben speziell sehr viel gesprochen; der Adel ist eigentlich in der öffentlichen Meinung getötet, und gegen etwas Lebloses zu Felde zu ziehen, gibt das Ansehen eines Don Quixote. Wenn aber der Tod als ein Gespenst umhergeht, und es nur eines Wortes bedarf, um dieses Gespenst verschwinden zu machen, so ist es Pflicht, dieses Wort auszusprechen. Nur derjenige ist ein Staatsmann und imstande, Gesetze zu geben, nur derjenige ist ein wirklicher Politiker, welcher das Tote von dem Lebenden (scheidet), und der zu unterscheiden weiß, welche Zeit neu zu leben beginnt, und welche zu Grabe gegangen. Fürchten Sie nicht, meine Herren, ich werde mich nicht auf lange logische Beweisgründe einlassen, ich würde in jeder gebildeten Gesellschaft fürchten, sie zu beleidigen, wenn ich Dinge wie die Notwendigkeit der Abschaffung des Adels beweisen wollte, ich würde fürchten, die deutsche Nation zu beleidigen, denn davon, glaube ich, ist jeder Bauer überzeugt, dass der Adel tot ist. Die einzige Garantie für die Zukunft der Freiheit ist die Gleichheit; wer sich für bevorzugt hält, hält sich auch immer für höher und besser und glaubt, er sei berufen, den Anderen zu regieren, er kommt zur Logik des Caligula, der da sagt: Der Mensch ist ein ganz vortreffliches Geschöpf, ich muss aber viel besser sein als die übrigen, denn ich stehe weit höher, bin ein Gott. Der Adelige ist halb und halb auch so weit gegangen, er sagt: Ich bin aus viel edlerem und besserem Stoff, mein Fleisch und Blut ist edler und besser. Meine Herren! Jeder Physiologe könnte Ihnen vielleicht das Gegenteil beweisen. Die Akten über diesen Gegenstand sind, wie gesagt, geschlossen, und die ganze Geschichte, was man für und dagegen sagen kann, liegt in dem einzigen bekannten Satze: la force a fait le premier esclave, mais la méchanceté l’a continué¹. Wir sind aber keine niederträchtigen Sklaven, wir werden also auch den Adel nicht aufrechterhalten. Was will denn eigentlich der Adel in der heutigen Welt? Solange er ein Stand war, hatte er Pflichten, und er war nur ein Stand, weil er Pflichten hatte. In jetziger Zeit hat jeder dieselben Pflichten, und der Adel, der keine besonderen Pflichten hat, ist zu einer bloßen Kaste herabgesunken, und wir werden in dieser Beziehung nicht mit Ägypten und China gleichstehen wollen. Ich will nicht auf das alte banale Wesen zurückkommen, nicht von dem Bauernschweiß, nicht von dem Unwürdigen sprechen, welches darin lag, dass ein Stand dem anderen untergeordnet war, dass einer von dem anderen Vorrechte hatte. Das sind abgemachte Sachen. Ich könnte wohl die ganze Kette von Schlechtigkeiten von dem Mittelalter bis auf die neueste Zeit vor Ihnen aufwickeln. Ich will es aber nicht. Es könnte dies für Einzelne beleidigend sein, und die Sache gilt ja dem Stande. Ich könnte Ihnen sagen, wie der Adel, nachdem er im Mittelalter seine Bestimmung eingebüßt hat, herabgesunken ist zu den Lakaien und Intrigenmachern der Höfe, und wie er heutzutage so ganz und gar überflüssig wurde. Das sieht aber jetzt jeder ein, und ich will daher nur auf zwei Dokumente zurückkommen, die uns vorliegen, das eine die standesherrliche, das andere die Petition des Adels, die in letzter Zeit uns eingereicht wurde. Sehr bezeichnend für den Adel war es, dass er während dieser ganzen ungeheuren Bewegung sich niemals als Corporation, niemals überwiegend, sondern immer nur in wenigen Einzelnen dabei beteiligt hat. Jetzt, wo es gilt, ihm ein erbärmliches „von“ zu nehmen, kommt er vor und rührt sich, und bezeichnend für den Charakter desselben ist es, dass diese Herren sich einen Sachwalter wählten, der seine Feder schon den Feinden des Vaterlands geliehen hat. Die Adeligen, die sich um die Aufrechterhaltung des Adels verwenden, vertreten das Stabilitätswesen. Ob es nun aber ein großer Verdienst ist, das Stabilitätswesen zu vertreten, überlasse ich Ihrem eigenen Urteil. Wir gehen noch immer bergauf und brauchen keinen Hemmschuh, und wird es einmal bergab gehen, so haben wir genug Stabilität in unserem deutschen Wesen und unserer deutschen Gründlichkeit. Den Adel brauchen wir hierzu nicht. Bei Abschaffung des Adels helfen wir dem besseren Teil desselben über eine zweideutige und schiefe Stellung, worin er sich befindet, hinüber. […]
Zum Schluss erlauben ich mir, Ihnen nur noch eine kleine Fabel mitzuteilen: Ein verrostetes Schuld flehte zur Sonne: Oh Sonne, beleuchte mich! Diese sprach: Oh Schild, reinige dich! Unser Adel ins einer Ausnahmestellung und mit all den ungeheuren Vorwürfen, die auf ihm lasten, kann sich nur dadurch reinigen, dass er aus seiner Ausnahmestellung heraus zurückgehe in den heiligen Schoß des Volkes.
1 Übersetzung: „Die Gewalt machte die ersten Sklaven, die Feigheit verewigte sie.“ (Jean-Jacques Rousseau)
Wir reisten guten Mutes ab, wohl wissen, dass wir uns, wie Herr von Schmeling sagte, in Gefahr begaben. […]
Wir steigen aus, um etwas zu uns zu nehmen […], und schon hörten wir im Publikum hie und da unsere Namen flüstern und sahen mit Fingern auf uns deuten. Als wir einstiegen, hatte sich das Gerücht verbreitet, „die Mörder Lichnowskys“ seien da. Der Bahnhof wurde von Herbeiströmenden überfüllt, und durch die Menge drängten sich plötzlich von allen Seiten Offiziere hindurch. Wir hörten wohl manches Wort, das uns galt, und bemerkten die Aufregung, die in der Masse von Minute zu Minute wuchs. „Nur ruhig bleiben“, sagte Blum, „ich schlafe.“ So sprechend, zog er den Mantel über den Mund, legte sich eine Ecke und schlief. Ich beobachtete, was vor unserem Wagenfenster vorging. Ein Offizier nach dem anderen kam heran, starrte herein, betrachtete uns wie wilde Tiere, murmelte oder schimpfte etwas und ging weiter, um einem anderen Platz zu machen. Aber hinter den Offizieren stand eine bürgerliche Menge, die ruhig und beobachtend aus einiger Entfernung auf unsere Fenster und auf die Offiziere sah. Ich glaube, dass dort unsere Freunde standen; vielleicht wussten das auch die Offiziere, es blieb beim Gemurmel, beim Hin- und Hergehen, beim Hereinstarren, bis sich der Zug nach ungefähr einer halben oder dreiviertel Stunde in Bewegung setzte. Jetzt erst erhob sich ein hörbares Schimpfen, das für uns aber beim Lärm der Lokomotive unartikuliert blieb.
1 Hartmann schildert in diesem Auszug die Reise nach Wien im Zuge des Wiener Oktoberaufstands 1848 unter anderem zusammen mit Robert Blum und einen Vorfall am Bahnhof von Ratibor.
Deutsches Volk! Bis in die entferntesten Gaue Deines Landes ist der Name des Mannes gedrungen, der aus dem Arbeiterstande durch die Kraft seines Geistes sich emporgeschwungen hatte zu einem der vordersten Kämpfer für die heilige Sache der Freiheit.
Der beredte Mund, dessen Worte tief ergriffen, weil sie aus dem Herzen kamen, hat sich geschlossen; geschlossen durch eine Gewalttat, einen Mord, begangen mit kaltem Blute, mit Beobachtung sogenannter gesetzlicher Formen.
Du weißt, deutsches Volk, was dieser gemeuchelte Held Deiner jungen Freiheit für diese Freiheit getan. Klar in Gedanken, entschieden im Wollen, entschlossen im Handeln, trug er das Banner voran in dem Kampfe, in welchem er glorreich gefallen ist.
Was er getan während des Zeitraumes eines langen Druckes, was er gewirkt seit der Märzrevolution in dem Parlamente, in dem Fünfzigerausschusse, in der Nationalversammlung – mit unauslöschlicher Schrift ist es in aller Herzen eingetragen.
Die Begeisterung für die Sache der deutschen Freiheit und der Auftrag seiner politischen Freunde führte ihn nach Wien. Er focht an der Spitze des Elitekorps, dessen Führung ihm von dem Oberbefehlshaber anvertraut wurde. Als die Kapitulation Wiens abgeschlossen war, legte er die Waffen, die er mit Heldenmut geführt hatte, nieder. Vier Tage nach Beendigung des letzten Verzweiflungskampfes, an welchem er, dem gegebenen Wort treu, keinen Anteil mehr nahm, wurde er verhaftet. Man übertrat mit frechem Hohne das Gesetz, welches die Vertreter der deutschen Nation vor jeder von der Nationalversammlung nicht genehmigte Verhaftung schützen sollte und achtete der Berufung nicht, welche er, gestützt auf dieses Gesetz, gegen seine Verhaftung einlegte.
Deutsches Volk! Deine Ehre, Dein Recht trat man mit Füßen, als man Deinen Vertreter gegen das Gesetz verhaftete! Deiner Freiheit hat man eine tödliche Wunde geschlagen, als man einer Deiner würdigsten Söhne mordete!
Am vierten Tage seiner Verhaftung, acht Tage nach der völligen Einnahme Wiens, am 9. November, wurde Robert Blum standrechtlich in der Brigittenau erschossen!
Nicht in der Aufwallung tobender Leidenschaft, nicht in dem Getümmel des Kampfes wurde der Mord verübt; nein! Er wurde verübt von denjenigen, welche sich Werkzeuge des Gesetzes, Hersteller der Ordnung, Begründer gesetzlicher Freiheit nennen!
Deutsches Volk! Trauern wirst Du über den unersetzlichen Verlust, den Du erlitten! Vergiss des Toten nicht und erinnere Dich, wie er starb, für welche Sache er starb und durch wen er gemordet wurde!
Der Kaiser soll nicht erblich sein
Der Kaiser soll nicht sterblich sein
Und auch nicht lebensdauerlich,
und gar sechsjährigschauerlich!
Der Kaiser soll nicht wählbar sein
Und nicht vom Volkshaus quälbar sein.
Und auch nicht präsidentlich sein –
Was soll er sein, was soll er sein?
O Gott vom Himmel, sieh darein!
Der Kaiser soll kein Märker sein.
Und kein besoffener Beserker sein
Er soll als Andere nicht stärker sein,
Er soll kein halber Sklave sein,
Der Kaiser soll auch kein Bayer sein,
Er soll kein geflickter Dreier sein.
Der Kaiser soll auch kein Sklave sein,
Der Kaiser soll kein Freier sein;
Was soll er sein, was soll er sein?
O Gott vom Himmel, sieh darein!
Er soll ein Kaiser auf Miete sein,
er soll eine bloße Mythe sein,
Der wird von besonderer Güte sein –
Ein Kaiser der Verständigung,
ein Kaiser beliebiger Endigung
Und ohne Prinzipsversündigung,
Ein Vogtischer Kaiser auf Kündigung –
Das soll er sein, das soll er sein,
Ein Kaiser auf Kündigung soll es sein!
Mein verehrtes Fräulein!
[…] Die parlamentarischen Kämpfe, die leidenschaftlichen Ausbrüche in und außerhalb der Paulskirche, die vielerlei politischen Abenteuer und endlich de Reise nach Wien, die Belagerung, die großartigen Erlebnisse, der Fall der heldenmütigen Stadt, der Tod so vieler und edler Freunde – Sie selbst sind Dichterin – machen Sie aus all dem einen sehr spannenden, verwickelnden Roman, und lassen Sie aus allen Kämpfen den Helden verjüngt und froh hervorgehen, und Sie haben meine Geschichte und mich – und Sie werden selbst nicht mehr glauben, dass es Mangel an Teilnahme, Unempfindlichkeit für das Glück meiner Korrespondenz mit einer liebenswürdigen, geistreichen Dame – kurz, dass es irgendeiner geistiger oder seelischer Fehler sei, der mich so lange abhielt, Ihnen zu schreiben. – Ob es mit Frankfurt bald aus sein wird? Gewiss! Die Nationalversammlung ist eine Selbstmörderin, und sie kann bei dieser Zusammensetzung nicht anders sein. Es kursiert hier ein Verslein, das sie vollkommen charakterisiert:
75 Bürokraten –
Viele Worte, wenig Taten.
95 Aristokraten –
Armes Volk, du bist verraten.
130 Professoren –
Armes Deutschland, du bist verloren.
Und dazu die Klerisei –
Deutschland, du wirst nimmer frei!
Doch haben wir im Jahre 48 so viel gewonnen, dass die persönliche Freiheit gesichert ist, dass die Gesellschaft vollkommen regenerieren wird, wenn die Revolution auch darin ihren Zweck verfehlt hat, uns zu einigen und uns auch stark und frei nach außen zu machen. Auch das wird kommen, denn der Boden für die kommende Revolution ist frei und eben. Allerdings haben wir gebildeten Deutschen uns einen Augenblick eingebildet, dass wir eine gebildete Revolution ohne viel Blut werden zustande bringen können – aber die Fürsten wollen es nicht, und mein armes Vaterland wird trotz aller Bildung gezwungen sein, wie England und Frankreich durchs rote Meer ins Land der Freiheit zu ziehen.
Seit einigen Tagen macht hier ein kleines Büchlein in Versen, „Reim-Chronik des Pfaffen Maurizius“, ungeheures Aufsehen. Man spricht von nichts anderem, man kauft nichts anderes, man liest nichts anderes. Es ist in teils poetisch-pathetischem, teils humoristisch-satirischem Tone gehalten – jener behandelt die abgeschlossenen Tatsachen und Menschen wie Wien, Blum etc. – dieser die noch lebenden und wirkenden Persönlichkeiten wie Gagern, Kinkel, Schmerling etc. – Allgemein hält man mich für den Verfasser. Ich sehe keine Ursache (und habe keine) zu widersprechen und überlasse es jedem, nach dem Werte oder Unwerte des Büchleins zu urteilen, ob es wirklich von mir sei oder nicht. Bald wird ein zweites, drittes Heft folgen usf. Sie sehen, dass nicht alle Poesie unter dem Samum der parlamentarischen Debatte vertrocknet, und ich hoffe, sie soll es noch lange nicht.
Liebster Freund!
Hier hast Du einige von meinen Gedichten für die neue Ausgabe der polit. Lyrischen Dichter. Fratze und Biografie bekommst Du in den nächsten Tagen. Längst hättest Du alles erhalten, wenn Du nicht so traurige Fata gehabt hättest, die Dich von Deinen Freunden trennten. Vielleicht haben sie dazu beigetragen, Dich von der preuß. Kaiserleidenschaft zu heilen. Hier ist es wie immer öd und flach und schal und unersprießlich – man schämt sich, einander anzusehen, denn man fühlt, dass man unverdientes Brot fresse. Wir Österreicher betrachten das Parlament nur noch als Asyl, und viele bleiben nur aus dieser Rücksicht darin – Es geht nur mit einer Revolution und nicht anders – Die Fürsten wollen es so, und ihr Wille gab in Deutschland immer den Ausschlag. Lebe herzlich wohl. – Der erste Teil meiner Reimchronik, die ich herausgebe, macht hier angeheures Aufsehen.
Mein verehrtes Fräulein!
[…] Die Sachen stehen schlecht in Deutschland, so sehr schlecht, dass sie über Nacht gut werden können. Dieses aber will ich abwarten und meine teure Mutter in ihrer Krankheit nicht verlassen. Entweder wir machen binnen Wochen eine ganz fürchterliche Revolution, oder wir fallen in einen Zustand zurück, der unerträglicher sein wird als der vormärzliche. Den einen Trost haben wir, dass sich die Monarchie so gründlich zugrunde gerichtet hat, wie es kein Radikalismus der Welt vermocht hätte, und da wir den frommen Glauben haben, dass sich nichts mehr halten kann, was der allgemeinen Meinung und Überzeugung zuwider ist, so haben wir auch die Hoffnung, dass manches Böse unwiederbringlich verloren ist. – Allein die Weltgeschichte macht kleine Schritte, besonders in Deutschland, und rechnet nach Jahrzehnten und Jahrhunderten – also ist es möglich, dass die schwarze Woge noch über unsern Häuptern hinweggeht.
[…] In England kann man allerdings Manches lernen, was einst dem Vaterlande nützen kann. - Doch nein! - Während ich diese Worte schreibe, fühle ich, dass ich konventionell u. nicht ganz aufrichtig bin. - Man kann hier nur negativ lernen, denn trotz der Größe, der ungeheuren Macht, die den Fremden hier bei jedem Schritte in die Augen fällt - ich möchte mein Vaterland nicht zu einem England machen. - Bei all dieser Größe und Macht überfällt mich hier oft der traurige Gedanke, dass es im Leben der Völker wie im Leben der Individuen gilt; nur der Bornierte, nur der Fachmensch mit Augenklappen, der nicht nach Rechts, nicht nach Links sieht, kann es zu etwas bringen. Die Engländer sind wirklich borniert - sie sind es in politischer, sozialer und religiöser Beziehung. - Die ganze Nation besteht aus Schichten, die wie Aluviane aufeinander liegen und drücken. Nur der Druck verbindet sie. (Jede untere Schichte drängt freilich wieder nach oben, aber nicht vulkanisch, um zu regenerieren, sondern um mit von oben nach unten zu drücken. - So ist denn oben Alles verwittert und unten Alles zerbröckelt. - Auch mit den vielgepriesenen »Reformen zur rechten Zeit«, die die Revolution überflüssig machen, ist es nicht so arg - sie sind am Ende doch nur der Fortschritt der Gefangenen mit den Ketten an den Füßen, welche historisches Recht, Religion, Heuchelei etc. heißen. - Kurz, es ist doch wahr, wie lächerlich es auch klingt: Wir sind im Grunde freier als alle Völker der Erde! Trotz Erfurt, Interim, 34 Fürsten und Österreich und Preußen! - Das wäre ein Trost, wenn es nicht so wenig und wenn Unser Eins nicht ein Bürger aller unterdrückten Völker wäre. […]
[…] Vogt habe ich in letzter Zeit wenig gesehen. Seine Politik ist nicht die meine; sie ist mir zu politisch. Wenn ich auch einsehe, dass ein gewisser Monsieur. [Napoleon] manches Gute schafft, während er nur das Böse will, so kann ich doch nicht in Allem u. Jedem u. gegen die ganze Welt für ihn Partei ergreifen. Und wenn auch den Deutschen eine Züchtigung vielleicht gut ist, so kann ich mich doch nicht darauf freuen, dass diese Züchtigung kommen soll u. zwar von Ihm. Bei all den Regungen in der ganzen Welt ist es mehr [mir] doch ganz traurig zu Mute. Von Demokratie ist doch eigentlich nirgends die Rede: höchstens erbärmlicher Konstitutionalismus, in den sich überall mit Leichtigkeit der Imperialismus als faux frere¹ der Freiheit infiltriert. […]
1 Übersetzung: Falscher Bruder
[…] Fortwährend musste ich an den Schulmeister gedenken, den wir am selben Tage in einem Gasthause auf Badener Gebiete getroffen hatten. Er war sonntäglich gekleidet und machte kein Hehl daraus, dass er dem Großherzog nachziehe, ja er proklamierte es laut, so oft er glaubte, dass Revolutionäre in der Nähe seien, offenbar wünschend, von ihnen seiner großherzoglichen Treue wegen misshandelt oder zurückgehalten zu werden. Es zog ihn nicht im Geringsten zum Großherzog; er war mit ganzer Seele bei dessen Feinden, und einmal, in einem ekstatischen Zustande, stieß er ein brünstiges Gebet für die Revolution und die Verfassungskämpfer aus. Weinend aber versicherte er, es bleibe nichts Anderes übrig, als mit dem Großherzog Frieden zu machen, weil Alles verloren sei. Dieser Schulmeister war mir das trübe Bild des deutschen Volkes. Weiterlesen
1 Erschienen in der Zeitschrift: „Die Gartenlaube“, Heft 3, S. 40-44, Leipzig 1863.
Im Gasthause zu Heilbronn sahen wir zwei reisende junge Mädchen, deren eines als Mann verkleidet war. Höchst wahrscheinlich auf der Flucht und schutzlos, wie sie waren, schufen sie sich auf diese Weise einen fingierten Schutz. Sie hatten nichts Abenteuerliches in Wesen und Benehmen, und man sah es ihnen an, dass nur die Noth sie zu solcher nicht ganz weiblichen List gezwungen hatte. Alle Anwesenden, samt den Wirtsleuten, gingen stillschweigend auf ihre Absichten ein, obwohl Niemand auch nur einen Augenblick getäuscht war. […]
In Heilbronn, wo sich indessen mehrere Abgeordnete gesammelt hatten, wurden wir mit großen Volksdemonstrationen empfangen, denen am nächsten Tage noch andere und größere folgten, und an denen auch die Bürgerwehr Teil nahm. Indessen erinnere ich mich nicht mehr an die Einzelheiten, die diese bezeichneten, da die damalige Zeit an solchen Äußerungen reich und diese einander meist sehr ähnlich waren. Ich weiß nur, dass uns der Empfang in Heilbronn einen Eindruck machte, der uns zu dem Glauben berechtigte, dass wir in Württemberg willkommen seien und dass das württembergische Volk aufrichtig und mit Wärme an der Reichsverfassung hänge. Viele ausgezeichnete Württemberger, darunter Mitglieder des Landesausschusses, Kammerabgeordnete und Schriftsteller, kamen uns von Stuttgart aus entgegen, und mit diesen bestiegen wir einen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen, Blumen und Girlanden geschmückten Eisenbahnzug, um uns in die Hauptstadt zu begeben. […]
Die große Mehrheit war von unserm Rechte durchdrungen, voll Achtung für uns, als die Vertreter der Nation und zwar als das kleine Häuflein von Vertretern, das in diesem kritischen Momente aushielt, während die große Mehrzahl auf Befehl oder Drohungen der Regierungen auseinander stob und die Fahne der Nation schmählich im Stiche ließ. Von unserem Rechte, und ich darf wohl sagen, von dem Achtungswerten unserer Lage, war Jedermann durchdrungen; wagte doch selbst die Regierung in ihrer Proklamation weder das Eine noch das Andere zu leugnen; aber die Stadt war ruhig, und wir brachten vielleicht die Revolution, wir brachten vielleicht Straßenkampf, eine neue Krise und eine Zukunft voll Unsicherheit.
Nicht Alle, die für das Recht waren, waren zugleich für einen Kampf um dieses Recht und alle aus einem solchen Kampfe entspringenden Möglichkeiten. Die Begeisterung, die Ehrerbietung, die man uns zeigte, hatte etwas Gedrücktes, so wie bei aller Bewegung, die wir brachten, die ganze Atmosphäre nicht aufgeregt, gewitterhaft wurde, sondern ohne Schwüle gedrückt blieb. Ein großer Teil der Einwohner dieser Stadt, welche sich damals noch nicht, wie das heute der Fall ist, durch Handel und Gewerbe unabhängig gemacht hatte, hing mit dem Hofe zusammen und lebte vom Hofe. Dieser Teil war uns ausgesprochen feindlich; dieser betrachtete uns mit düstern Blicken, während der andere, wenn auch mit Sympathie, doch zugleich melancholisch zu uns herübersah. Dies ist die Wahrheit über die damalige Stimmung in Stuttgart, wenn auch der Enthusiasmus, der uns in den nächsten Kreisen umgab, manchem Abgeordneten vielleicht ein anderes Bild in der Erinnerung zurückließ. […] Die dieser Erfahrungen war die, dass mehrere Städte, die sich eifrig für die Reichsverfassung gezeigt hatten, plötzlich lau wurden, als sie zu merken glaubten, dass sie durch die Grundrechte gewisse aus alten reichsstädtischen Zeiten herabgekommene Privilegien, die ihnen einen Teil ihrer Einkünfte sicherten, verlieren könnten. […]
Am 6. Juni morgens neun Uhr versammelten wir uns auf dem Rathause, um uns von da nach der württembergischen Kammer zu begeben. Bürgerwehr bildete den ganzen Weg entlang ununterbrochene Spaliere, und hinter diesen drängte sich das Volk, um uns durch Zuruf zu begrüßen und zu ermuntern. Der kleine Saal der württembergischen Kammer war groß genug, um die deutsche Nationalversammlung, welche einst in den weiten Räumen der Paulskirche kaum Platz hatte, bequem zu beherbergen. […]
Löwe von Calbe wurde zum Präsidenten gewählt, und es begannen sofort die Debatten, welche die Schöpfung eines neuen Mittelpunktes, einer neuen Zentralgewalt zum Zwecke hatten. Der Reichsverweser konnte als Vertreter der Zentralgewalt von uns nicht anerkannt werden; er hatte keine der Pflichten erfüllt, die er beschworen, und die Gewalt, die man ihm anvertraut hatte, gegen die Nation gekehrt, die ihn an die Spitze gestellt. Wir waren mehr als berechtigt, wir waren verpflichtet, diese Zentralgewalt als null und nichtig wenigstens zu erklären, und es war geboten, eine neue zu schaffen, für den Fall, dass ihr noch irgendeine Wirksamkeit gegönnt wäre. […]
Am 17., spät abends erhielt der Präsident Löwe von Calbe im Namen des Gesamtministeriums ein von Herrn Römer unterzeichnetes Schreiben, in welchem dieser verkündigte, „dass das Tagen der hierher übergesiedelten Nationalversammlung und das Schalten der von ihr am 6. d. Mts. gewählten Reichsregentschaft in Stuttgart und Württemberg nicht mehr geduldet werden könne.“ Die Zuschrift enthält noch immer eine Anerkennung des Rechtes, kann sich aber trotzdem hie und da eine gegen die Nationalversammlung gerichtete höhnische Bemerkung nicht versagen. […] Der Präsident wollte sich hierauf mit den Schriftführern in das Sitzungslokal begeben, um es vor Eröffnung der Sitzung, welche um drei Uhr beginnen sollte, in Besitz zu nehmen, aber schon um ein Uhr wurde er benachrichtigt, dass das Haus bereits von Militär besetzt sei. […] Wir versammelten uns unter den Bäumen eines gewissen Platzes, den ich, bei meiner damaligen Unbekanntschaft mit der Stadt, nicht näher bezeichnen kann, und setzten uns von da aus in Bewegung. An unserer Spitze schritt der Präsident, ihm zu Seiten zwei Prytanen Deutschlands, die beiden Greise Albert Schott und Ludwig Uhland, zwei Männer, die ein ehrenvolles, fleckenloses, langes Leben hinter sich hatten, dass nur dem Kampfe für das Recht, für das Gute und Schöne gewidmet war und dass sie auch jetzt, ohne Zaudern der Ungewissheit, einer drohenden Gefahr ruhig und schlicht entgegentrugen. […] Sollte man nicht meinen, dass ein Recht, das von zwei solchen Zeugen begleitet auftritt, von aller Welt erkannt werden müsse? Man sollte es meinen, wenn man nicht wüsste, dass der Eigennutz sich um das Recht und seine heiligsten Zeugen nicht kümmert und dass er, um es zu besiegen, die Gedankenlosigkeit als Mittel gebraucht. Unmittelbar hinter dem Präsidenten und den beiden Greisen ging ich, Arm in Arm mit meinem Freunde Ludwig Simon, kann also als Augenzeuge über die letzten Momente des Parlamentes berichten. Ich wusste, dass wir unserm Ende entgegengingen, und das dicht gedrängte Volk, rechts und links an unserm Wege, flößte mir, trotz aller Zurufe, kein Vertrauen ein. Durch die natürlichste Ideenassoziation erinnerte ich mich jenes andern Ganges vom Römer in die Paulskirche bei Eröffnung des Parlamentes – als alle Häuser mit Flaggen und Blumen geschmückt waren, aus allen Fenstern Jubelrufe erschollen, die Musik „Nur gewagt, unverzagt“ aufspielte und Aller Herzen voll großer Hoffnungen waren. Nun will ich es offen gestehen, dass ich mich damals in Frankfurt nicht so gehoben fühlte, wie auf diesem letzten Gange des Parlamentes, der einem Gange zum Schafott glich. Wir kamen in eine Straße, in der wir das Militär, Infanterie, aufgestellt sahen; während links in einer Seitenstraße Kavallerie wartete. Wir setzten unsern Weg fort, als ob jenes Hindernis vollkommen unsichtbar wäre, und kamen so an die Reihen der Soldaten, welche die Straße, die zum Sitzungslokale führte, absperrten. Der Präsident mit seinen beiden Begleitern war eben bis auf ungefähr zwei Schritte Entfernung den Soldaten nahe gekommen, als sich deren Reihen plötzlich öffneten und ein älterer Mann mit weißer Binde und einem Papier in der Hand heraustrat und dem Präsidenten verkündete, dass er als Zivilkommissar den Auftrag habe, zu erklären, dass keine Sitzung gehalten werden dürfe. Der Mann – Cammerer hieß er – war blass, und seine Stimme zitterte, wie eines Verbrechers. Kaum hatte er seine Worte hervorgestoßen, als er schon wieder hinter den Soldaten verschwand. Ich glaube, dass er nur noch die Worte „mein Auftrag ist erfüllt“ hervorstotterte. Der Präsident erhob seine klangvolle Stimme und rief: „Ich erkläre“ – hier aber wurde er von Trommelwirbel unterbrochen, wie ein Delinquent, den man nicht zu Worte kommen lässt. Trotzdem rief der Präsident dem Zivilkommissar zu: „Sie müssen mich hören!“ und als dieser verschwunden blieb, erhob er die Stimme noch einmal und rief: „Ich protestiere gegen dieses Verfahren, als gegen einen Verrat an der Nation!“ und die Worte wurden gehört, trotzdem die Trommelwirbel immer stärker wurden und trotz dem Waffengeklirr. Die meisten Abgeordneten hatten sich indessen nach vorn gedrängt und standen in kompakter Masse vor den Soldaten. Eine kleine Episode, die in diesem Momente spielte, scheint von nur sehr Wenigen, vielleicht nur von mir bemerkt worden zu sein, da ich sie in den zahlreichen Berichten, die später im Hotel Marquart erstattet wurden, nirgends erwähnt finde.
Zivilkommissar Cammerer, nachdem er hinter den Soldaten verschwunden war, kam auf einen Augenblick wieder zum Vorschein, wandte sich an Ludwig Uhland und sagte ihm, dass, wenn er allein eintreten wolle, ihm der Weg offen stehe. Ich werde die Gebärde der Verachtung, das wegwerfende Achselzucken, mit dem sich Uhland von ihm abwandte, nie vergessen und ich glaube, dass selbst Herr Cammerer, obwohl ein Mann, der sich zu einem solchen Amte hergegeben, diesen Moment ebenso wenig vergessen werde. Mittlerweile, da die Abgeordneten sich an die Soldaten herangedrängt hatten, kommandierte man „Fällt das Bajonett“ – aber sie gehorchten nur zur Hälfte. Ich bemerkte, dass ein einziger Soldat das Bajonett so weit sinken ließ, dass es Einen der Herandrängenden beschädigen konnte. Dieser Eine hatte offenbar den besten Willen, sein Bajonett in Blut zu tauchen; seine Bewegungen, wie der Ausdruck seines Gesichtes verrieten es zu deutlich. Die Anderen aber waren unschlüssig und sahen niedergeschlagen vor sich hin. General Miller bemerkte das wohl ebenso gut wie ich, rief dem Präsidenten, der unbeweglich stand, ein „Fort!“, dann einem Offizier in der Seitenstraße ein Kommandowort zu, und in demselben Augenblicke sprengte die Kavallerie auf uns ein, während der Offizier, der sie führte, „Einhauen!“ kommandierte und die anderen Offiziere fortwährend „Haut zu! Haut zu!“ ausriefen. Doch muss ich der Gerechtigkeit wegen hinzufügen, dass ich einen Offizier selber sah, der einem Kavalleristen, welcher auf den Abgeordneten Günther einhauen wollte, in den Arm fiel. Der Abgeordnete Günther nämlich, als die Kavallerie herbeisprengte, warf sich ihr entgegen, riss seine Kleider auf und außer sich rief er den Heransprengenden entgegen: „Haut zu!“
Im Allgemeinen aber hatten auch die Kavalleristen, trotz der beständigen Aufmunterung der Offiziere und Unteroffiziere, nicht die geringste Lust zum Einhauen. Sie taten nur so und schwenkten, indem sie in unsere Schar hineinritten und uns trennten, ihre Säbel über unseren Köpfen. Der Präsident selbst war in Gefahr niedergeritten zu werden. Es lag also nach alldem weder an Herrn Römer noch an dem guten Willen der württembergischen Offiziere, dass das Parlament ein unblutiges Ende nahm. Hätten die Soldaten gehorcht, ihre große Anzahl hätte unser kleines Häuflein binnen fünf Minuten bis auf den letzten Mann niedermetzeln können. Das Volk drängte sich mit in das Gewirre, und die Erkenntnis von der Stimmung der Soldaten, die man sofort gewinnen musste, war wohl mit eine der Ursachen, dass es zu keinem weitern Konflikte kam.
Bei dem Gedränge von Abgeordneten, Soldaten und Volk, bei der Verwirrung war es nicht möglich uns wieder zusammenzufinden und an Ort und Stelle etwas Gemeinschaftliches zu beginnen. „Nach dem Hotel Marquart!“ rief ein Abgeordneter dem andern zu, und in der Tat fanden wir uns dort zur selben Stunde zusammen, auf welche die Sitzung in der Reitschule angesetzt war. Aber wir zählten uns – unsere Zahl belief sich nur noch auf 94 – wir waren nicht mehr beschlussfähig – die Nationalversammlung war gestorben oder, wenn es besser klingt, hingerichtet.
Kelch und Schwert. Dichtungen, Leipzig 1845.
Neuere Gedichte, Leipzig 1847.
Reimchronik des Pfaffen Maurizius, Frankfurt a.M. 1849.
Der Krieg um den Wald. Eine Historie, Frankfurt a.M. 1850.
Gedichte, Braunschweig 1858.
Novellen, 1. Teil: Der Zweck heiligt die Mittel – Gräfin Sassari – Bei Kunstreitern – Selvaggia – Ein italienischer Priester – Doctor Schwan – An der Spielbank, Hamburg 1863.
Novellen, 2. Teil: Zwanzig Millionen – Verrechnet – Feigheit – Der Hetmann – Tante Helene, Hamburg 1863.
Novellen, 3. Teil: Der Gefangene von Chillon, Hamburg 1863.
Wilhelm Tell. Eine Erzählung, in: Berthold Auerbach’s deutscher Volkskalender, 1864.
Die Rheingrenze. Eine patriotische Erzählung, in: Berthold Auerbach’s deutscher Volkskalender, 1865.
Die letzten Tage eines Königs, Historische Novelle, Stuttgart 1866.
Nach der Natur. Novellen, 1. Teil: Die Ausgestoßenen – Rostet nicht – Die Gypsfigur – Eine Modenesische Geschichte, Stuttgart 1866.
Nach der Natur. Novellen, 2. Teil: Der Flüchtling – Eine Stunde im Leuchtthurm – Nein – Deutsch, Französisch, Englisch – Die letzte Montanini, Stuttgart 1866.
Nach der Natur. Novellen. 3. Teil: Der goldene Schlüssel – Das Schloß im Gebirge – Eine Entführung in Böhmen – Eine Mutter – Die Brüder Mathieu, Stuttgart 1866.
Die Diamanten der Baronin. Roman, Band 1 & Band 2, Berlin 1868.
Revolutionäre Erinnerungen, hg. von Heinrich Hubert Houben, Leipzig 1919, niedergeschrieben 1861.
Gesammelte Werke, Band 1 (Der Vormärz und die Revolution) & Band 2 (Exil und Heimkehr), hg. von Otto Wittner, Prag 1906-1907.
Baus, Martin: Moritz Hartmann, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte der demokratischen und liberalen Bewegung in Mitteleuropa, Band 2 / Teil 1 (Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle „Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850, Band 39), hg. von Helmut Reinalter, Frankfurt a.M. 2005, S. 132f.
Best, Heinrich / Weege, Wilhelm: Hartmann, Moritz, in: Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49 (Handbücher zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 8), Bonn 1996, S. 168f.
Haacke, Wilmont: Hartmann Moritz, NDB (Band 7), Berlin 1966, https://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016325/images/index.html?id=00016325&groesser=&fip=eayaqrsweayaqrsxsxdsydsdasewqeayaxdsydsdas&no=1&seite=751.
Hiller, Ferdinand: Hartmann, Moriz, in: ADB (Band 10), Leipzig 1879, https://de.wikisource.org/wiki/ADB:Hartmann,_Moritz.
Laß, Hans: Moritz Hartmann. Entwicklungsstufen des Lebens und Gestaltwandels des Werkes, Diss., Hamburg 1963.
Neumann, William: Moritz Hartmann. Eine Biographie, Diss., Kassel 1854.
Oberhauser, Claus: Moritz Hartmann, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte der demokratischen und liberalen Bewegung in Mitteleuropa, Band 2 / Teil 2 (Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle „Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850, Band 43), hg. von Helmut Reintaler, Frankfurt a.M. 2011, S. 40f.
Wittner, Otto: Moritz Hartmanns Jugend, Diss., Bern 1902.
MORITZ HARTMANN
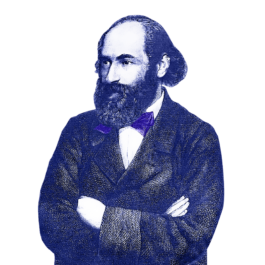
Als verfolgter Dichter und Teil des „Jungen Österreichs“ schreibt Moritz Hartmann für Freiheit und Demokratie, als Mitglied der Nationalversammlung setzt er sich für deren Umsetzung ein, an der Seite von Robert Blum riskiert er im Wiener Oktoberaufstand sein Leben – und muss schließlich erleben, wie das, wofür er gekämpft hat, von der reaktionären Bewegung eingestampft wird. Am Ende bleiben Enttäuschung und Frustration über den Ausgang der Revolution, denen er in seinem wohl berühmtesten Werk, der satirischen „Reimchronik des Pfaffen Maurizius“, Luft macht. Danach wird sein Schreiben unpolitischer und der einst bekannte Schriftsteller gerät mehr und mehr in Vergessenheit.
Für ihn überwiegt die Enttäuschung, vielleicht auch die Resignation – wir heute wissen, wie die Geschichte weitergeht: Hartmanns Sohn Ludo wird 1919 beratendes Mitglied der Weimarer Nationalversammlung und sieht die Demokratie-Hoffnungen seines Vaters damit Jahrzehnte später verwirklicht.
Moritz Hartmann wird am 15. Oktober im böhmischen Duschnik (heutiges Tschechien) geboren. Sein Vater ist Hammerwerksbesitzer und Privatgelehrter.
Nach dem Besuch von Gymnasium und Lateinschule beginnt Hartmann ein Medizinstudium und Prag und Leipzig, das er aber nie abschließt.
Hartmann wird Teil der literarischen Szene in Wien rund um Nikolaus Lenau und Anastasius Grün. In den folgenden Jahren arbeitet er als Publizist und Privatlehrer und hat unter anderem Kontakt zu Heinrich Heine.
Hartmanns erster Gedichtband „Kelch und Schwert“ erscheint. Er wird aufgrund von Verstößen gegen die geltenden Zensurbestimmungen polizeilich verfolgt und, nach Veröffentlichung eines weiteren Gedichtbands („Neuere Gedichte“) 1847 verhaftet. Durch die ausbrechende Revolution 1848 bleibt ein Urteil aber aus.
Hartmann gehört der literarischen Bewegung "Junges Österreich" an und gilt als einer ihrer Hauptvertreter.
Nach seiner Wahl in die Frankfurter Nationalversammlung schließt sich Hartmann der links außen stehenden Fraktion Donnersberg an. Er setzt sich für eine konsequente demokratische Staatsordnung ein und ist als einer der wenigen Abgeordneten, der sich explizit gegen die Wahl eines Reichsverwesers ausspricht.
Hartmann kämpft in der Gruppe rund um Robert Blum im Wiener Oktoberaufstand mit und gehört damit zu dem kleinen Teil der für die Durchsetzung der Demokratie zur Gewalt bereiten Demokratiebewegung. Nach der Niederschlagung des Aufstandes kann Hartmann fliehen und entgeht der Hinrichtung.
Hartmann beteiligt sich an der badischen Revolution, berät das Stuttgarter Rumpfparlament und flieht nach deren Niederschlagung nach Frankreich. Dort schreibt er, enttäuscht über den Ausgang der Revolution, die satirische „Reimchronik des Pfaffen Maurizius“. Unter anderem dieses Werk führt 1850 zu einem Strafverfahren wegen Hoch- und Staatsverrats gegen ihn.
Hartmann unternimmt in den 1850er Jahren zahlreiche Reisen und schreibt für Zeitungen und Zeitschriften. Während des Krimkriegs ist Hartmann 1854/55 Korrespondent für die „Kölner Zeitung“. Seine Dichtungen und Erzählungen werden zunehmend unpolitisch und nach dem kurzen Ruhm, erreicht vor allem durch die „Reimchronik des Pfaffen Mauritius“, gerät er als Schriftsteller bald wieder in Vergessenheit.
Nach der Hochzeit mit Bertha Rödiger 1860 kommt der gemeinsame Sohn Ludo Moritz Hartmann zur Welt.
Hartmann wird von Österreich amnestiert und zieht nach Wien, wo er für die „Neuen Freien Pressen“ als Feuilletonredakteur arbeitet.
Hartmann stirbt am 13. Mai in Oberdöbling bei Wien.
Was soll das ew’ge Streiten, nach Außen und nach Innen?
Ein’s haben wir verloren, Ein’s gilt es zu gewinnen;
Verloren ist das alte, das angestammte Recht.
Es ist nur zu gewinnen im männlichsten Gefecht.
Was soll das ew’ge Singen, darob kein Fürst errötet?
Ihr habt mit allen Liedern noch keinen Traum getötet.
Ihr habt wie Kinderleichen die Klagen hingestreu’t,
Es hat d’rob keine Herrschgier am Weg zurückgescheu’t.
Wohl dring Dein Lied, o Deutscher! aus tiefster Herzenskammer;
Ein Fürstenherz zu sprengen, ist’s nicht der rechte Hammer.
Wohl ist’s ein heil’ges Feuer, das Dich zu singen drängt,
Doch an gesalbten Häuptern hat’s noch kein Haar versengt.
Du wirst mit schönen Worten lang‘ keine Taten säen,
du reich an lahmen Führern, doch dürftig an Tyrtäen!
So klingt Dein Lied nach Freiheit als wie ein Liebesbrief
Nach einem geilen Weibe, das deinem Arm entlief.
Du wusstest nicht die Freiheit, ächt männlich stets zu halten,
Bei Worten nur und Worten musst‘ ihre Lieb‘ erkalten;
Das glüh’ndste Weib erkaltet, wo nichts als Liebesschwur,
Du musst es heiß umfassen, und es nicht lieben nur.
Ein Freiheitslied mag klingen zum Sturze von Bastillen,
Als Requiescat schließ‘ es des Zwingherrn letzten Willen
In Nächsten, wie die Nacht war vor Grochow trüb und still
Die stürmisch wie die Nacht war, als sang Rouget de Lisle-
Nach ausgekämpften Schlachten, nur unter Friedenspalmen
Tönt wohl ein ächtes Schlachtlied und stimmen Freiheitspsalmen;
Doch an den Strömen Babels lässt man das Liedern sein, -
die Harfen an die Weiden, - da blas‘ der Sturm darein!
Wohlgeborener Herr!
Wir waren in Wien so sehr von Geschäften überhäuft, dass es uns in der Tat nicht möglich war, meinem Versprechen, Ihnen von dort aus zu schreiben, nachzukommen. Aber es war auch nicht viel zu berichten. Wir machten nur die traurige Erfahrung, dass wir eine durchaus schwache Regierung haben, die mit der Feigheit der Schwäche es mit keiner Partei verderben will und jeder schmeichelt. – Doch haben wir es bei Pillersdorf dahingebracht, dass er uns unser Recht, für Frankfurt zu wählen, zugestehen und sagen musste, dass wir, wenn wir wollen, nur sofort wählen sollten. Keinesfalls aber sind diese Wahlen der Regierung angenehm, weil sie es nicht mit den Slawen verderben will und vom Frankfurter Parlament zu viel Gutes für die Völker erwartet. Keinesfalls aber dürfen wir uns davon abhalten lassen. Die Slawen werden immer übermütiger; sie werden beim Landtag wie beim Reichstag in überwiegender Majorität vertreten sein und denken schon an nichts als die allgemeine Slawisierung Österreichs. Schon um einen mächtigen Rückhalt zu haben, wenn auch nicht noch andere Ursachen da wären, müssen wir uns aufs innigste an Deutschland anschließen, sonst sind wir verloren. Das Frankfurter Parlament aber wird so stark sein, dass es uns gegen Landtag und Reichstag zu schützen imstande sein wird. – Auch dürfen wir uns durch allerlei Vorspiegelungen und Hindernisse nicht abhalten lassen, den ersten Tag in Frankfurt zu beschicken. – Dieses erste Mal nachgegeben oder aufgehalten, und wir haben unsere Kraft für alle Zukunft verloren. Über all das sind wir mit den Komitees in Wien und Prag einig geworden. Also, verehrtester Herr, keine Zeit verloren – rasch ans Werk, an die Wahlen. Ich selbst präsentiere mich als bescheidenen Kandidaten, und da jeder Kandidat verdammt ist, sich selbst zu rühmen und eine Tugenden aufzuzählen, so kann ich auch nicht umhin, mich selbst einen ehrenwerten Menschen mit bestem Willen zu nennen, dem Gott einen guten Namen und manche Talente gegeben, welche derselbe im Dienste der guten Sache, im Dienste der Bildung, des beständigen Fortschritts anzuwenden wünscht und eigentlich nie anders angewendet hat. Wenn (ich darf es wohl sagen, ohne unbescheiden zu sein) mein sehr guter Ruf in ganz Deutschland, mein jahrelanger Aufenthalt in den verschiedensten konstitutionellen Ländern und endlich meine persönlichen Bekanntschaften und Freundschaften mit den besten Männern, die im Frankfurter Parlamente sitzen werden – geben mir vielleicht ein Recht, mich um eine so ehrenvolle Wahl zu bewerben, um so mehr, da ich die feste Zuversicht hege, meinem Vaterlande dienen und Ehre machen zu können. Ich bitte Sie also, verehrtester Herr Doktor, mich beim Wahlkomitee in Leitmeritz als Kandidaten anzumelden.
Ergebenster
Moritz Hartmann
Mein verehrtes Fräulein!
[…]
Die deutsche Nationalversammlung ist leider nicht so gut zusammengesetzt, wie wir von Anfang hofften. Der größte Teil der Wahlen fand unter dem Deutschland schreckenden Einfall Heckers statt und fiel dazu konservativ aus. Ein großes Unglück für Deutschland! Das Volk, das mit Vertrauen die Nationalversammlung zusammentreten sah, wird dieses nach und nach verlieren und, nachdem es sich überzeugt haben wird, dass ihm diese nicht hilft, wieder die Ereignisse außerhalb derselben ihren Gang haben, und dieser wird kein friedlicher sein. Doch gewinnen wir von der Linken von Tag zu Tag mehr Boden, und vielleicht wird dann noch alles gut. Letzten Sonnabend haben wir einen großen Sieg erfochten, welcher die Nationalversammlung über alle Fürsten stellt. Sollten diese die Früchte des Sieges vereiteln wollen und blind sein, wie es die ganze Rechte ist, dann graben sie sich ihr eigenes Grab und legen den ersten Grundstein zur deutschen Republik. Das Streben nach Einheit ist jetzt das gewaltigste in Deutschland. – Die Fürsten stemmen sich dem entgegen, können aber eben dadurch zugrunde gehen, wie sie in ihrer alten Macht zugrunde gingen, als sie sich der Freiheitsidee entgegensetzten. Sie sind aber blind und sehen nicht ein, dass, wenn sie nicht ihre Souveränität der Oberhoheit des Frankfurter Parlaments unterordnen, die Einheit Deutschlands nur durch eine Föderativrepublik erzielt werden kann. Wenn der Herr die Könige verderben will, schlägt er sie mit Blindheit, heißt es in der Schrift, die im ganzen noch immer bessere Politik doziert als Dahlmann, Welcker und die anderen Doktrinäre, die wir in der Versammlung haben. Diese Doktrinäre, die am geschriebenen Wort und am Staatsrecht hängen wie die Kletten und nicht einsehen, dass die neue Zeit ein Volksrecht will und nicht ein Staatsrecht –, diese sind unser Unglück und machen, dass wir noch immer in der Minorität sind. Indessen, der Geist der Zeiten ist immer in der Minorität und siegt auch in der Minorität. Erst nach dem Siege tritt er in die Majorität – dann aber ist er schon veraltet und von einem neuen Zeitgeist verdrängt.
Aber, aber, aber!!! Da schreibe ich eine Abhandlung über Politik und soll und will Ihnen für Ihr liebes Schreiben und für die Einladung zum Balle danken. Wie gern hätte ich letztere angenommen, wenn sie nicht zu spät und zu einer anderen Zeit gekommen wäre. […]
Meine Herren! Es gibt Wahrheiten, die, wiewohl klar und sonnenhell wie der Tag, doch schon so oft besprochen worden sind, dass man sich eigentlich schämt, sie nochmals auszusprechen. Seit 60 Jahren wurde über den Adel und über die Abschaffung desselben speziell sehr viel gesprochen; der Adel ist eigentlich in der öffentlichen Meinung getötet, und gegen etwas Lebloses zu Felde zu ziehen, gibt das Ansehen eines Don Quixote. Wenn aber der Tod als ein Gespenst umhergeht, und es nur eines Wortes bedarf, um dieses Gespenst verschwinden zu machen, so ist es Pflicht, dieses Wort auszusprechen. Nur derjenige ist ein Staatsmann und imstande, Gesetze zu geben, nur derjenige ist ein wirklicher Politiker, welcher das Tote von dem Lebenden (scheidet), und der zu unterscheiden weiß, welche Zeit neu zu leben beginnt, und welche zu Grabe gegangen. Fürchten Sie nicht, meine Herren, ich werde mich nicht auf lange logische Beweisgründe einlassen, ich würde in jeder gebildeten Gesellschaft fürchten, sie zu beleidigen, wenn ich Dinge wie die Notwendigkeit der Abschaffung des Adels beweisen wollte, ich würde fürchten, die deutsche Nation zu beleidigen, denn davon, glaube ich, ist jeder Bauer überzeugt, dass der Adel tot ist. Die einzige Garantie für die Zukunft der Freiheit ist die Gleichheit; wer sich für bevorzugt hält, hält sich auch immer für höher und besser und glaubt, er sei berufen, den Anderen zu regieren, er kommt zur Logik des Caligula, der da sagt: Der Mensch ist ein ganz vortreffliches Geschöpf, ich muss aber viel besser sein als die übrigen, denn ich stehe weit höher, bin ein Gott. Der Adelige ist halb und halb auch so weit gegangen, er sagt: Ich bin aus viel edlerem und besserem Stoff, mein Fleisch und Blut ist edler und besser. Meine Herren! Jeder Physiologe könnte Ihnen vielleicht das Gegenteil beweisen. Die Akten über diesen Gegenstand sind, wie gesagt, geschlossen, und die ganze Geschichte, was man für und dagegen sagen kann, liegt in dem einzigen bekannten Satze: la force a fait le premier esclave, mais la méchanceté l’a continué¹. Wir sind aber keine niederträchtigen Sklaven, wir werden also auch den Adel nicht aufrechterhalten. Was will denn eigentlich der Adel in der heutigen Welt? Solange er ein Stand war, hatte er Pflichten, und er war nur ein Stand, weil er Pflichten hatte. In jetziger Zeit hat jeder dieselben Pflichten, und der Adel, der keine besonderen Pflichten hat, ist zu einer bloßen Kaste herabgesunken, und wir werden in dieser Beziehung nicht mit Ägypten und China gleichstehen wollen. Ich will nicht auf das alte banale Wesen zurückkommen, nicht von dem Bauernschweiß, nicht von dem Unwürdigen sprechen, welches darin lag, dass ein Stand dem anderen untergeordnet war, dass einer von dem anderen Vorrechte hatte. Das sind abgemachte Sachen. Ich könnte wohl die ganze Kette von Schlechtigkeiten von dem Mittelalter bis auf die neueste Zeit vor Ihnen aufwickeln. Ich will es aber nicht. Es könnte dies für Einzelne beleidigend sein, und die Sache gilt ja dem Stande. Ich könnte Ihnen sagen, wie der Adel, nachdem er im Mittelalter seine Bestimmung eingebüßt hat, herabgesunken ist zu den Lakaien und Intrigenmachern der Höfe, und wie er heutzutage so ganz und gar überflüssig wurde. Das sieht aber jetzt jeder ein, und ich will daher nur auf zwei Dokumente zurückkommen, die uns vorliegen, das eine die standesherrliche, das andere die Petition des Adels, die in letzter Zeit uns eingereicht wurde. Sehr bezeichnend für den Adel war es, dass er während dieser ganzen ungeheuren Bewegung sich niemals als Corporation, niemals überwiegend, sondern immer nur in wenigen Einzelnen dabei beteiligt hat. Jetzt, wo es gilt, ihm ein erbärmliches „von“ zu nehmen, kommt er vor und rührt sich, und bezeichnend für den Charakter desselben ist es, dass diese Herren sich einen Sachwalter wählten, der seine Feder schon den Feinden des Vaterlands geliehen hat. Die Adeligen, die sich um die Aufrechterhaltung des Adels verwenden, vertreten das Stabilitätswesen. Ob es nun aber ein großer Verdienst ist, das Stabilitätswesen zu vertreten, überlasse ich Ihrem eigenen Urteil. Wir gehen noch immer bergauf und brauchen keinen Hemmschuh, und wird es einmal bergab gehen, so haben wir genug Stabilität in unserem deutschen Wesen und unserer deutschen Gründlichkeit. Den Adel brauchen wir hierzu nicht. Bei Abschaffung des Adels helfen wir dem besseren Teil desselben über eine zweideutige und schiefe Stellung, worin er sich befindet, hinüber. […]
Zum Schluss erlauben ich mir, Ihnen nur noch eine kleine Fabel mitzuteilen: Ein verrostetes Schuld flehte zur Sonne: Oh Sonne, beleuchte mich! Diese sprach: Oh Schild, reinige dich! Unser Adel ins einer Ausnahmestellung und mit all den ungeheuren Vorwürfen, die auf ihm lasten, kann sich nur dadurch reinigen, dass er aus seiner Ausnahmestellung heraus zurückgehe in den heiligen Schoß des Volkes.
Wir reisten guten Mutes ab, wohl wissen, dass wir uns, wie Herr von Schmeling sagte, in Gefahr begaben. […]
Wir steigen aus, um etwas zu uns zu nehmen […], und schon hörten wir im Publikum hie und da unsere Namen flüstern und sahen mit Fingern auf uns deuten. Als wir einstiegen, hatte sich das Gerücht verbreitet, „die Mörder Lichnowskys“ seien da. Der Bahnhof wurde von Herbeiströmenden überfüllt, und durch die Menge drängten sich plötzlich von allen Seiten Offiziere hindurch. Wir hörten wohl manches Wort, das uns galt, und bemerkten die Aufregung, die in der Masse von Minute zu Minute wuchs. „Nur ruhig bleiben“, sagte Blum, „ich schlafe.“ So sprechend, zog er den Mantel über den Mund, legte sich eine Ecke und schlief. Ich beobachtete, was vor unserem Wagenfenster vorging. Ein Offizier nach dem anderen kam heran, starrte herein, betrachtete uns wie wilde Tiere, murmelte oder schimpfte etwas und ging weiter, um einem anderen Platz zu machen. Aber hinter den Offizieren stand eine bürgerliche Menge, die ruhig und beobachtend aus einiger Entfernung auf unsere Fenster und auf die Offiziere sah. Ich glaube, dass dort unsere Freunde standen; vielleicht wussten das auch die Offiziere, es blieb beim Gemurmel, beim Hin- und Hergehen, beim Hereinstarren, bis sich der Zug nach ungefähr einer halben oder dreiviertel Stunde in Bewegung setzte. Jetzt erst erhob sich ein hörbares Schimpfen, das für uns aber beim Lärm der Lokomotive unartikuliert blieb.
1 Hartmann schildert in diesem Auszug die Reise nach Wien im Zuge des Wiener Oktoberaufstands 1848 unter anderem zusammen mit Robert Blum und einen Vorfall am Bahnhof von Ratibor.
Deutsches Volk! Bis in die entferntesten Gaue Deines Landes ist der Name des Mannes gedrungen, der aus dem Arbeiterstande durch die Kraft seines Geistes sich emporgeschwungen hatte zu einem der vordersten Kämpfer für die heilige Sache der Freiheit.
Der beredte Mund, dessen Worte tief ergriffen, weil sie aus dem Herzen kamen, hat sich geschlossen; geschlossen durch eine Gewalttat, einen Mord, begangen mit kaltem Blute, mit Beobachtung sogenannter gesetzlicher Formen.
Du weißt, deutsches Volk, was dieser gemeuchelte Held Deiner jungen Freiheit für diese Freiheit getan. Klar in Gedanken, entschieden im Wollen, entschlossen im Handeln, trug er das Banner voran in dem Kampfe, in welchem er glorreich gefallen ist.
Was er getan während des Zeitraumes eines langen Druckes, was er gewirkt seit der Märzrevolution in dem Parlamente, in dem Fünfzigerausschusse, in der Nationalversammlung – mit unauslöschlicher Schrift ist es in aller Herzen eingetragen.
Die Begeisterung für die Sache der deutschen Freiheit und der Auftrag seiner politischen Freunde führte ihn nach Wien. Er focht an der Spitze des Elitekorps, dessen Führung ihm von dem Oberbefehlshaber anvertraut wurde. Als die Kapitulation Wiens abgeschlossen war, legte er die Waffen, die er mit Heldenmut geführt hatte, nieder. Vier Tage nach Beendigung des letzten Verzweiflungskampfes, an welchem er, dem gegebenen Wort treu, keinen Anteil mehr nahm, wurde er verhaftet. Man übertrat mit frechem Hohne das Gesetz, welches die Vertreter der deutschen Nation vor jeder von der Nationalversammlung nicht genehmigte Verhaftung schützen sollte und achtete der Berufung nicht, welche er, gestützt auf dieses Gesetz, gegen seine Verhaftung einlegte.
Deutsches Volk! Deine Ehre, Dein Recht trat man mit Füßen, als man Deinen Vertreter gegen das Gesetz verhaftete! Deiner Freiheit hat man eine tödliche Wunde geschlagen, als man einer Deiner würdigsten Söhne mordete!
Am vierten Tage seiner Verhaftung, acht Tage nach der völligen Einnahme Wiens, am 9. November, wurde Robert Blum standrechtlich in der Brigittenau erschossen!
Nicht in der Aufwallung tobender Leidenschaft, nicht in dem Getümmel des Kampfes wurde der Mord verübt; nein! Er wurde verübt von denjenigen, welche sich Werkzeuge des Gesetzes, Hersteller der Ordnung, Begründer gesetzlicher Freiheit nennen!
Deutsches Volk! Trauern wirst Du über den unersetzlichen Verlust, den Du erlitten! Vergiss des Toten nicht und erinnere Dich, wie er starb, für welche Sache er starb und durch wen er gemordet wurde!
Der Kaiser soll nicht erblich sein
Der Kaiser soll nicht sterblich sein
Und auch nicht lebensdauerlich,
und gar sechsjährigschauerlich!
Der Kaiser soll nicht wählbar sein
Und nicht vom Volkshaus quälbar sein.
Und auch nicht präsidentlich sein –
Was soll er sein, was soll er sein?
O Gott vom Himmel, sieh darein!
Der Kaiser soll kein Märker sein.
Und kein besoffener Beserker sein
Er soll als Andere nicht stärker sein,
Er soll kein halber Sklave sein,
Der Kaiser soll auch kein Bayer sein,
Er soll kein geflickter Dreier sein.
Der Kaiser soll auch kein Sklave sein,
Der Kaiser soll kein Freier sein;
Was soll er sein, was soll er sein?
O Gott vom Himmel, sieh darein!
Er soll ein Kaiser auf Miete sein,
er soll eine bloße Mythe sein,
Der wird von besonderer Güte sein –
Ein Kaiser der Verständigung,
ein Kaiser beliebiger Endigung
Und ohne Prinzipsversündigung,
Ein Vogtischer Kaiser auf Kündigung –
Das soll er sein, das soll er sein,
Ein Kaiser auf Kündigung soll es sein!
Mein verehrtes Fräulein!
[…] Die parlamentarischen Kämpfe, die leidenschaftlichen Ausbrüche in und außerhalb der Paulskirche, die vielerlei politischen Abenteuer und endlich de Reise nach Wien, die Belagerung, die großartigen Erlebnisse, der Fall der heldenmütigen Stadt, der Tod so vieler und edler Freunde – Sie selbst sind Dichterin – machen Sie aus all dem einen sehr spannenden, verwickelnden Roman, und lassen Sie aus allen Kämpfen den Helden verjüngt und froh hervorgehen, und Sie haben meine Geschichte und mich – und Sie werden selbst nicht mehr glauben, dass es Mangel an Teilnahme, Unempfindlichkeit für das Glück meiner Korrespondenz mit einer liebenswürdigen, geistreichen Dame – kurz, dass es irgendeiner geistiger oder seelischer Fehler sei, der mich so lange abhielt, Ihnen zu schreiben. – Ob es mit Frankfurt bald aus sein wird? Gewiss! Die Nationalversammlung ist eine Selbstmörderin, und sie kann bei dieser Zusammensetzung nicht anders sein. Es kursiert hier ein Verslein, das sie vollkommen charakterisiert:
75 Bürokraten –
Viele Worte, wenig Taten.
95 Aristokraten –
Armes Volk, du bist verraten.
130 Professoren –
Armes Deutschland, du bist verloren.
Und dazu die Klerisei –
Deutschland, du wirst nimmer frei!
Doch haben wir im Jahre 48 so viel gewonnen, dass die persönliche Freiheit gesichert ist, dass die Gesellschaft vollkommen regenerieren wird, wenn die Revolution auch darin ihren Zweck verfehlt hat, uns zu einigen und uns auch stark und frei nach außen zu machen. Auch das wird kommen, denn der Boden für die kommende Revolution ist frei und eben. Allerdings haben wir gebildeten Deutschen uns einen Augenblick eingebildet, dass wir eine gebildete Revolution ohne viel Blut werden zustande bringen können – aber die Fürsten wollen es nicht, und mein armes Vaterland wird trotz aller Bildung gezwungen sein, wie England und Frankreich durchs rote Meer ins Land der Freiheit zu ziehen.
Seit einigen Tagen macht hier ein kleines Büchlein in Versen, „Reim-Chronik des Pfaffen Maurizius“, ungeheures Aufsehen. Man spricht von nichts anderem, man kauft nichts anderes, man liest nichts anderes. Es ist in teils poetisch-pathetischem, teils humoristisch-satirischem Tone gehalten – jener behandelt die abgeschlossenen Tatsachen und Menschen wie Wien, Blum etc. – dieser die noch lebenden und wirkenden Persönlichkeiten wie Gagern, Kinkel, Schmerling etc. – Allgemein hält man mich für den Verfasser. Ich sehe keine Ursache (und habe keine) zu widersprechen und überlasse es jedem, nach dem Werte oder Unwerte des Büchleins zu urteilen, ob es wirklich von mir sei oder nicht. Bald wird ein zweites, drittes Heft folgen usf. Sie sehen, dass nicht alle Poesie unter dem Samum der parlamentarischen Debatte vertrocknet, und ich hoffe, sie soll es noch lange nicht.
Liebster Freund!
Hier hast Du einige von meinen Gedichten für die neue Ausgabe der polit. Lyrischen Dichter. Fratze und Biografie bekommst Du in den nächsten Tagen. Längst hättest Du alles erhalten, wenn Du nicht so traurige Fata gehabt hättest, die Dich von Deinen Freunden trennten. Vielleicht haben sie dazu beigetragen, Dich von der preuß. Kaiserleidenschaft zu heilen. Hier ist es wie immer öd und flach und schal und unersprießlich – man schämt sich, einander anzusehen, denn man fühlt, dass man unverdientes Brot fresse. Wir Österreicher betrachten das Parlament nur noch als Asyl, und viele bleiben nur aus dieser Rücksicht darin – Es geht nur mit einer Revolution und nicht anders – Die Fürsten wollen es so, und ihr Wille gab in Deutschland immer den Ausschlag. Lebe herzlich wohl. – Der erste Teil meiner Reimchronik, die ich herausgebe, macht hier angeheures Aufsehen.
Mein verehrtes Fräulein!
[…] Die Sachen stehen schlecht in Deutschland, so sehr schlecht, dass sie über Nacht gut werden können. Dieses aber will ich abwarten und meine teure Mutter in ihrer Krankheit nicht verlassen. Entweder wir machen binnen Wochen eine ganz fürchterliche Revolution, oder wir fallen in einen Zustand zurück, der unerträglicher sein wird als der vormärzliche. Den einen Trost haben wir, dass sich die Monarchie so gründlich zugrunde gerichtet hat, wie es kein Radikalismus der Welt vermocht hätte, und da wir den frommen Glauben haben, dass sich nichts mehr halten kann, was der allgemeinen Meinung und Überzeugung zuwider ist, so haben wir auch die Hoffnung, dass manches Böse unwiederbringlich verloren ist. – Allein die Weltgeschichte macht kleine Schritte, besonders in Deutschland, und rechnet nach Jahrzehnten und Jahrhunderten – also ist es möglich, dass die schwarze Woge noch über unsern Häuptern hinweggeht.
[…] In England kann man allerdings Manches lernen, was einst dem Vaterlande nützen kann. - Doch nein! - Während ich diese Worte schreibe, fühle ich, dass ich konventionell u. nicht ganz aufrichtig bin. - Man kann hier nur negativ lernen, denn trotz der Größe, der ungeheuren Macht, die den Fremden hier bei jedem Schritte in die Augen fällt - ich möchte mein Vaterland nicht zu einem England machen. - Bei all dieser Größe und Macht überfällt mich hier oft der traurige Gedanke, dass es im Leben der Völker wie im Leben der Individuen gilt; nur der Bornierte, nur der Fachmensch mit Augenklappen, der nicht nach Rechts, nicht nach Links sieht, kann es zu etwas bringen. Die Engländer sind wirklich borniert - sie sind es in politischer, sozialer und religiöser Beziehung. - Die ganze Nation besteht aus Schichten, die wie Aluviane aufeinander liegen und drücken. Nur der Druck verbindet sie. (Jede untere Schichte drängt freilich wieder nach oben, aber nicht vulkanisch, um zu regenerieren, sondern um mit von oben nach unten zu drücken. - So ist denn oben Alles verwittert und unten Alles zerbröckelt. - Auch mit den vielgepriesenen »Reformen zur rechten Zeit«, die die Revolution überflüssig machen, ist es nicht so arg - sie sind am Ende doch nur der Fortschritt der Gefangenen mit den Ketten an den Füßen, welche historisches Recht, Religion, Heuchelei etc. heißen. - Kurz, es ist doch wahr, wie lächerlich es auch klingt: Wir sind im Grunde freier als alle Völker der Erde! Trotz Erfurt, Interim, 34 Fürsten und Österreich und Preußen! - Das wäre ein Trost, wenn es nicht so wenig und wenn Unser Eins nicht ein Bürger aller unterdrückten Völker wäre. […]
[…] Vogt habe ich in letzter Zeit wenig gesehen. Seine Politik ist nicht die meine; sie ist mir zu politisch. Wenn ich auch einsehe, dass ein gewisser Monsieur. [Napoleon] manches Gute schafft, während er nur das Böse will, so kann ich doch nicht in Allem u. Jedem u. gegen die ganze Welt für ihn Partei ergreifen. Und wenn auch den Deutschen eine Züchtigung vielleicht gut ist, so kann ich mich doch nicht darauf freuen, dass diese Züchtigung kommen soll u. zwar von Ihm. Bei all den Regungen in der ganzen Welt ist es mehr [mir] doch ganz traurig zu Mute. Von Demokratie ist doch eigentlich nirgends die Rede: höchstens erbärmlicher Konstitutionalismus, in den sich überall mit Leichtigkeit der Imperialismus als faux frere¹ der Freiheit infiltriert. […]
1 Übersetzung: Falscher Bruder
[…] Fortwährend musste ich an den Schulmeister gedenken, den wir am selben Tage in einem Gasthause auf Badener Gebiete getroffen hatten. Er war sonntäglich gekleidet und machte kein Hehl daraus, dass er dem Großherzog nachziehe, ja er proklamierte es laut, so oft er glaubte, dass Revolutionäre in der Nähe seien, offenbar wünschend, von ihnen seiner großherzoglichen Treue wegen misshandelt oder zurückgehalten zu werden. Es zog ihn nicht im Geringsten zum Großherzog; er war mit ganzer Seele bei dessen Feinden, und einmal, in einem ekstatischen Zustande, stieß er ein brünstiges Gebet für die Revolution und die Verfassungskämpfer aus. Weinend aber versicherte er, es bleibe nichts Anderes übrig, als mit dem Großherzog Frieden zu machen, weil Alles verloren sei. Dieser Schulmeister war mir das trübe Bild des deutschen Volkes. Weiterlesen
Im Gasthause zu Heilbronn sahen wir zwei reisende junge Mädchen, deren eines als Mann verkleidet war. Höchst wahrscheinlich auf der Flucht und schutzlos, wie sie waren, schufen sie sich auf diese Weise einen fingierten Schutz. Sie hatten nichts Abenteuerliches in Wesen und Benehmen, und man sah es ihnen an, dass nur die Noth sie zu solcher nicht ganz weiblichen List gezwungen hatte. Alle Anwesenden, samt den Wirtsleuten, gingen stillschweigend auf ihre Absichten ein, obwohl Niemand auch nur einen Augenblick getäuscht war. […]
In Heilbronn, wo sich indessen mehrere Abgeordnete gesammelt hatten, wurden wir mit großen Volksdemonstrationen empfangen, denen am nächsten Tage noch andere und größere folgten, und an denen auch die Bürgerwehr Teil nahm. Indessen erinnere ich mich nicht mehr an die Einzelheiten, die diese bezeichneten, da die damalige Zeit an solchen Äußerungen reich und diese einander meist sehr ähnlich waren. Ich weiß nur, dass uns der Empfang in Heilbronn einen Eindruck machte, der uns zu dem Glauben berechtigte, dass wir in Württemberg willkommen seien und dass das württembergische Volk aufrichtig und mit Wärme an der Reichsverfassung hänge. Viele ausgezeichnete Württemberger, darunter Mitglieder des Landesausschusses, Kammerabgeordnete und Schriftsteller, kamen uns von Stuttgart aus entgegen, und mit diesen bestiegen wir einen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen, Blumen und Girlanden geschmückten Eisenbahnzug, um uns in die Hauptstadt zu begeben. […]
Die große Mehrheit war von unserm Rechte durchdrungen, voll Achtung für uns, als die Vertreter der Nation und zwar als das kleine Häuflein von Vertretern, das in diesem kritischen Momente aushielt, während die große Mehrzahl auf Befehl oder Drohungen der Regierungen auseinander stob und die Fahne der Nation schmählich im Stiche ließ. Von unserem Rechte, und ich darf wohl sagen, von dem Achtungswerten unserer Lage, war Jedermann durchdrungen; wagte doch selbst die Regierung in ihrer Proklamation weder das Eine noch das Andere zu leugnen; aber die Stadt war ruhig, und wir brachten vielleicht die Revolution, wir brachten vielleicht Straßenkampf, eine neue Krise und eine Zukunft voll Unsicherheit.
Nicht Alle, die für das Recht waren, waren zugleich für einen Kampf um dieses Recht und alle aus einem solchen Kampfe entspringenden Möglichkeiten. Die Begeisterung, die Ehrerbietung, die man uns zeigte, hatte etwas Gedrücktes, so wie bei aller Bewegung, die wir brachten, die ganze Atmosphäre nicht aufgeregt, gewitterhaft wurde, sondern ohne Schwüle gedrückt blieb. Ein großer Teil der Einwohner dieser Stadt, welche sich damals noch nicht, wie das heute der Fall ist, durch Handel und Gewerbe unabhängig gemacht hatte, hing mit dem Hofe zusammen und lebte vom Hofe. Dieser Teil war uns ausgesprochen feindlich; dieser betrachtete uns mit düstern Blicken, während der andere, wenn auch mit Sympathie, doch zugleich melancholisch zu uns herübersah. Dies ist die Wahrheit über die damalige Stimmung in Stuttgart, wenn auch der Enthusiasmus, der uns in den nächsten Kreisen umgab, manchem Abgeordneten vielleicht ein anderes Bild in der Erinnerung zurückließ. […] Die dieser Erfahrungen war die, dass mehrere Städte, die sich eifrig für die Reichsverfassung gezeigt hatten, plötzlich lau wurden, als sie zu merken glaubten, dass sie durch die Grundrechte gewisse aus alten reichsstädtischen Zeiten herabgekommene Privilegien, die ihnen einen Teil ihrer Einkünfte sicherten, verlieren könnten. […]
Am 6. Juni morgens neun Uhr versammelten wir uns auf dem Rathause, um uns von da nach der württembergischen Kammer zu begeben. Bürgerwehr bildete den ganzen Weg entlang ununterbrochene Spaliere, und hinter diesen drängte sich das Volk, um uns durch Zuruf zu begrüßen und zu ermuntern. Der kleine Saal der württembergischen Kammer war groß genug, um die deutsche Nationalversammlung, welche einst in den weiten Räumen der Paulskirche kaum Platz hatte, bequem zu beherbergen. […]
Löwe von Calbe wurde zum Präsidenten gewählt, und es begannen sofort die Debatten, welche die Schöpfung eines neuen Mittelpunktes, einer neuen Zentralgewalt zum Zwecke hatten. Der Reichsverweser konnte als Vertreter der Zentralgewalt von uns nicht anerkannt werden; er hatte keine der Pflichten erfüllt, die er beschworen, und die Gewalt, die man ihm anvertraut hatte, gegen die Nation gekehrt, die ihn an die Spitze gestellt. Wir waren mehr als berechtigt, wir waren verpflichtet, diese Zentralgewalt als null und nichtig wenigstens zu erklären, und es war geboten, eine neue zu schaffen, für den Fall, dass ihr noch irgendeine Wirksamkeit gegönnt wäre. […]
Am 17., spät abends erhielt der Präsident Löwe von Calbe im Namen des Gesamtministeriums ein von Herrn Römer unterzeichnetes Schreiben, in welchem dieser verkündigte, „dass das Tagen der hierher übergesiedelten Nationalversammlung und das Schalten der von ihr am 6. d. Mts. gewählten Reichsregentschaft in Stuttgart und Württemberg nicht mehr geduldet werden könne.“ Die Zuschrift enthält noch immer eine Anerkennung des Rechtes, kann sich aber trotzdem hie und da eine gegen die Nationalversammlung gerichtete höhnische Bemerkung nicht versagen. […] Der Präsident wollte sich hierauf mit den Schriftführern in das Sitzungslokal begeben, um es vor Eröffnung der Sitzung, welche um drei Uhr beginnen sollte, in Besitz zu nehmen, aber schon um ein Uhr wurde er benachrichtigt, dass das Haus bereits von Militär besetzt sei. […] Wir versammelten uns unter den Bäumen eines gewissen Platzes, den ich, bei meiner damaligen Unbekanntschaft mit der Stadt, nicht näher bezeichnen kann, und setzten uns von da aus in Bewegung. An unserer Spitze schritt der Präsident, ihm zu Seiten zwei Prytanen Deutschlands, die beiden Greise Albert Schott und Ludwig Uhland, zwei Männer, die ein ehrenvolles, fleckenloses, langes Leben hinter sich hatten, dass nur dem Kampfe für das Recht, für das Gute und Schöne gewidmet war und dass sie auch jetzt, ohne Zaudern der Ungewissheit, einer drohenden Gefahr ruhig und schlicht entgegentrugen. […] Sollte man nicht meinen, dass ein Recht, das von zwei solchen Zeugen begleitet auftritt, von aller Welt erkannt werden müsse? Man sollte es meinen, wenn man nicht wüsste, dass der Eigennutz sich um das Recht und seine heiligsten Zeugen nicht kümmert und dass er, um es zu besiegen, die Gedankenlosigkeit als Mittel gebraucht. Unmittelbar hinter dem Präsidenten und den beiden Greisen ging ich, Arm in Arm mit meinem Freunde Ludwig Simon, kann also als Augenzeuge über die letzten Momente des Parlamentes berichten. Ich wusste, dass wir unserm Ende entgegengingen, und das dicht gedrängte Volk, rechts und links an unserm Wege, flößte mir, trotz aller Zurufe, kein Vertrauen ein. Durch die natürlichste Ideenassoziation erinnerte ich mich jenes andern Ganges vom Römer in die Paulskirche bei Eröffnung des Parlamentes – als alle Häuser mit Flaggen und Blumen geschmückt waren, aus allen Fenstern Jubelrufe erschollen, die Musik „Nur gewagt, unverzagt“ aufspielte und Aller Herzen voll großer Hoffnungen waren. Nun will ich es offen gestehen, dass ich mich damals in Frankfurt nicht so gehoben fühlte, wie auf diesem letzten Gange des Parlamentes, der einem Gange zum Schafott glich. Wir kamen in eine Straße, in der wir das Militär, Infanterie, aufgestellt sahen; während links in einer Seitenstraße Kavallerie wartete. Wir setzten unsern Weg fort, als ob jenes Hindernis vollkommen unsichtbar wäre, und kamen so an die Reihen der Soldaten, welche die Straße, die zum Sitzungslokale führte, absperrten. Der Präsident mit seinen beiden Begleitern war eben bis auf ungefähr zwei Schritte Entfernung den Soldaten nahe gekommen, als sich deren Reihen plötzlich öffneten und ein älterer Mann mit weißer Binde und einem Papier in der Hand heraustrat und dem Präsidenten verkündete, dass er als Zivilkommissar den Auftrag habe, zu erklären, dass keine Sitzung gehalten werden dürfe. Der Mann – Cammerer hieß er – war blass, und seine Stimme zitterte, wie eines Verbrechers. Kaum hatte er seine Worte hervorgestoßen, als er schon wieder hinter den Soldaten verschwand. Ich glaube, dass er nur noch die Worte „mein Auftrag ist erfüllt“ hervorstotterte. Der Präsident erhob seine klangvolle Stimme und rief: „Ich erkläre“ – hier aber wurde er von Trommelwirbel unterbrochen, wie ein Delinquent, den man nicht zu Worte kommen lässt. Trotzdem rief der Präsident dem Zivilkommissar zu: „Sie müssen mich hören!“ und als dieser verschwunden blieb, erhob er die Stimme noch einmal und rief: „Ich protestiere gegen dieses Verfahren, als gegen einen Verrat an der Nation!“ und die Worte wurden gehört, trotzdem die Trommelwirbel immer stärker wurden und trotz dem Waffengeklirr. Die meisten Abgeordneten hatten sich indessen nach vorn gedrängt und standen in kompakter Masse vor den Soldaten. Eine kleine Episode, die in diesem Momente spielte, scheint von nur sehr Wenigen, vielleicht nur von mir bemerkt worden zu sein, da ich sie in den zahlreichen Berichten, die später im Hotel Marquart erstattet wurden, nirgends erwähnt finde.
Zivilkommissar Cammerer, nachdem er hinter den Soldaten verschwunden war, kam auf einen Augenblick wieder zum Vorschein, wandte sich an Ludwig Uhland und sagte ihm, dass, wenn er allein eintreten wolle, ihm der Weg offen stehe. Ich werde die Gebärde der Verachtung, das wegwerfende Achselzucken, mit dem sich Uhland von ihm abwandte, nie vergessen und ich glaube, dass selbst Herr Cammerer, obwohl ein Mann, der sich zu einem solchen Amte hergegeben, diesen Moment ebenso wenig vergessen werde. Mittlerweile, da die Abgeordneten sich an die Soldaten herangedrängt hatten, kommandierte man „Fällt das Bajonett“ – aber sie gehorchten nur zur Hälfte. Ich bemerkte, dass ein einziger Soldat das Bajonett so weit sinken ließ, dass es Einen der Herandrängenden beschädigen konnte. Dieser Eine hatte offenbar den besten Willen, sein Bajonett in Blut zu tauchen; seine Bewegungen, wie der Ausdruck seines Gesichtes verrieten es zu deutlich. Die Anderen aber waren unschlüssig und sahen niedergeschlagen vor sich hin. General Miller bemerkte das wohl ebenso gut wie ich, rief dem Präsidenten, der unbeweglich stand, ein „Fort!“, dann einem Offizier in der Seitenstraße ein Kommandowort zu, und in demselben Augenblicke sprengte die Kavallerie auf uns ein, während der Offizier, der sie führte, „Einhauen!“ kommandierte und die anderen Offiziere fortwährend „Haut zu! Haut zu!“ ausriefen. Doch muss ich der Gerechtigkeit wegen hinzufügen, dass ich einen Offizier selber sah, der einem Kavalleristen, welcher auf den Abgeordneten Günther einhauen wollte, in den Arm fiel. Der Abgeordnete Günther nämlich, als die Kavallerie herbeisprengte, warf sich ihr entgegen, riss seine Kleider auf und außer sich rief er den Heransprengenden entgegen: „Haut zu!“
Im Allgemeinen aber hatten auch die Kavalleristen, trotz der beständigen Aufmunterung der Offiziere und Unteroffiziere, nicht die geringste Lust zum Einhauen. Sie taten nur so und schwenkten, indem sie in unsere Schar hineinritten und uns trennten, ihre Säbel über unseren Köpfen. Der Präsident selbst war in Gefahr niedergeritten zu werden. Es lag also nach alldem weder an Herrn Römer noch an dem guten Willen der württembergischen Offiziere, dass das Parlament ein unblutiges Ende nahm. Hätten die Soldaten gehorcht, ihre große Anzahl hätte unser kleines Häuflein binnen fünf Minuten bis auf den letzten Mann niedermetzeln können. Das Volk drängte sich mit in das Gewirre, und die Erkenntnis von der Stimmung der Soldaten, die man sofort gewinnen musste, war wohl mit eine der Ursachen, dass es zu keinem weitern Konflikte kam.
Bei dem Gedränge von Abgeordneten, Soldaten und Volk, bei der Verwirrung war es nicht möglich uns wieder zusammenzufinden und an Ort und Stelle etwas Gemeinschaftliches zu beginnen. „Nach dem Hotel Marquart!“ rief ein Abgeordneter dem andern zu, und in der Tat fanden wir uns dort zur selben Stunde zusammen, auf welche die Sitzung in der Reitschule angesetzt war. Aber wir zählten uns – unsere Zahl belief sich nur noch auf 94 – wir waren nicht mehr beschlussfähig – die Nationalversammlung war gestorben oder, wenn es besser klingt, hingerichtet.
1 Erschienen in der Zeitschrift: „Die Gartenlaube“, Heft 3, S. 40-44, Leipzig 1863.
Kelch und Schwert. Dichtungen, Leipzig 1845.
Neuere Gedichte, Leipzig 1847.
Reimchronik des Pfaffen Maurizius, Frankfurt a.M. 1849.
Der Krieg um den Wald. Eine Historie, Frankfurt a.M. 1850.
Gedichte, Braunschweig 1858.
Novellen, 1. Teil: Der Zweck heiligt die Mittel – Gräfin Sassari – Bei Kunstreitern – Selvaggia – Ein italienischer Priester – Doctor Schwan – An der Spielbank, Hamburg 1863.
Novellen, 2. Teil: Zwanzig Millionen – Verrechnet – Feigheit – Der Hetmann – Tante Helene, Hamburg 1863.
Novellen, 3. Teil: Der Gefangene von Chillon, Hamburg 1863.
Wilhelm Tell. Eine Erzählung, in: Berthold Auerbach’s deutscher Volkskalender, 1864.
Die Rheingrenze. Eine patriotische Erzählung, in: Berthold Auerbach’s deutscher Volkskalender, 1865.
Die letzten Tage eines Königs, Historische Novelle, Stuttgart 1866.
Nach der Natur. Novellen, 1. Teil: Die Ausgestoßenen – Rostet nicht – Die Gypsfigur – Eine Modenesische Geschichte, Stuttgart 1866.
Nach der Natur. Novellen, 2. Teil: Der Flüchtling – Eine Stunde im Leuchtthurm – Nein – Deutsch, Französisch, Englisch – Die letzte Montanini, Stuttgart 1866.
Nach der Natur. Novellen. 3. Teil: Der goldene Schlüssel – Das Schloß im Gebirge – Eine Entführung in Böhmen – Eine Mutter – Die Brüder Mathieu, Stuttgart 1866.
Die Diamanten der Baronin. Roman, Band 1 & Band 2, Berlin 1868.
Revolutionäre Erinnerungen, hg. von Heinrich Hubert Houben, Leipzig 1919, niedergeschrieben 1861.
Gesammelte Werke, Band 1 (Der Vormärz und die Revolution) & Band 2 (Exil und Heimkehr), hg. von Otto Wittner, Prag 1906-1907.
Baus, Martin: Moritz Hartmann, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte der demokratischen und liberalen Bewegung in Mitteleuropa, Band 2 / Teil 1 (Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle „Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850, Band 39), hg. von Helmut Reinalter, Frankfurt a.M. 2005, S. 132f.
Best, Heinrich / Weege, Wilhelm: Hartmann, Moritz, in: Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49 (Handbücher zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 8), Bonn 1996, S. 168f.
Haacke, Wilmont: Hartmann Moritz, NDB (Band 7), Berlin 1966, https://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016325/images/index.html?id=00016325&groesser=&fip=eayaqrsweayaqrsxsxdsydsdasewqeayaxdsydsdas&no=1&seite=751.
Hiller, Ferdinand: Hartmann, Moriz, in: ADB (Band 10), Leipzig 1879, https://de.wikisource.org/wiki/ADB:Hartmann,_Moritz.
Laß, Hans: Moritz Hartmann. Entwicklungsstufen des Lebens und Gestaltwandels des Werkes, Diss., Hamburg 1963.
Neumann, William: Moritz Hartmann. Eine Biographie, Diss., Kassel 1854.
Oberhauser, Claus: Moritz Hartmann, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte der demokratischen und liberalen Bewegung in Mitteleuropa, Band 2 / Teil 2 (Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle „Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850, Band 43), hg. von Helmut Reintaler, Frankfurt a.M. 2011, S. 40f.
Wittner, Otto: Moritz Hartmanns Jugend, Diss., Bern 1902.
Wir nutzen Cookies und ähnliche Technologien, um Geräteinformationen zu speichern und auszuwerten. Mit deiner Zustimmung verarbeiten wir Daten wie Surfverhalten oder eindeutige IDs. Ohne Zustimmung können einige Funktionen eingeschränkt sein.