
ROBERT BLUM
Abb.: Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig (XVb/58)
Am frühen Morgen des 9. November 1848 erfährt Robert Blum, dass das gegen ihn verhängte Todesurteil vollstreckt wird. Auf den Beistand eines Priesters verzichtet er und schreibt stattdessen noch schnell einige Briefe: „Es ist 5 Uhr und um 6 werde ich erschossen. Ich sterbe als Mann – es muss sein.“
Ein tragischer und folgenschwerer Verlust für die deutsche Demokratiebewegung. Tragisch deshalb, weil der mitreißende Redner und allseits geschätzte Politiker stets gegen jede Gewalt eingetreten war und sich nun, während er als führender Abgeordneter der deutschen Nationalversammlung eine Solidaritätsadresse an die Wiener Aufständischen überbringen wollte, von der Atmosphäre hatte überwältigen lassen und sich an den Kämpfen beteiligte, nach deren Niederschlagung er, trotz Immunität, verhaftet wurde; folgenschwer, weil das gerade erkämpfte Parlament in Deutschland seinen vielleicht bedeutendsten Vertreter verlor. Und genau das war das Kalkül des kaiserlichen Militärs. Überall in Europa stemmten sich die Adelshäuser gegen den demokratischen Wandel.
Mit der Hinrichtung von Robert Blum wollte man ein Exempel statuieren. All das, wofür er stand – politische Mitbestimmung aller Bürger, parlamentarische Verfassung und Rechtsstaatlichkeit, sozialer Ausgleich und freier Zugang zur Bildung –, sollte geschwächt werden. Und wurde geschwächt. Doch seine Ideen, davon war Blum überzeugt, würden sich auf Dauer nicht aufhalten lassen. Er sollte Recht behalten, wenn auch mit großer Verzögerung. Genau 70 Jahre nach seinem Todestag, am 9. November 1918, wurde von Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht die erste deutsche Republik ausgerufen.
Am 10. November 1807 wird Robert Blum in Köln geboren. Der Vater, Engelbert, arbeitet in einer Stecknadelfabrik, die materiellen Verhältnisse sind äußerst bescheiden.
Als im Juni der Vater stirbt, verschlechtert sich die Lage dramatisch, die Armut wird drückend. Trotz offenkundiger Begabungen muss Robert die Schule verlassen, um die Familie, er hat zwei jüngere Geschwister, zu unterstützen.
Nach Gelegenheitsarbeiten, einer Ausbildung zum „Gelbgießer“ und den darauffolgenden Wanderjahren, die Walz, in denen er sich autodidaktisch fortbildet, kommt Blum nach Berlin und wird dort Gasthörer an der Universität, wo er auf ihn prägende Denker wie Friedrich Schleiermacher, Georg Friedrich Wilhelm Hegel oder Leopold von Ranke trifft.
1832 folgt Blum dem bisherigen Kölner Theaterdirektor Ringelhardt nach Leipzig und wird Theatersekretär, ein Glücksfall, weil ihm die Stücke und die Theaterbibliothek reiche Möglichkeiten zur weiteren Selbstbildung geben. Er beginnt zu publizieren.
Blum schreibt nun regelmäßig für die „Sächsischen Vaterlands-Blätter“, ein Sprachrohr der linken Opposition in Sachsen. Meinungs- und Pressefreiheit, soziale Gerechtigkeit und eine nationale und demokratische Einheit sind seine bevorzugten Themen.
Für das von Blum von nun an jährlich herausgegebene „Vorwärts! Volks-Taschenbuch“ schreibt er selbst zahlreiche Artikel. Sowohl die Bücher als auch die „Vaterlands-Blätter“ sind ständig von der Zensur bedroht; die Zeitung wird 1845 verboten.
Als im August der sächsische Prinz Johann das politisch unruhige Leipzig besucht, kommt es zu Demonstrationen, die vom königlichen Militär gewaltsam beendet werden. Tags darauf versammeln sich Tausende Demonstranten und fordern Vergeltung. Robert Blum tritt auf die Tribüne und mahnt zur Besonnenheit. Mit Erfolg. Im gleichen Jahr wird er mit der höchsten Stimmzahl aller Bewerber zum Leipziger Stadtverordneten gewählt.
Im Mai 1848 schicken ihn die Leipziger dann auch als ihren gewählten Abgeordneten in die Nationalversammlung nach Frankfurt. Dort wird Blum zum Sprecher der demokratischen Linken.
Im Oktober 1848 kommt es in Wien zu einem revolutionären Aufstand. Als Leiter einer Delegation der Linken aus der Nationalversammlung reist Blum dorthin, lässt sich von der Atmosphäre mitreißen und greift selbst zur Waffe. Der Aufstand wird niedergeschlagen, er selbst verhaftet und am 9. November trotz seiner Immunität als Abgeordneter standrechtlich erschossen.
Die Revolution ist beendet, die Nationalversammlung löst sich auf. Die Verfassung, an der Blum mitgearbeitet hatte, bleibt für lange Zeit nur ein Versprechen.
Gabriele Gillen
Robert Blum: Kein Mann zum Verlieben! „Denkt euch eine platte, sattelförmige Nase, zwei kleine graue, tiefliegende Augen, eine flache holprige Stirn, einen Mund, der sich unter der Nase in sich selbst verkriecht und einen struppigen, urwalddichten rotblonden Bart, und ihr habt ungefähr einen Umriss des Blumschen Kopfes. Und dieser Kopf scheint gar nicht, wie bei anderen Sterblichen, an seinem Hals zu sitzen, sondern ist unmittelbar zwischen die breiten Schultern gequetscht“, so war es 1848 in der von Ludwig Kalisch gegründeten Sonntagszeitung „Der Demokrat“ zu lesen.1 Das ist nicht sonderlich schmeichelhaft, aber es ist auch nicht hämisch gemeint: „Übersichten über gewisse Entwicklungsperioden der Zeit knüpfen sich am bequemsten an Personen an. In der Persönlichkeit ist ein Bleibendes, während die Ereignisse vergehen. (...) Männer, in denen der Geist der Zeit Fleisch geworden ist.“ Eine Formulierung, die gut zu dem politischen Dschungelkämpfer Robert Blum passt. Tatsächlich verkörpert er unsere demokratische Gründerzeit; die revolutionären Träume von einer Republik, in der die Bürger- und Menschenrechte für jeden und jede gelten; von einem für alle verlässlichen Rechtsstaat; von einem Europa, in dem freie Völker in Frieden zusammenleben. Denn: „Was wäre auch die Freiheit, wenn sie nicht jedem Menschen und jeder Meinung vergönnt sei?“2 Robert Blum: Ein Mann zum Verlieben! Weiterlesen
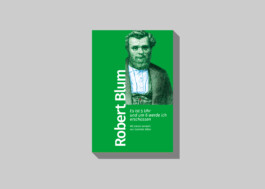
Robert Blum
Es ist 5 Uhr und um 6 werde ich erschossen
Erschienen am 09.02.2023
Taschenbuch mit Klappen, 192 Seiten
€ (D) 14,– / € (A) 14,40
ISBN 978-3-462-50003-5
Wer sich mit seinem Leben, seinen Kämpfen, mit seinen Texten, Reden und Briefen beschäftigt, entdeckt einen wilden, abenteuerlustigen Geist; eine immer wache Beobachtungsgabe; die funkelnde Freude an der Sprache und am Denken; den Mut für Aufbruch und Wandel; den Mut, im stürmischen Gegenwind seinen Überzeugungen treu zu bleiben. Und einen heute kaum noch zu erlebenden fröhlichen Glauben an die Zukunft. „Die Zeit, in der wir leben, ist eine der schönsten und größten, die es je gegeben. (...) Alles will mit Kraft vorwärts“, schrieb Blum 1840.3 Und verkörpert mit diesem Glauben, mit dieser Hoffnung auch den Geist der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Überall brach das Neue herein. Mit den Ideen der französischen Revolution – „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ – hatte in Europa eine neue politische Zeitrechnung begonnen; die Selbstverständlichkeit, mit der sich Kaiser und Könige über Jahrhunderte als gottgewollte Herrscher dargestellt hatten, wurde allerorts hinterfragt; die miteinander vernetzten und verschwägerten europäischen Königshäuser mussten Antworten finden auf den wachsenden Nationalismus, also auf die Forderung nach souveränen Staaten; die von England ausgehende Industrielle Revolution mit ihren neuen Herstellungsmethoden, Transportmitteln und technischen Errungenschaften wälzte die Wirtschaft um und schuf über den Besitz oder Nichtbesitz von Produktionsmitteln eine neue Klassengesellschaft, auch mit der Möglichkeit von Auf- und Abstieg; neben der Innerlichkeit und der Naturschwärmerei waren das Individuum und die Freiheit zentrale Begriffe der Romantik, der künstlerischen und intellektuellen Bewegung jener Zeit, Malerei oder Theater lösten sich aus ihren Abhängigkeiten von den Fürstenhäusern und suchten nach Autonomie; die Erfindung der Schnellpresse ermöglichte das Drucken und Verbreiten zahlreicher politischer Schriften und das Überlisten der überall herrschenden Zensur: kaum war eine Zeitung, war eine Buchreihe verboten, erschien unter einem anderen Namen eine neue Publikation derselben Herausgeber.
Aufbruch und Wandel waren die Stichworte der Zeit. Während der Adel auf die Rückkehr der guten alten Vergangenheit hoffte, wurden die Umbrüche in den bürgerlichen Kreisen als Chance für die Gestaltung einer neuen Gesellschaft gesehen. Damit einher gingen Forderungen nach einer breiteren Bildung, nach einer Förderung des Einzelnen. Hinter dieser Idee steckte auch die Vorstellung, durch mehr Bildung mehr Leistung und durch mehr Leistung mehr Besitz oder Reichtum zu erreichen – zur Abgrenzung nach unten von den armen Industrie- oder Landarbeitern, aber auch als Kampfansage an das Geburtsvorrecht des Adels, dem seine Privilegien selbst dann garantiert waren, wenn er – wie es der Schriftsteller Lorenz von Westenrieder formulierte – an „tierischer Unwissenheit und Dummheit“ litt.4 Und Robert Blum wird 1848 in dem von ihm herausgegebenen „Volksthümlichen Handbuch der Staatswissenschaften und Politik“ über Bildung schreiben: „Wie die Sonne des Himmels für jeden da ist, der hinaustreten und sich ihrer erfreuen will, so muss das Licht des Geistes, welches die Bildung fördert und ausbreitet, jedem zugänglich sein.“
Davon konnte Robert Blum selbst, geboren 1807 im damals zum Kaiserreich Frankreich gehörenden Köln, nur träumen. Zwar hatte ihm der bildungsinteressierte Vater vor seinem frühen Tod noch Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht, doch Not und Armut ließen nur einen kurzen Schulbesuch zu. (Kinder-)Arbeit statt Bildung. Ein Leben lang, so schreibt der Blum-Biograph Ralf Zerback, habe Robert Blum darunter gelitten, dass er nur eine kurze Zeit zur Schule gehen konnte.5 Doch sein Bildungshunger, gepaart mit einer im frühen Überlebenskampf erworbenen Zähigkeit, suchte sich andere Wege, Wissen zu erwerben. Auf den jahrelangen Wanderjahren als Gelbgießergeselle und später als Angestellter der Kölner „Gesellschaft zur Beleuchtung der Städte“, die Straßen und Parks illuminierte, reiste er zu Fuß oder später mit der Kutsche in fast alle Fürstentümer und freien Städte Deutschlands. Er verfasste immer lebendiger werdenden Reiseaufzeichnungen, schärfte seinen Blick für Kultur, Architektur und soziale Zustände und suchte unterwegs alle erreichbaren Bibliotheken auf, außerdem Theater und Museen. Er las in jeder freien Minute; Tag für Tag, Nacht für Nacht erweiterte er seinen Wortschatz und seine Kenntnisse der belletristischen, philosophischen oder naturwissenschaftlichen Literatur. Im August 1830 kehrte er zurück nach Köln, wo er am Stadttheater eine Stelle als Theaterdiener fand. Das war zwar die unterste Stufe der Hierarchie, aber Intendant Friedrich Sebald Ringelhardt erlaubte ihm die Nutzung der Theaterbibliothek. Blum studierte, so weit vorhanden, die gesamte dramatische Literatur. Und entdeckte Friedrich Schiller, der ihn nachhaltig begeisterte und aus dessen Werken er zu lernen suchte, wie eine politische Botschaft in die Herzen und Köpfe der Menschen zu pflanzen sei.
1813 war die französische Armee in der blutigen Völkerschlacht bei Leipzig, der entscheidenden Schlacht der Befreiungskriege, besiegt worden, Napoleon musste sich aus Deutschland zurückziehen. 1815 beschloss der Wiener Kongress im Rahmen der territorialen Neuordnung, dass das Rheinland von nun an zu Preußen gehöre und damit zum neu geschaffenen Deutschen Bund. Ziel des Adels war die Restauration, die Wiederherstellung der früheren Verhältnisse. Doch die revolutionären Hoffnungen lebten weiter und die Pariser Julirevolution von 1830 bedeutete für die Generation Blums einen neuen politischen Aufbruch. Der Pariser Funke sprang über: in Polen, in Italien, in London. Überall gingen die Menschen gegen die alten Mächte auf die Straße, demonstrierten für ein neues Wahlrecht, für Grundrechte. Im Deutschen Bund wurden in Hannover, Kurhessen, Braunschweig und in Sachsen moderne Verfassungen erzwungen. Es erschienen zahllose revolutionäre Schriften. In Wirtshäusern wurde es üblich, Zeitungen vorzulesen, Handwerker und Lohnarbeiter nahmen an politischen Gesprächen und Debatten teil. In Rheinhessen, der Pfalz und in der Rheinprovinz sangen ländliche und städtische Unterschichten Freiheitslieder, pflanzten Freiheitsbäume und organisierten politisierte Katzenmusiken gegen Vertreter der staatlichen Behörden. Ein Höhepunkt der Bewegung ist im Mai 1832 das Hambacher Fest, eine riesige Demonstration für nationale Einheit, Freiheit und Volkssouveränität in der zum bayrischen Königreich gehörenden Rheinpfalz. Umbruch liegt in der Luft. Unter dem Eindruck der Pariser Julirevolution dichtet der 22jährige Robert Blum: „Ringet kühn für Recht und Freiheit. Jauchzet: Hoch die freie Welt.“6
Zur Spielzeit 1831/1832 wechselt Ringelhardt ans Theater in Leipzig. Blum folgt ihm 1832. Mit seinem Umzug in die sächsische Buch- und Kulturmetropole Leipzig, mitten hinein in den politischen Gärungsprozess des Vormärz, wird Robert Blum zu einem unermüdlichen politischen Aktivisten für Freiheit und Recht. Eine neue Welt tut sich für ihn auf, erst hier begreift er das Theater als einen der wenigen öffentlichen Räume, als Bühne des Volkes, die Verbindung von Sprache und Politik.
Die Arbeit im Theater inspiriert Blum, seine vielfältigen Talente auszuprobieren und zu entwickeln. Er ist Theatersekretär, Bibliothekar und Kassierer. Er schreibt Dramen, Gedichte und außerdem erste Feuilletontexte für verschiedene populäre Zeitungen und Zeitschriften. Gemeinsam mit dem Schriftsteller Carl Herloßsohn und dem Humoristen Hermann Marggraff veröffentlicht er ein „Allgemeines Theater-Lexikon“, eine „Encyklopädie Alles Wissenswerthen für Bühnenkünstler, Dilettanten und Theaterfreunde“, in der er ebenso über wichtige Theater in der Welt wie über das Haar als „schönste und natürlichste Zierde“ des Kopfes schreibt und eine kleine Kulturgeschichte der Haartracht liefert. Er bewirkt die Gründung des Leipziger Schillervereins, bei dessen wiederkehrenden Schiller-Feiern er als Hauptredner regelmäßig Triumphe feiert. Zusammen mit dem Geschichtsprofessor und Literaten Friedrich Steger gibt er zur politischen Bildung der unteren Klassen den „Verfassungsfreund. Volksschriften über staatsbürgerliche Angelegenheiten" und außerdem eine Publikation mit dem Titel „Vorwärts!“ heraus, ein jährliches Volkstaschenbuch mit Essays oder biografischen Porträts. Er arbeitet als Redakteur bei den „Sächsischen Vaterlands-Blättern"; er gründet eine Buchhandlung, in der u.a. das „Staatslexikon für das deutsche Volk" erscheint, für das Blum zahlreiche Artikel verfasst. Als Adressat hat Blum vor allem das einfache Volk vor Augen, dem er entstammt, das er kennt und dem er über den Weg der Bildung zur Emanzipation und zur Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben verhelfen will. Er beschreibt Hintergründe, erklärt Zusammenhänge und Begriffe. Er klärt auf. Kein Thema, kein politisches Stichwort, zu dem er nichts zu sagen, über das er noch nicht nachgedacht hätte: Freiheit oder Gleichheit, Gerechtigkeit oder Rechtsstaat, Militär oder Kirche, Bildung oder – zum Beispiel – politische Ideen: „Auch jetzt verlacht man noch die Ideen einer gerechteren Verteilung der Lebensgüter, eines allgemeinen Wohlstandes, einer Aufhebung der Armut und Verarmung. Allein auch sie werden unaufhaltsam der allgemeinen Anerkennung, dem Durchbruch, der Herrschaft entgegen reifen.“ Jeder von Blums Texten endet optimistisch, mit einem geradezu kindlichen Glauben daran, dass die bessere Zukunft nur noch wenige vernünftige Schritte entfernt ist. Ein Glaube, der unserer Gegenwart längst abhandengekommen ist.
Die Tätigkeit im Theater sichert auch den Lebensunterhalt der größer werdenden Familie Blums. Doch das Politische und die politische Publizistik werden immer mehr zum eigentlichen Lebensinhalt von Robert Blum. Blum ist ein politischer Visionär mit dem Instinkt eines Populisten, den er im Kölner Armen-Ghetto, auf seinen Reisen, in Versammlungen entwickelt hat. Er spürt, was die Stunde geschlagen hat, er wittert die Revolution. Und bereitet sich vor. Blum knüpft Kontakte, vorerst im Verborgenen, um den vormärzlichen Überwachungsstaat nicht auf den Plan zu rufen. Die Karlsbader Beschlüsse erlauben es nicht, offen gegen die antidemokratischen Zustände im Land vorzugehen: Überwachung, Denunziation, Pressezensur und Willkürjustiz bedrohen die Opposition. Auch Blum wird in Sachsen überwacht. Er gründet zahlreiche Vereine, mit denen politische Diskussionen und Veranstaltungen getarnt werden können. Neben dem Schillerverein zum Beispiel den sogenannten „Redeübungsverein“ oder die „Kegelgesellschaft“. Im März 1848 folgt der „Leipziger Vaterlandsverein“.
Robert Blum ist überall präsent. Seine Aktivitäten in Leipzig verblüffen durch ihre Vielfalt und ihre Entschlossenheit. Die politischen Botschaften müssen unters Volk gebracht werden, um ihre Wirkung zu entfalten. Das Netzwerk, das Blum knüpft, reicht schon bald weit über Sachsen hinaus. Robert Blum wird unter den führenden Liberalen des Deutschen Bundes zu einer maßgeblichen Gestalt. Im September 1844 muss Blum wegen angeblicher Verunglimpfung der königlich sächsischen Justizbehörden in den „Vaterlands-Blättern“ für einige Woche ins Gefängnis. Seine Schwester Margarete drängt ihn, sich politisch zurückzuziehen. Er könne sowieso nichts ändern. Blum antwortet ihr geradezu empört: „Es hätte nie ein Christentum und eine Reformation und keine Staatsrevolution und überhaupt nichts Großes und Gutes gegeben, wenn jeder stets gedacht hätte: ,Du änderst doch nichts!’ Glaubst Du etwa, es sei ein Spiel, dieser Kampf gegen die Übergriffe und unrechte Stellung der Staatsgewalten, aus dem man sich zurückzieht, wenn es keinen Spaß mehr macht? Oder glaubst Du, man beginne diesen Kampf leichtfertig und leichtsinnig, ohne das Bewusstsein, dass die Staatsgewalten die furchtbare Waffe eines Gesetzes, welches sie meist allein und für ihre Zwecke gemacht haben, gegen uns schwingen und wir fast unbewehrt sind? Allerdings gibt es der fischblutigen Amphibien sehr viele, die recht sehr freisinnig sind, solange es Volkstümlichkeit und Beifall einbringt, die aber sehr klug sind und sagen: ,Ich ändere doch nichts!’, sobald ein unfreundlicher Wind geht. Willst Du mir raten, mich mit diesem Lumpengesindel in eine Reihe zu stellen?“7
Für die Befreiung der Menschen aus Unmündigkeit und systematischer Unterdrückung geht Blum keinem Konflikt aus dem Weg, auch nicht mit der katholischen Kirche. Nach seiner Kommunion hatte Robert Blum in der Kölner Kirche Groß Sankt Martin, die direkt hinter seinem Elternhaus stand, als Messdiener begonnen. Schon bald geriet der hochbegabte Junge in eine tiefe geistige Krise. Er vermochte nicht an die Transsubstantionslehre zu glauben, an die theologische Behauptung, dass sich bei der Abendmahlsfeier Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelten. Und offenbarte einem Kaplan während der Beichte seine Zweifel. „Statt aber die erwartete Beruhigung zu empfangen, musste er sehen, wie der Priester zurückschreckte, als ob ihm eine Schlange entgegenzische, und die Absolution kurzweg verweigerte.“8 Robert wurde vor ein „geistliches Gericht“, was ihm den Bruch des Beichtgeheimnisses offenbarte. „Diese (...) Verletzung des Beichtgeheimnisses gab dem eingeschüchterten Knaben den Mut wieder, und er erklärte nun kurz und bündig, halte man dieses Sakrament nicht heilig, so vernichte man mit dem Glauben an diesen Lehrsatz zugleich den an alle anderen.“9 Der Pfarrer geriet so sehr in Wut, dass er sich auf Robert stürzte. Der konnte den Schlägen entfliehen und wurde als Messdiener gefeuert, womit seine Ablehnung der Kirche ihren Anfang nahm. Später sollte Robert Blum für eine strikte Trennung von Kirche und Staat, für eine Abwendung von Rom und dem Papst und für das Recht auf Glaubensfreiheit kämpfen. In den „Sächsischen Vaterlands-Blättern“ rief er offen zum Austritt aus der katholischen Kirche auf und sprach sich gegen das katholische Sakrament der Beichte sowie gegen den Pflichtzölibat für Priester aus. „Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit, d. h. das Bewusstsein, weder etwas tun zu müssen, was das sittliche Gefühl beleidigt, noch etwas bekennen zu müssen, was man weder weiß noch glaubt, will die Welt und bedarf die Menschheit, wenn sie frei und glücklich werden will.“10
Im Laufe der Jahre in Leipzig findet Robert Blum zu seiner politischen Position. Die Liberalen spalten sich: Auf der einen Seite die Anhänger einer konstitutionellen Monarchie, auf der anderen die Anhänger einer Republik, einer parlamentarischen Demokratie, die demokratischen Linken, zu denen Blum gehört. Gewaltsame Umsturzpläne lehnt Blum ab. Schiller, das Vorbild Robert Blums, vertrat die Ansicht, dass nur der frei sein könne, der sich auch der Freiheit der anderen zuneige, und dies nicht aus taktischen Gründen oder aus Angst vor Strafe. Wie Schiller oder Kant glaubt Blum, dass der Frieden mit der Freiheit der anderen zum Balanceakt der Freiheit gehört, und träumt von einem idealen Staat mit freiheitsfähigen Bürgern, die mit Vernunft das Gleichgewicht zwischen eigener und fremder Freiheit selbst herstellen. Doch Blum, der das Elend der unteren Schichten selbst erfahren hat, weiß auch, dass Menschen unter elenden Lebensbedingungen keine philosophischen Erörterungen wollen, sondern konkrete gesellschaftliche Veränderungen. Um diese aber aus eigener Kraft zu erreichen und zu verteidigen, so Blums tiefe Überzeugung, braucht es Bildung. Eines seiner Lebensthemen. Ende März 1848 wird Blum als Delegierter ins Vorparlament gesandt und zum Vizepräsidenten gewählt. Von den Leipzigern zum Abgeordneten bestimmt zieht Blum Mitte Mai 1848 in die Nationalversammlung ein und wird zum Sprecher der demokratischen Linken, die er schnell als erste Fraktion organisiert. Treffpunkt „Deutscher Hof“. Bald gilt er als einer der mitreißendsten Redner der Nationalversammlung, gerät aber auch immer mehr zwischen die Fronten. Der äußersten Linken, der Fraktion „Donnersberg“, die sich schon Ende Mai 1848 vom „Deutschen Hof“ abspaltet, ist er zu gemäßigt, den Fraktionen der Liberalen und Rechten zu radikal. Die einen wollen die Revolution in Kämpfen auf der Straße retten, die anderen wollen mit oder gar ohne ein demokratisch gewähltes Parlament nicht auf einen König verzichten. Je länger er in der Nationalversammlung agiert, desto unerreichbarer scheinen Blum seine Ziele. Der Traum von einer demokratisch legitimierten Republik findet in der Nationalversammlung keine Mehrheit, stattdessen wird eine konstitutionelle Monarchie beschlossen.
Doch im Oktober 1848 gibt es aufregende Nachrichten von revolutionären Aufständen in Wien. Blum macht sich auf den Weg nach Wien, mit einer Solidaritätsnote seiner Fraktion in der Tasche. Ungeduldig, verzweifelt ob der verfahrenen Situation in der Nationalversammlung und sehnsüchtig nach dem Vorwärts lässt sich Blum von der revolutionären Stimmung auf der Straße oder in der Universität, von der Entschlossenheit der Aufständischen, von der Dynamik der Ereignisse mitreißen. Und übernimmt sogar das Kommando über eine kämpfende Einheit. Der Mann des Ausgleichs, der geistige Vater der parlamentarischen Demokratie, der glühende Anhänger der Vernunft kämpft plötzlich mit der Waffe in der Hand für seine Ideale. Die Revolution muss siegen! Sie siegt nicht. Der Aufstand in Wien wird niedergeschlagen, Robert Blum wird verhaftet, von einem Standgericht ohne Verteidigung zum Tode verurteilt und am 9. November 1848 außerhalb von Wien von einem Exekutionskommando ermordet. Ein politisch motiviertes Justizverbrechen – auch Blums Immunität als Abgeordneter wurde missachtet. Felix Fürst zu Schwarzenberg, der österreichische Regierungschef, und Fürst Windisch-Graetz, Oberkommandierender der kaiserlichen Truppen, nutzten die Gelegenheit, an einem führenden Repräsentanten der Paulskirche ein Exempel zu statuieren, um ihre Verachtung für die Nationalversammlung und den Kampf um Freiheit und Recht zu demonstrieren. Und tatsächlich spiegelt Blums Exekution die realpolitische Machtlosigkeit der Paulskirchenversammlung wider.
Aufbruch und Wandel: Stichworte der Zeit, Merkmale von Robert Blums Leben. Der Weg aus Armut und Kinderarbeit zu einem autodidaktischen Großmeister in Schrift und Sprache. Der Weg vom Gelbgießergesellen und Laternenverkäufer in Köln zum Theatersekretär, zum Schriftsteller, Journalisten und Publizisten, zum Redner und Politiker in Leipzig. Der Weg aus den dunklen Schatten der Pfarrkirche hin zur hellen Erkenntnis über katholischen Machtmissbrauch und päpstliche Willkür. Der Weg aus der untersten sozialen Schicht hinein in die Paulskirche, hinein in die Nationalversammlung: Und auch der Weg vom Prediger der Gewaltlosigkeit zum verzweifelten letzten Kampf auf den Barrikaden von Wien. „Alles will mit Kraft vorwärts.“
Robert Blum ist eine bedeutende Gestalt der deutschen Demokratie- und Freiheitsgeschichte; Vordenker und Wegbereiter unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Seine Publikationen und Reden sind durchdrungen von dem Bekenntnis zu Frieden, Freiheit, Demokratie und Recht. Und seine Forderungen nach einer parlamentarischen Verfassung, nach politischer Mitbestimmung der Bürger, nach einem für alle geltenden Rechtsstaat, nach sozialer Sicherheit und dem freien Zugang zur Bildung nehmen die Grundlagen unserer heutigen Gesellschaft, unserer Demokratie vorweg. Aber Robert Blum wäre sicher auch ein kluger, leidenschaftlicher, unerschrockener Kritiker ihrer zahlreichen Beschädigungen und wachsenden sozialen Verwerfungen. Wir hätten Robert Blum dringend nötig. Seinen Einsatz für Bildung und Aufklärung, seine scharfen Analysen, seinen Mut zum Widerspruch – und seinen Einsatz für eine gerechte Demokratie.
„Eine ruhige Prüfung der gewichtigen Fragen, die auf die Gestaltung unseres öffentlichen Lebens von entscheidendem Einfluss sind, tut daher vor allem Not. Keine Leidenschaft, kein Irrtum, am wenigsten absichtliche Lüge, dürfen sich in die Erörterung der Formen und Einrichtungen, die für das Staatsleben die passendsten sind, mischen, sollen wir anders unsere Entscheidung richtig abgeben. Zu dieser Entscheidung sind aber alle berufen und berechtigt, Arme wie Reiche, Mächtige wie Schwache, Hohe wie Niedere, denn das Vaterland umschlingt alle Staatsbürger mit gleichem Bande, und was ihm widerfährt, Gutes oder Böses, das hat auch jeder Einzelne mitzuempfinden.“11
Robert Blum wurde am 9. November 1848 für seine Ideale hingerichtet. An einem Datum, das deutsche Geschichte schrieben sollte. Genau 70 Jahre später, am 9. November 1918, wurde von Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht die erste deutsche Republik ausgerufen.
1 N. N.: Öffentliche Charaktere I: Robert Blum. In: Die Grenzboten. Jg. 7, 1848, II. Semester, III. Band, S. 366-386.
2 Blum zitiert nach Arthur Frey: Zur Erinnerung an einen Todten. Robert Blum als Mensch, Schriftsteller und Politiker. Mannheim, J.P. Grohe 1849, S. 152.
3 Zitiert nach: Hans Blum: Robert Blum. Ein Zeit- und Charakterbild für das deutsche Volk. Leipzig, Verlag von Ernst Keil, 1878, S. 152.
4 Zitiert nach August Kluckhohn: Aus dem handschriftlichen Nachlasse L. Westenrieders, in: Abhandlungen der Historischen Classe der Kgl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften (17/2), München 1882, S. 1-111, hier 46.
5 Ralf Zerback: Robert Blum. Eine Biografie, Lehmstedt Verlag, Leipzig, 2007, S. 21.
6 Robert Blum Nachlass, Staatsbibliothek zu Berlin, Kasten 3, Nr. 1, S. 48.
7 Robert Blum. Briefe und Dokumente, herausgegeben von Siegfried Schmidt, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1981, Nr. 16, S. 30.
8 Selbstbiographie von Robert Blum und dessen Ermordung in Wien am 9. Novbr. 1848: Herausgegeben von einem seiner Freunde. Leipzig und Meißen, Verlag von F.W. Goedsche 1848, S. 6.
9 Ebd.
10 Robert Blum: Volksthümliches Handbuch der Staatswissenschaften und Politik. Ein Staatslexikon für das Volk (2 Bände). Verlagsbuchhandlung Blum & Co., 1848/1851, Seite 444.
11 Zitiert nach: Hans Blum: Robert Blum. Ein Zeit- und Charakterbild für das deutsche Volk. Leipzig, Verlag von Ernst Keil, 1878, S. 153.
Die Masse der Gedanken, welche die stets wachsende Bildung erzeugt und reift, geben in ihrer Gesamtheit eine Art Bild, welches in immer weiteren Kreisen betrachtet, geliebt, ersehnt wird, ehe das Verständnis allgemein ist und diese Allgemeinheit den Eintritt der Ideen in das Leben notwendig macht. Man kann falsche, verderbliche, unhaltbare Gedanken in die Zeit schleudern und ihnen einen Anhang werben – sie werden deshalb nicht zu Ideen, sondern verhüllen dieselben nur auf Augenblicke, wie die Schale ihre Frucht, die zersprengt wird, sobald die Reife sich entwickelt hat; man kann Gedanken ächten, verfolgen, unterdrücken, wie dies die geistesmörderische Zensur in Deutschland 30 Jahre getan – man kann aber deshalb die Ideen nicht zerstören, die aus ihnen hervorgingen. Werfen wir statt aller Ausführung einen Blick auf unsere Zeit, so wird uns die Entwicklung der Gedanken zu Ideen, der Ideen zur Tat bald klar werden. Die Masse der Gedanken, welche Deutschlands große Geister am Ende des vorigen Jahrhunderts in die versumpften Zustände ihres Volkes schleuderten, schienen gar keinen Erfolg zu haben. Das Volk sank tiefer und tiefer, wurde völlig dienstbar fremdländischer Gewaltherrschaft, und die Leiter des Volkes, seine „Beglücker und Beherrscher“, vollendeten seine Schande und sein Unglück, indem sie (…) ihr Volk der Knechtung überlieferten durch Feigheit und Verrat. Hat dieses Elend die Ideen aufgehalten? Nein, unter dem eifernsten Druck sind sie gewachsen, bis sie stark genug waren, alle Gewalt zu zersprengen. Ein anderes Beispiel: An die Erhebung des Befreiungskrieges schlossen sich die Ideen von der Freiheit und Einheit des Vaterlandes an. Sie wurden niedergehalten durch 30jährige Geistesknechtschaft, durch das schmachvolle Mittel der Zensur, durch Bundesbeschlüsse, ministerielle Wiener Verschwörungen, Gewalt, Bevormundung und Polizei. Hat es geholfen? Unter dem ersten Eindruck der großartigen französischen Staatsumwälzung brachen die Ideen gewaltsam hervor und gelangten zur Herrschaft. Welche schmachvolle Rolle spielten dabei die deutschen Regierungen! Wie hatten sie hohngelächelt, wenn man ihnen diesen Durchbruch vorher verkündete! Wie pochten sie auf ihre Bajonette und auf ihre Polizei! Wie spotteten sie der „Ideologen, Utopisten, Schreier, Böswilligen“ usw., welche unermüdlich forderten, was man jetzt sogleich gewähren musste! Wie übermütig wiesen sie auf ihre Unfehlbarkeit und Allmacht hin, der Knechtung noch den Hohn hinzufügend! Und das alles ist zerstoben und zugrunde gegangen vor einem Hauch der Freiheit; die Pfuscher und Bönhasen1 in der Politik, die sich Minister und Staatsmänner nannten, sind beseitigt, nur die Schande ihrer hochverräterischen Unterdrückungsversuche und die Lächerlichkeit ihres Gebarens ist übriggeblieben als trauriges Denkmal ihres Daseins. So allmächtig sind die politischen Ideen, die kein Druck, keine Gewalt, kein Verrat zerstören kann, die immer weitere Kreise durchdringen, immer mehr Herzen entflammen, immer mehr Anhänger gewinnen, bis sie friedlich oder gewaltsam ins Leben treten und die Welt beherrschen. Es kann sie Niemand machen, es kann sie Niemand ausrotten, sie wachsen, wie die Pflanze bis zur Reife. Auch jetzt verlacht man noch die Ideen einer gerechteren Verteilung der Lebensgüter, eines allgemeinen Wohlstandes, einer Aufhebung der Armut und Verarmung. Allein auch sie werden unaufhaltsam der allgemeinen Anerkennung, dem Durchbruch, der Herrschaft entgegen reifen. Hoffentlich ist die Zeit für immer vorbei, wo man Ideen mit Polizei verfolgt (…).
1 Ein Bönhase (auch: Böhnhase) war in Norddeutschland ein unzünftiger, also keiner Zunft angehöriger Handwerker. Auch Nichtwissende oder „Dummköpfe“ wurde als Bönhase betrachtet.
Der gewaltige Notruf, welcher aus dem sächsischen Erzgebirge schon beim Beginne des Winters erscholl, und trotz des Aufgebots aller Kräfte und Mittel der lebhaft angeregten Wohltätigkeit sich kaum verminderte, hat die Blicke nicht nur in Sachsen, sondern fast in ganz Deutschland auf jenen Landstrich gelenkt, welcher durch den gänzlichen Verfall der nährenden Industriezweige dem Verderben preisgegeben scheint.
Ist auch das Erzgebirge im Allgemeinen ein armer Landstrich, in dem der widerstrebende Boden und die Rauheit des Klimas gleichmäßig auf eine sehr geringe Fruchtbarkeit desselben wirken, der Bergbau schon lange seinen Arbeitern nur das kümmerlichste Dasein gewährt, die Kattunweberei und Strumpfwirkerei eben im letzten Stadium des verzweifelten Kampfes liegen, welchen nach dem Gang fabrikmäßiger Industrieentwicklung die Hausindustrie überall mit der Fabrikation in geschlossenen Fabriketablissements kämpft, dem sie überall erliegen muss; die Fabrikation von Holz- und Spielwaren sich teils überlebt hat, teils gegen die mächtigere Konkurrenz zurückgeblieben ist; die Leinwandindustrie unter der allgemeinen Verkümmerung schmachtet, der sie in ganz Deutschland preisgegeben ist, und die Band- und Posamentierwarenfabrikation1, trotzdem dass sie als der blühendste Erwerbszweig betrachtet werden kann, es nicht vermag, die allgemeine Geschäftskalamität auszugleichen, so ist es doch vorzugsweise die raueste Gegend des Erzgebirges, deren Bevölkerung sich mit dem einst so einträglichen Spitzenklöppeln beschäftigt, welche dem größten Mangel und Elend erliegt. – Die Schilderungen dieser allgemeinen Not sollen indessen hier nicht um eine vermehrt, vielmehr in einem kleinen Bildchen das Leben des Erzgebirges geschildert werden. Die vielgenannten Dörfer Rittersgrün und Großpöhla, ersteres mit gegen 3000, letzteres mit etwa 1600 Einwohnern, die sich fast sämtlich mit Klöppeln ernähren, mögen den Anhaltspunkt dazu bieten. In diesen, also ziemlich großen Dörfern gibt es selbst für die Männer außer dem Klöppeln wenig Verdienst; wenige nur nähren sich als Hochöfner auf dem benachbarten Hammerwerk und verdienen daselbst bei einer schweren Arbeit wöchentlich 1 Taler, wofür sie abwechselnd Tag und Nacht arbeiten müssen, denn diese Werke stehen von Montagfrüh bis Sonnabendabend niemals still. Noch weniger verdienen die Waldarbeiter, die zudem noch von der Witterung abhängen und im Winter gänzlich feiern müssen. Weiterlesen
1 Posamente (aus dem französischen passement, Borte, Besatz): Sammelbezeichnung für schmückende Geflechte, wie Zierbänder, Kordeln, Litzen, Quasten oder Spitzen aller Art.
Daher ist nichts natürlicher, als dass auch die Männer zum Klöppeln greifen und Knaben wie Mädchen die Klöppelschule (in Rittersgrün) besuchen, Männer wie Frauen am Klöppelkissen sitzen.
Mit dieser Arbeit nun vermögen ein Paar geschickte Hände bei dem anhaltendsten Fleiße in guten Zeiten 4-5 Reichsgroschen täglich zu verdienen; dazu gehört aber nicht allein die höchste Ausbildung im Fache, also der Besuch der Klöppelschule von frühester Kindheit an, sondern auch die sauberste und geschmeidigste, von keiner rauen Arbeit „verdorbene Hand“. Deshalb verrichten auch die Männer, deren Hände zur feineren – und lohnenderen – Arbeit fast stets zu ungeschickt sind, besonders im Winter die häuslichen Arbeiten wie Heizen, Kehren, Kochen usw. und überlassen die Erwerbsarbeiten der Frau und den Kindern.
Die Wohnungen geben den Hütten der Proletarier, wie sie uns aus London, Manchester und anderen großen Städten geschildert werden, wenig nach an Armut und Elendigkeit. Schon das äußere Ansehen der Häuser verrät das Elend, welches drinnen wohnt: Die meisten haben nur ein Erdgeschoß und darauf ein großes Schindeldach. Die allgemeine Verarmung hat auch die Besitzer dieser Hütten nicht geschont, und ein Haus, welches noch ein Stockwerk über dem Erdgeschosse hat, ist fast ebenso selten als eines, welches nicht äußerlich und innerlich die Spuren des Verfalls und versäumter Ausbesserung an sich trägt. An den kleinen Fenstern sind oft zwei Drittel der Scheiben zerbrochen und mit Papier verklebt, wodurch das Tageslicht verkümmert wird, welches zu der feinen Arbeit so nötig ist; durch das lückenhafte Dach bricht Regen, Schnee und Sturm herein, und oft ist der Schläfer, der unter demselben auf elendem Strohlager liegt, genötigt, drei bis vier Mal nächtlich seine Stelle zu wechseln, um den direktesten Störungen des schlechten Wetters zu entfliehen. Die Stuben sind niedrig, eng, mitunter ungedielt und meist schwarz und rußig, doch müssen sie oft für 3-4 Familien Unterkunft und Obdach gewähren. Das Klöppeln erheischt die höchste Geschmeidigkeit der Hände, und die Stuben müssen daher im Winter stets warm sein, da die geringste Steifheit der Finger die Arbeit stört; ja, man trifft häufig in den engen Räumen die Temperatur eines Dampfbades. Holz wurde bisher ungestört aus dem Walde geholt; der Boden trägt vielfach nichts anderes, und die Not hatte den Begriff des Holzdiebstahls aus der Sprache und aus dem Gewissen verbannt. Auch das ist in neuester Zeit anders geworden; die Wälder sind durch das in den Niederungen wachsende Bedürfnis mehr gelichtet worden, besonders der Eisenbahnbau hat direkt und indirekt unermessliche Holzmassen verbraucht. Der Besitzende hat sich bereichert, der Arme ist – wie immer – nicht nur leer ausgegangen, sondern das vergessene Gesetz, welches nur vom Besitzenden und für denselben gemacht ist, hat sich wieder gegen ihn gekehrt und bestraft den Holzdiebstahl.
Die Kleidung des Erzgebirges hat nichts Eigentümliches, wenn auch die Nachäfferei fremder Moden sie nicht zu dem Quodlibet gemacht hat, welches unsere Städte darbieten. Die Männer tragen gelbe Lederhosen, die bis ans Knie gehen, lange wollene Strümpfe und Schuhe oder hohe, bis an die Knie gehende Stiefel, sogenannte Schlappstiefel; doch ist das letztere Kleidungsstück seiner Kostbarkeit wegen selten; im Sommer betrachtet man überhaupt die Fußbekleidung als etwas Überflüssiges. Den Oberkörper bedeckt eine lange, bis auf die Hüfte reichende Jacke, Wams genannt, welche jedoch weniger Bekleidung des Mannes, als der ganzen Familie ist. Denn das Wams vertritt die Stelle des gemeinschaftlichen Mantels und während dasselbe im Sommer überhaupt in Ruhestand versetzt ist, dient es im Winter jedem, der die Hütte verlässt, als wärmende Hülle; sobald das Kind nicht mehr unter der Last erliegt und so groß ist, dass es nicht mehr darüber fällt, hat es auch ein Anrecht auf des Vaters Wams. Wo noch so viel Wohlstand herrscht, da besitzt der Mann auch einen langen blauen Tuchrock und kurze Tuchhosen, die aber fast nur dem Kirchenbesuch bestimmt sind, und die vereint mit einem großen runden schwarzen Filzhut den Staat ausmachen.
Die Frauen tragen ziemlich kurze, buntgestreifte, wollene Röcke, eine Art Oberhemdchen von weißem Baumwollzeug mit kurzen bauschigen Ärmeln und ein buntes Kattunhalstuch. Strümpfe und Pantoffeln brauchen sie nur im Winter. Die Frauen lieben das Bunte, und wenn sie Sonntagsstaat besitzen, so besteht er in einem bunten Kattunkleide und einer Haube mit bunten Bändern; nur wenige junge Mädchen tragen gescheiteltes Haar ohne Kopfbedeckung; es wird ihnen dies aber als Eitelkeit, als Vornehmtuerei ausgelegt. Aus besseren Zeiten hat sich die Sitte erhalten, zur Kommunion nur im schwarzen Anzuge zu gehen und dazu, wo irgend möglich, ein seidenes Kleid zu besitzen. Das ist jedoch längst vorüber und nur wenige schwarze Kleider haben sich in den einzelnen Dörfern erhalten; diese aber sind gewissermaßen Gemeingut geworden, werden für den ausgesprochenen Zweck geborgt und gehen aus grauer Vorzeit auf Kind und Kindeskinder über.
Der Hang der Frauen zu Putz, bunter Kleidung und etwas Flitterstaat gibt dieselben einer großen Plage preis, dem Hausierhandel. Eine Schar Hausierer, Männer und Weiber, werden zur wahren Landplage für die armen Dorfbewohner; sie vermehren sich in neuester Zeit wie die Heuschrecken und haben viel zu der Not auf den Dörfern mit beigetragen, während in den Städten, wo dieser Handel teils verboten, teils nicht ergiebig ist, man wenig davon weiß. (…)
Die Nahrung der Erzgebirger besteht fast einzig und allein aus Kartoffeln, dort Erdäpfel genannt, in deren Bereitung sie eine wahre Virtuosität entwickeln und hundert Dinge in der Pfanne und im Topf bereiten, um Abwechslung in die Speisen zu bringen. Traurige Selbsttäuschung! Es fehlt eben an dem, was Abwechslung gibt, an der Zutat, der Würze, der Beimischung; der Arme ist froh, wenn er nur Salz und das dürftigste Schmalz hat, und damit kann er nur die Form seiner Speise ändern. Eine große Rolle spielen die sogenannten Röhrenkuchen, kleine runde Kuchen oder Klöße, die in der Ofenröhre gebacken werden. Die Kartoffeln werden dazu gekocht, dann geschält und zu Brei geknetet, mit Salz und Schmalz gemischt und mit der Hand geformt. Diese Röhrenkuchen müssen besonders die Stelle der Semmel und Franzbrote beim Frühstück vertreten. Kann und will man sich eine besondere Güte tun, so gießt man Sirup auf diese Kuchen, oder einen braunen Rübensaft, den man ebenfalls Sirup zu nennen beliebt. Sogenannter Kaffee ist das einzige Getränk der Armen und wiederholt sich täglich drei Mal, morgens, mittags und abends; dieser Kaffee besteht aus einem langen Gebräu von Zichorie und kleingeschnittenen gebrannten Rüben oder Wurzeln; er wird in großen irdenen Töpfen aufgetragen, und Einzelne verzehren eine unglaubliche Menge dieses Getränkes. Fleisch ist eine große Seltenheit, Brot ist ebenfalls ein Leckerbissen, und höchstens kommen einige Surrogate von Hafer vor, Butter kennt man fast gar nicht.
Dies ist das gewöhnliche Leben im Erzgebirge; von Spiel und Tanz, Volksfesten und Wohlleben, Erholung und Freude ist dabei nirgend die Rede, wenn es auch nicht an einzelnen Erscheinungen dieser Art fehlt. Das einzige Vergnügen besteht in dem gemeinschaftlichen Klöppeln an den langen Winterabenden, wobei man sich mit Erzählungen unterhält. Dieses gemeinschaftliche Klöppeln nennt man, „zu Rocken gehen“, eine Bezeichnung, die augenscheinlich auf eine Zeit hindeutet, wo die Industrie jene seitdem unendlich vermehrte Bevölkerung noch nicht heimgesucht hatte mit ihrem Segen und ihrem Fluche. Auch liegt diesen Zusammenkünften nicht bloß der angeborene Trieb der Geselligkeit, sondern die Sparsamkeit zu Grunde, indem man das Licht der kleinen, mit schlechtem rauchendem Öl gespeisten Lampe so nutzbar als möglich zu machen sucht. Zu dem Zwecke werden so viel sogenannte Schusterkugeln um das Licht gestellt, als die Gesetze der Refraktion2 und die Erweiterung des Kreises gestatten, und jeder Schein fällt auf ein Klöppelkissen und ein Paar fleißige Hände.
In dieser einförmigen Dürftigkeit und dürftigen Einförmigkeit leben Menschen, denen die Natur den Rechtsbrief auf die Güter und Genüsse der schönen Erde so gut ausgestellt hat wie irgendeinem; so leben sie in einer Zeit, wo man fortwährend vom steigenden Wohlstande des Landes posaunt und sich anstellt, als ob das Menschenglück wie Pilze aus dem Boden schieße; so leben sie in einer Zeit, wo man das Christentum neu erfunden zu haben meint, welches doch gleiche Liebe, gleiche Pflichten und gleiche Rechte lehrt, und wo man vor lauter Christlichkeit den Kopf so rein verloren hat, dass für das Menschliche der Begriff und das Gefühl abhandengekommen ist; so leben sie in einer Zeit, wo man die Versuche zur Hebung dieser Übelstände nicht selten als Narrheit oder als Hochverrat verdächtigt und verfolgt: Oh, wir sind weit, sehr weit gekommen!
Doch nein, so leben jene Menschen nicht; so lebten sie, als sie noch „glücklich“ waren, als sie Arbeit und Verdienst hatten und ihre „Genüsse“ billig waren. Das ist eine schöne Vergangenheit, die wahrscheinlich nur noch in ihren Winterabenderzählungen lebt, wie ehedem schon der gewöhnlichste einfachste Lebensgenuss für sie in das Gebiet der Märchenwelt gehörte. Die Gegenwart hat alles geändert, alles verschlimmert. Denn der Absatz der Erzeugnisse ihrer Hand hat fast ganz aufgehört und ist von den Spitzen und Blonden, die um ein Viertel des Preises auf Maschinen gefertigt werden, vom Markte gedrängt. Das Klöppelwesen ist so herabgekommen, dass die geschicktesten und fleißigsten Arbeiter kaum 1 bis 2 Neugroschen täglich verdienen können und auch bei diesem Lohne noch oft feiern3 müssen. Aus den Wohnungen sind die Bettstellen und die Betten mit den blau gestreiften Überzügen geschwunden und ein Haufen Stroh ist an ihre Stelle getreten, auf dem die ganze Familie ihre Ruhe sucht, wenn die Qualen des Hungers ihr solche gönnen. Fenster und Dächer sind elender geworden, aber das Holz fehlt, und an seine Stelle ist höchstens grünes Reisig getreten, welches mit Gefahr des Freiheitsverlustes zusammengetragen wurde und mühsam auf dem Ofen getrocknet werden muss; seine Ausdünstung verdirbt die Luft, sein Rauch macht die elende Wohnung vollends zur schwarzen Höhle und verdirbt den Armen die Augen. Die Kleidung ist zerrissen und in vielen Haushaltungen laufen die Kinder nackend umher, wie sie aus der Hand der Natur kommen. Aber die Natur hat sich wahrscheinlich auf die Bruderliebe und Barmherzigkeit der „christlichen“ Bevölkerung und des „christlichen Staates“ verlassen und ihnen keine Wolle wachsen lassen. Das väterliche Wams hält kaum noch zusammen, aber es hat eine neue wichtige Bestimmung erhalten: Es muss der ganzen Familie als einzige schirmende Decke dienen in den langen Winternächten. Die Kartoffel, das einzige Nahrungsmittel der Armen, ist seit zwei Jahren nicht geraten; sonst erzeugte der Arme sich dieselbe, indem er ein Stückchen Feld für einen geringen Preis oder für Dünger pachtete. Nachdem die Mutter Erde sogar ihn zwei Mal getäuscht und ihm für die gesunde Aussaat nur eine kranke unbrauchbare Ernte gegeben, ist er völlig erschöpft und vermag nicht mehr, Pacht und Aussaat zu erschwingen. Kartoffeln kaufen aber? Der Scheffel, der sonst 16-20 Reichsgroschen kostete, kostet jetzt drei Taler.
Ist es darum ein Wunder, wenn ganze Familien wochenlang keine andere Speise haben als einen Kleister von schwarzem Mehl, von zweifelhaften Bestandteilen und heißem Wasser bereitet, dem sogar die Würze des Salzes fehlt; dass andere einen Teil des Winters nur Suppe von Kartoffelschalen genossen haben, die sie zum Futter für eine Ziege aufgehoben hatten, die aber längst der Not zum Opfer fiel; dass das Fleisch krepierter Pferde und anderer Tiere beim Schinder gesucht und als Leckerbissen verzehrt wird? Dass die hungernden Eltern den herzzerreißenden Schrei ihrer Kinder nach Brot mit Prügeln beantworten müssen, um nicht völlig zur Verzweiflung getrieben zu werden; dass ganze Familien ihre Blöße nicht zu bedecken vermögen, obgleich sorgfältige Beamte dem reisenden Minister eine mühsam herausgeputzte Klöppelschule zeigten; dass die Mutter ihre Säuglinge mit Blut stillen, weil der ausgehungerte Körper der Brust keine Milch mehr gab, und mit Blut fortstillen musste, weil sie dem Säuglinge weder Milch noch Semmel zu kaufen vermochte; dass die bleichen matten Gerippe, die man Menschen nennt, auf der Straße hinstürzen vor Hunger und dem Schicksal überlassen bleiben, ob sie sich wieder von selbst erholen oder nicht, da es niemand vermag, ihnen eine Labung zu reichen; dass Sterbende, die langsam verelendet sind und die der Tod bald zu erlösen verspricht, keinen anderen Gedanken und keinen anderen Wunsch haben, als sich nur noch einmal satt essen zu können auf dieser Erde, aber scheiden ohne Erfüllung dieses Wunsches; dass solche Wünsche die letzten Worte sind, welche die halbbekleidete Frau, der arbeitslose und arbeitsunfähige Mann, die nackenden Kinder am Sterbebette vernehmen, wo, abgesehen davon, was ihr menschliches Herz empfindet, sich zu den Qualen des Hungers noch das verzweifelnde Bewusstsein gesellt, dass hier ihr einziger Ernährer stirbt, nachdem er sich zu Tode gearbeitet und gehungert hat.
Das alles sind keine Fantasiegebilde, keine Übertreibungen; es sind Tatsachen, wie sie in Rittersgrün, Großpöhla, Wiesenthal und anderen Orten vorgekommen sind; Tatsachen, vor denen selbst die Beschönigungs-, Bemäntelungs- und Umnebelungsmanie verstummte, die gewöhnlich sofort laut wird, wenn irgendeine Erscheinung auftaucht, die ernstliche Zweifel darüber hervorruft, ob denn wirklich unser dermaliger Staat der „beste Staat“ sei. Allerdings kann der Staat in seiner dermaligen Organisation sowohl, als noch mehr auf seiner dermaligen Grundlage dieses Elend nicht aufheben; allein wenigstens sollte er alle seine Kräfte anstrengen, zu mildern und vorzubeugen, wo er immer kann. Das Allermindeste, was man von ihm verlangen kann, wäre doch, die völlig Hilflosen nicht noch zu belasten. Allein diese grässliche Armut ist mit indirekten Steuern wirklich überlastet und muss von jedem kargen Bissen Abgaben bezahlen; Butter, Fleisch und Kartoffeln, die im nahen Böhmen weit billiger sind als im sächsischen Erzgebirge, müssen hoch versteuert werden – Wildbret, Fische und ähnliche Leckerbissen für die Reichen gehen steuerfrei ein; ebenso lag bis vor kurzem auf den trocknen Gemüsen eine hohe Abgabe, obgleich dieselben beim völligen Missraten der Kartoffeln unentbehrlich waren. Und während man diese ungerechteste und verkehrteste aller Steuern bestehen lässt und nicht imstande ist, den völlig entleerten Lebensmittelmarkt zu füllen, verweigert man ein so wichtiges und billiges Nahrungsmittel, wie den Reis, durch Aufhebung des Eingangszolles auf den Markt zu bringen; ja, während die meisten Industriezweige so gesunken sind, dass sie kaum ihre fleißigen Hände noch nähren und dem Arbeiter die härtesten Entbehrungen auferlegen, nimmt man durch die völlig unrationelle Garnzoll-Erhöhung den darbenden Webern und Wirkern den schmalen Bissen zum Munde weg, um einige reiche Spinnereibesitzer, die meist durch eigene Schuld und falsche Veranstaltungen nicht vorwärts können, damit zu begünstigen. Es ist eine sehr verkehrte Welt! (...)
Die wenigen Männer, welche wie der Abgeordnete Schaffrath4 die Forderung der Verarmungsfrage von einem höheren, zeitgemäßen Standpunkt auffassten und behandelten, erhoben ihre Stimme vergebens; sie klang wie eine Stimme in der Wüste, unverstanden und ohne Widerhall in empfänglichen Herzen.
Was dem Erzgebirge fehlt, ist: Aufhebung des modernen Helotentums, Gewährung von Rechten im Staate und Arbeit. Die erstere kann, muss der Staat geben, die letztere schafft gewiss die Gesellschaft selbst besser. Solche Versuche misslingen in den Händen des Staates: Hat derselbe doch vor wenigen Jahren erst große Summen, angeblich 54.000 Taler, dazu verwendet. Allein was geschah? Man kaufte mit dem Gelde den reichen Kaufleuten ihre Ladenhüter ab und den Armen kam nichts davon zugute. Viel wirksamer ist in dieser Beziehung das Bestreben des Kaufmanns Karl Heicke in Leipzig, der sich den Scherznamen „Vater des hungernden Erzgebirges“ wirklich verdient hat, der einen Verein zustande brachte, welcher bereits die Mittel aufbot, mehrere hundert Arbeiter zu beschäftigen, und zwar zu dem in guten Zeiten üblichen Lohne; der aber sich die Mühe und Kosten nicht verdrießen lässt, selbst zu sehen und selbst zu handeln, so dass die Hilfe den Armen direkt zufließt, nicht unberufenen Mittlern, die in der guten Zeit von dem Fleiße der Armen so viel bei Seite gebracht, dass sie das jetzige Elend ruhig ansehen können.
2 Refraktion: Lichtbrechung.
3 Feier, feiern (mittelhochdeutsch vire, Festtag): Tage, an denen nicht gearbeitet wird.
4 Wilhelm Schaffrath, Jurist, linksliberaler Politiker und zu jener Zeit Abgeordneter im Sächsischen Landtag.
Die Frauen sind die Trägerinnen der jedesmaligen Volkssittlichkeit. (...) Ändert sich die Sittlichkeit? Ganz gewiss! Denn welches Prinzip ist bis jetzt ewig bleibend gewesen? Welches konnte aber auch ewig bleibend sein, da jedes schließlich seine Schranke und Endlichkeit herauskehren muss. Es gibt kein perpetuum immobile, wohl aber ein perpetuum mobile, nämlich den Geist: Es liegt im Wesen der Geschichte oder, wie ein öffentliches Blatt sich neulich richtiger ausdrückte, der menschlichen Natur, in steter Bewegung zu sein, sich im ewigen Wechsel ewig zu verjüngen und so immer vollkommenere Entwicklungsphasen hervorzutreiben, eine Ansicht, die übrigens auch in den biblischen Worten liegt: Es muss Ärgernis kommen. Weiterlesen
Und worin besteht nun die heutige Volkssittlichkeit? Offenbar in der Teilnahme aller Einwohner des Staats am Staat; dies ist die summa fidel, das Ideal des Strebens. Es ist also nicht bloß auf die Frage, ob es ein Recht sei, am Staat teilzunehmen, zu erwidern, es sei eine Pflicht, wie es neulich ein öffentliches Blatt tat, nein, es ist ausdrücklich zu sagen, dass es unsittlich sei, dies zu unterlassen. Es ist nicht mehr das Höchste für den Menschen, seiner Familie Wohl zu wollen und zu sorgen, dass seine Haussöhne und Töchter ein gutes Auskommen erhalten, eine gute Karriere machen, respektive glücklich (was man so nennt) verheiratet werden; diese Art und Weise, für den Menschen nur als Einzelnen zu sorgen, heißt vielmehr mit Recht philisterhaft. Die Teilnahme an der Gemeinde, am Staat und an den Staaten oder der Menschheit, das erst macht heutzutage den Menschen zum Menschen. Wenn alle Menschen hierzu berufen sind, in welcher besonderen Weise werden dann die Frauen ihre Teilnahme zu äußern haben? – Indem wir die Frage so stellen, sprechen wir damit von vorneherein uns gegen die frühere Ansicht der gänzlichen Ausschließung der weiblichen Welt von der Teilnahme am Staatsleben aus. Es wäre dies in der Tat gegen die Bestimmungen der Gegenwart, gegen den wahrhaften Zeitgeist, und wenn wir nicht mit ihm in Widerspruch treten wollen, so müssen wir von diesem Satz durchgängig ausgehen. Gegen die gänzliche Ausschließung der weiblichen Welt vom Staat, gegen ihre philisterhafte Einpferchung in den engen Kreis eines Hauswesens, hat offenbar das Extrem der Emanzipation der Frauen ein berechtigtes Moment in sich. Ja es ist wahr, jene Teilnahmslosigkeit ist etwas Trübseliges, es sträubt sich das Gefühl dagegen, dass das Weib, welches in einem als die Krone der Schöpfung angepriesen wird, doch von der höchsten Weise menschlicher Tätigkeitsäußerung gänzlich ausgeschlossen bleiben soll.
Dennoch aber sagt uns wiederum das Gefühl, dass die Emanzipation der Frauen eben auch unwahr ist, und es fragt sich somit, aus welchem Grunde, damit wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Das Wesen des Weibes, nur noch für faselnde Poeten ein Geheimnis, besteht ganz allgemein ausgedrückt im Beharren. Was der Schlaf am Individuum ist, diese nicht passive, aber in sich geschlossene Erquickung und Erholung des Körpers, das ist das Weib für die Menschheit. Wenn daher Rousseau bemerkt, es sei das Laufen das einzig Ungraziöse an ihr, so liegt eben darin, dass das zu bewegte Auftreten ihr nicht ziemt. Dasselbe gilt in der geistigen Sphäre: Es schickt sich für sie eine energische, aber keine eingreifende, eine mutvolle, aber nur innig ausdauernde und ausharrende, mit einem Wort keine männliche Teilnahme am öffentlichen Wesen. Die Emanzipation der Frauen aber verlangt eine solche und darin liegt ihre Verkehrtheit. Das Weib ist wohl geschaffen, dem heimkehrenden Sieger den Kranz aufzusetzen (…), aber weder teilnahmslos gegen ihn zu bleiben und ihn gar zu fliehen noch selbst in die Schlacht zu ziehen und in ihre zarte Hand das raue Eisen zu nehmen. Und nicht bloß im wirklichen Kampf kann sie diese Art der Teilnahme bewähren, auch im unblutigen, aber zur Verhinderung der Fäulnis des Staates unumgänglich notwendigen Parteikampf während des Friedens kann so ihre Mitwirkung sich offenbaren. So ziemt es sich nicht für sie, von der neusten Mode oder dem letzten Ball zu sprechen, wenn es an der Zeit ist, den süßen Namen Vaterland im Munde zu führen; es ziemt sich nicht für sie, davon zu reden, wie schlecht sich Herr und Madame X. in ihrer Ehe vertragen, wenn es sich fragt, ob im Staat noch nicht zur Anerkennung gekommene unverjährbare Menschenrechte ferner unterdrückt bleiben sollen, es ziemt sich überhaupt nicht für sie, teilnahmslos sich wegzuwenden, sobald nur ein Anflug von Politik in das Gespräch hineingemischt wird. (...)
Wir wiederholen unseren Anfang: Die Frauen sind die Trägerinnen der jedesmaligen Volkssittlichkeit, haben sie den Geist der Zeit noch nicht in sich aufgenommen, so ist derselbe noch nicht in das Fleisch und Blut des Volks aus der Theorie übergegangen, so ist er noch nicht Gesinnung geworden, so bildet er noch nicht die öffentliche Meinung, so dringt die Freiheit der Zeit noch nicht zur allgemeinen Anerkennung durch. Noch schlimmer aber: Das heranwachsende Geschlecht nimmt sie nicht mit der Muttermilch auf und begeistert sie nicht für ihre Einführung in das Leben. Das gilt namentlich von Deutschland; tragen nicht erst unsere Frauen „ein Schwert in Myrten“, klingen Frau und frei ferner noch einander fremd, so ist auf die Lösung der Fragen, in welchen wir nun schon so weit hinter anderen Ländern zurückgeblieben sind, nicht zu rechnen, eher aber darauf, dass unsere tiefsinnige, geistreiche Nation zu den „Parias unter den Völkern“ übergehe.
Allen Patrioten mögen daher die hier ausgesprochenen Ansichten ans Herz gelegt sein; sie werden leider bei flüchtigem Einblick in das Leben finden, wie traurig, wie wahrhaft kläglich und verwahrlost in dieser Beziehung unser Vaterland dasteht. Mögen daher diese Zeilen Anklang finden, und die Erziehung der weiblichen Jugend nicht wie bisher fern gehalten werden von dem Namen, bei dem die Herzen höherschlagen; möge ihr vor allem durch die Kenntnis seiner gedankenmäßig erfassten gewordenen Geschichte Teilnahme für dessen werdende Zukunft eingepflanzt werden. Denn das gehört heutzutage wahrhaftig weit mehr zur Bildung und Gesittung als das Wissen einiger faden französischen und englischen Konversationsphrasen. (…)
Diese Versammlung, meine Herren, erscheint mir oft wie der Prometheus, seine Riesenkraft war angeschlossen an einem Felsen, und er konnte sie nicht brauchen – die Riesenkraft der Versammlung scheint mir zuweilen angeschlossen zu sein an den Felsen des Zweifels, den sie sich selbst aufbaut. Zu verschiedenen Zeiten ist sie sich dieser ungeheuren Kraft bewusst geworden und der Ausdruck derselben genügte, in den Augen der Nation sie wieder auf den Standpunkt zu stellen, den sie einnimmt, den aber der Zweifel auf der anderen Seite ihr streitig zu machen suchte; so bei dem Beschluss über den Raveauschen Antrag1, dem der Zweifel voranging; so bei dem Zweifel, ob man einen Friedensschluss genehmigen könne und dürfe, während es doch sonst niemanden gibt, der ihn genehmigen kann; so bei der Bewilligung der 6 Millionen für die Marine, und so heute wieder, als Sie mit dem großartigsten Schwunge einen Krieg erklärt2 haben, ohne sich zu fragen, ob Sie ein Heer haben und ob Sie eine Flotte haben und ob Sie Mittel dazu haben; aber Sie haben mit der kühnen Erklärung zur gleichen Zeit den Sieg beschlossen, denn der Sieg lebt in uns, nicht da draußen und nicht in materiellen Dingen! Eine neue große Entscheidung schlägt an Ihr Herz, und Sie sollen noch einmal den Zweifel lösen, ob Sie Ihre Gewalt fühlen und die unumstößliche Majestät, die in Ihren Händen liegt, und ob Sie sie gebrauchen wollen. Weiterlesen
1 Antrag des demokratischen Abgeordneten Raveaux vom 19. Mai 1848, dass die Nationalversammlung allen einzelstaatlichen Landtagen übergeordnet sein müsse.
2 Erklärung der Nationalversammlung vom 20. Juni 1848, dass ein Angriff auf die damals zur Habsburgischen Monarchie gehörende Stadt Triest als ein Angriff auf Deutschland betrachtet würde.
Sie sind hier hierhergekommen, um dieses zerstückelte Deutschland in ein Ganzes zu verwandeln; Sie sind hierhergekommen, um den durchlöcherten Rechtsboden in einen wirklichen, in einen starken zu verwandeln. Sie sind hierhergekommen, bekleidet mit der Allmacht des Vertrauens der Nation, um das „einzig und allein“ zu tun. Genügt es dazu, dass wir Beschlüsse fassen und sagen: Die Nationalversammlung beschließt, dass das oder das geschehe? Durchaus nicht. Sie müssen sich das Organ schaffen, durch welches diese Beschlüsse hinausgetragen werden in das Leben, durch welches sie gesetzliche Geltung erlangen; dieses Organ zu schaffen, ist der Gegenstand unserer Verhandlung. Was wird dieses Organ sein? Bei dem ersten Anblick dessen, was wir bedürfen, eben nur das Organ, welches Ihren Willen verkündet. Man sagt uns, der Vollziehungsausschuss, der von einer sehr kleinen Minderheit vorgeschlagen worden ist, sei eine republikanische Einrichtung, und wir geben das sehr gerne zu. Wir verhehlen gar nicht, wir wollen die Republik für den Gesamtstaat, wir wollen diese Einrichtung, und nicht deshalb, weil wir die Verhältnisse in Deutschland auflösen wollen, sondern weil wir sie schützen wollen, weil wir glauben, dass zwei gleichartige Richtungen nicht miteinander bestehen können, weil wir in der republikanischen Form an der Spitze des Gesamtstaates Sicherheit sehen für die Freiheit jedes einzelnen Staates, seinen eigenen Willen auszuführen und zu erhalten, und weil wir zu gleicher Zeit diese Spitze nicht den Zielpunkt niederen Ehrgeizes sein lassen wollen. Allein, es ist ein arger Irrtum, wenn man dieses Streben nach einer republikanischen Einheit verwechselt mit dem, was in den einzelnen Staaten geschieht oder geschehen soll. Wir bauen den Gesamtstaat aus den einzelnen Teilen, die vorhanden sind, wir erkennen die Tatsache dieses Vorhandenseins ebenso wie die Formen an, und unser Bestreben ist dahin gerichtet, in der großen Gesamtheit einer jeden Einzelheit ihre Freiheit, den Spielraum zu ihrer eigentümlichen Entwicklung, zu gönnen und zu belassen. Schaffen Sie den Vollziehungsausschuss3, so sind es die bestehenden Gewalten, die bestehenden Regierungen, welche vom Vollziehungsausschuss die Beschlüsse der Nationalversammlung empfangen, und diese Beschlüsse ausführen; sie werden in ihrem Wesen und in ihrer Kraft nicht im Mindesten angetastet, sie bleiben vielmehr im Vaterlande völlig auf dem Standpunkt, den sie sich zu erhalten bis jetzt vermocht haben. Wenn die Regierungen das sind, was man so vielfach behauptet, gutwillig in Bezug auf die Ausführung und bereit, Opfer zu bringen zum Gedeihen des Ganzen, so ist diese Einrichtung so einfach, dass es keine einfachere gibt; wenn sie aber nicht gutwillig sind, was von anderer Seite auch vielfach behauptet wird und wofür man sich auf einzelne Erscheinungen stützt, die man vielleicht überschätzt, dann (…) soll er die Bedürfnisse der Zeit stellen über die Regierungen, dann soll er ihnen entgegentreten, dann soll er die Nation nicht den Sonderinteressen aufopfern, sondern vielmehr die Widerstrebenden – geradezu heraus gesagt! – zermalmen.
Wäre ein solcher Fall denkbar, ich hoffe, er ist es nicht, dann wäre es eine sonderbare Einrichtung, dass wir denen die Vollziehungsgewalt oder die provisorische Regierung, die es dann allerdings werden müsste, in die Hand geben, gegen die sie handeln soll und handeln muss. – Man hat den Vollziehungsausschuss auch in anderer Beziehung angegriffen und hat ihn ungenügend genannt, da er nur die Vertretung Deutschlands nach außen, nicht die Verteidigung desselben enthält. Nun, es muss in dieser Beziehung ein arges Missverständnis herrschen, denn die Vertretung eines Landes nach Außen besteht nicht bloß im diplomatischen Verkehr, sie besteht auch in der Entwicklung der ganzen Kraft und Gewalt, die eine Nation hat, da, wo sie notwendig wird. Der Vollziehungsausschuss hat ferner einen großen Vorteil: Er gewährt den Regierungen, was sie bedürfen, den Mittelpunkt, in dem das Staatsleben für den Gesamtstaat in diesem Augenblick zusammenläuft. Er ist ihnen, wenn sie wirklich das Beste der Nation wollen, ihr Aufstreben fördern, nicht im Geringsten gefährlich. Er sichert die Versammlung vor jedem Missbrauch; denn die Versammlung hat es in der Hand, ihn zurückzuziehen, sobald er die Begrenzung überschreitet, die sie ihm zu stecken für gut findet. Er sichert die Regierungen auch durch die Wahl; denn wie die Versammlung zusammengesetzt ist, haben sie nicht zu besorgen, dass eine Meinung aufkomme und an die Spitze gestellt werde, die den Regierungen Besorgnisse erregt. Hat doch ein Mann, der in jenen Kreisen lange Jahre gelebt und gewirkt hat, Ihnen ausdrücklich gesagt, dass er ohne alle Besorgnis das Wohl des Gesamt- wie der einzelnen Staaten in den Händen dieser Versammlung sehe. Der Vollziehungsausschuss sichert aber auch das Volk von möglichen Übergriffen, in dem er als ein Ausfluss der von Ihnen erwählten Versammlung, als ein Ausfluss der Gewalt der Träger seiner Majestät und Souveränität dasteht und das Vertrauen des Volkes aus seinem Ursprung schon für sich in Anspruch nimmt. Das Direktorium4, welches man Ihnen vorgeschlagen hat, sichert in dieser Beziehung niemanden. (…)
Sie wollen ein solches Direktorium schaffen, und ich frage Sie: Dürfen Sie dasselbe schaffen? Haben Sie ein Mandat dazu, mit irgendjemandem in der Welt zu verhandeln? Hat eine einzige Wahlhandlung auch nur einen derartigen Vorbehalt nicht aufkommen, sondern nur gewissermaßen als eine Ansicht aufdämmern lassen? – Nirgends in der Welt. Berufen sind Sie durch die Allmacht des Volkes, und Sie sind nur jenem Mandat treu, solange sie diese Allmacht wahren. Sie dürfen nicht verhandeln; Sie müssen eher Ihr Mandat niederlegen als sich von der Aufgabe entfernen, die uns geworden ist. Sie dürfen am wenigsten in dem Augenblick, wo das Volk seine lang verkümmerten Rechte und seine lang verkümmerte Macht errungen hat, mit denen unterhandeln, die seit 30 Jahren niemals mit uns unterhandelt haben, die selbst unseren Rat niemals hörten, wenn es sich darum handelte, Deutschland als ein Ganzes zu vertreten. Allein, es wird auch der Unterhandlungen nicht bedürfen. Wahrlich, diejenigen leisten den Regierungen einen sehr schlimmen Dienst, die sie darstellen als etwas, was außerhalb uns, d. h. außerhalb des Volkes steht; man sagt uns ja immer: „Die Regierungen sind jetzt volkstümlich, sie sind aus dem Volke hervorgegangen, sie gehören dem Volke an.“
Nun wohlan! Wenn das wahr ist, so vertreten wir sie mit, wir vertreten nicht den einzelnen, nicht den Stand, keine Kaste. Wir vertreten das Volk und die Regierungen, sie gehören zum Volk; mindestens sollen sie zum Volk gehören. Wo das nicht der Fall wäre, dass die Regierungen im Volk aufgingen, nun, dann würde nichts vorliegen als die Wahrung der alten Fürsten- und Dynasteninteressen, und wahrlich, ein Volk von 40 Millionen, es würde nicht unterhandeln können mit 34 Menschen, die ihr Sonderinteresse fördern wollen. So ist in unserem Vorschlage nach meiner Überzeugung gewahrt, was sie wahren wollen; das allseitige Recht, die allseitige tatsächliche Stellung ist anerkannt, wenn Sie sich darauf beschränken, zu erklären, was Sie bedürfen, und wenn Sie warten in Beziehung auf die Ausdehnung der Gewalt, bis Sie sie bedürfen.
Man hat uns vielfach in diesen Tagen darauf hingewiesen, es herrsche die Anarchie, und sie trete hervor an diesem und jenem Orte in Deutschland, und das ist wahr, leider ist es wahr; aber fragen Sie, was ist denn diese Anarchie. Ist sie etwas anderes als die Zuckungen der Ungeduld, die in dem gehemmten Leben sich kundgibt, die Zuckungen der Kraft, die nach außen oder nach innen sich geltend machen will? In einer Weise, wie es die Weltgeschichte noch nie gesehen hat, hat das Volk in Deutschland seine Revolution gemacht; es hat mit wenigen Ausnahmen die Gewaltäußerungen gescheut, weil eine revolutionäre Volksversammlung, eine revolutionäre Nationalvertretung im Vorparlament hier zusammentrat und dem Gesamtausdruck seine Geltung zu verschaffen suchte. Es hat sich gemäßigt, weil aus jener revolutionären Volksvertretung eine zweite, gleichartige, wenn auch in anderer Beziehung auf einem Gesetz beruhende Volksvertretung sich gestaltete; verhehlen wir es nicht: eine auf dem Gesetz der Revolution beruhende Versammlung, die ihm versprach, seine Wünsche zur Geltung zu bringen, seine Bedürfnisse zur Wirklichkeit zu machen. Wollen Sie der Anarchie entgegentreten, Sie können es nur durch den innigen Anschluss an die Revolution und ihren bisherigen Gang. Das Direktorium, das Sie schaffen wollen, ist aber kein Anschluss daran; es ist ein Widerstand, es ist Reaktion, es ist Konterrevolution – und die Kraft erregt die Gegenkraft.
Man wirft mitunter schielende Blicke auf einzelne Parteien und Personen und sagt, dass sie die Anarchie, die Wühlerei und wer weiß was wollen. Diese Partei lässt sich den Vorwurf der Wühlerei gern gefallen; sie hat gewühlt ein Menschenalter lang, mit Hintansetzung von Gut und Blut, mindestens von allen den Gütern, die die Erde gewährt; sie hat den Boden ausgehöhlt, auf dem die Tyrannei stand, bis sie fallen musste, und Sie säßen nicht hier, wenn nicht gewühlt worden wäre. (Stürmischer, anhaltender Beifall in der Versammlung und auf den Galerien.) (...)
Meine Herren! Es gab einen Staat in Deutschland, der auch stark war, der auf dem historischen Rechtsboden stand, auf Ihrem historischen Rechtsboden, der uns hier so oft vorgeführt wird. (…) Es ist nach meiner Ansicht eine Gotteslästerung der Freiheit, wenn man ihr aufbürdet, dass sie krankt an dem Erbe, welches sie von der Despotie unfreiwillig hat mit übernehmen müssen. Es ist eine Gotteslästerung an der Menschlichkeit, wenn man darauf hinweist, dass dieser Staat achtzigtausend seiner hungernden Brüder hat ernähren müssen. Diese achtzigtausend Hungernden kosten nicht so viel, als der gestürzte Thron gekostet hat, und man kann noch eine Null hinzufügen, und sie kosten immer noch nicht so viel. Abgesehen davon, dass in dem Sumpfe, der sich um diesen korrumpierenden Thron ausgebreitet, neben aller Sittlichkeit, Ehre und Tugend auch alle Mittel verschlungen wurden, die nötig waren, um die Hungernden zu ernähren. Auf dem historischen Rechtsboden, auf welchem wir angeblich stehen, hat man in einem ganz ähnlichen Falle die Hungernden lieber der Hungerpest preisgegeben. Dorthin, wo man das Gespenst hervorruft, wird die Freiheit den Kranz des unverwelklichen Dankes niederlegen, wenn sie siegt; und wenn sie unterliegt, wird auch der letzte sehnsüchtige Blick ihres brechenden Auges sich dorthin wenden. Wollen Sie das Himmelsauge brechen sehen und die alte Nacht über unser Volk aufs Neue herausführen, so schaffen Sie Ihre Diktatur. (Stürmisches Bravo.)
3 Die Linke der Frankfurter Nationalversammlung forderte entsprechend einem Antrag von Robert Blum und Wilhelm Adolph v. Trützschler, als provisorische Zentralgewalt einen fünfköpfigen Vollziehungsausschuss einzusetzen, der ausschließlich an die Beschlüsse der Nationalversammlung gebunden sein sollte.
4 Die liberale Mehrheit der Frankfurter Nationalversammlung wollte als provisorische Zentralgewalt ein Direktorium aus drei von den Regierungen der Einzelstaaten vorzuschlagenden Männern einsetzen. Das Dreierdirektorium sollte sich gegenüber der Nationalversammlung nicht rechtfertigen müssen.
Heldenmütige Bewohner Wiens!
Unsere Gesinnungsgenossen in der Nationalversammlung zu Frankfurt haben uns hierher gesandt, Euch die Bewunderung auszusprechen, die sie mit uns und ganz Europa Euch zollen. Da die Verhältnisse nicht gestatten, unsere Aufgabe in anderer Weise zu lösen, zu Euch zu sprechen in der Versammlung des Volkes, so wenden wir uns auf diesem Wege an Euch. Ihr habt mit einem großen Schlage die Ränke einer volks- und freiheitsfeindlichen Partei vernichtet! Habt Euch mit bewundernswerter Aufopferung für das ganze Deutschland wie für die Völker Österreichs erhoben wie ein Mann. Eure Heldentat flößt allen Kämpfern der Freiheit neuen Mut ein, und Eure Erhebung sichert unserem Kampf den Sieg. Euer Beispiel wird uns allen voranleuchten und wir werden Euch nacheifern auf dem glorreichen Pfad, um wert zu sein, Euch Brüder zu nennen.
Wir aber, die wir gesandt sind, Euch den Bruderkuss und die heißen Segenswünsche von vielen Tausenden zu überbringen, wir preisen uns glücklich, in diesem verhängnisvollen Augenblicke in Eurer Mitte zu weilen, und wenn es das Schicksal will, Eure Gefahren zu teilen, mit Euch zu stehen und zu fallen. Heldensöhne Wiens, empfangt den Ausdruck unserer Bewunderung und unseres tiefempfundenen Dankes!
Die Abgesandten der Vereinigten Linken in der deutschen Nationalversammlung zu Frankfurt a. M., Robert Blum, Julius Föbel, Moritz Hartmann, Albert Trampusch
1 In den Morgenstunden des 6. Oktober 1848 begann die „Wiener Oktoberrevolution“. Als die Nachrichten darüber am 12. Oktober in Frankfurt eintrafen, schickte die Nationalversammlung eine Delegation in die Donaumetropole. Gemeinsam mit drei weiteren Abgeordneten machte sich Blum am 13. Oktober auf den Weg und traf am 17. Oktober in Wien ein.
30. Oktober 1848
Liebe Jenny!
Die Schlacht ist verloren, das boshafte Glück hat uns geäfft. Nein, das Glück nicht; der schmachvollste Verrat, den jemals die Weltgeschichte gesehen hat, war derart gesponnen, dass er im Entscheidungsaugenblick und nur und allein an diesem ausbrach. Ich habe am Samstag noch einen sehr heißen Tag1 erlebt, eine Streifkugel hat mich sogar unmittelbar am Herzen getroffen, aber nur den Rock verletzt. Wien kapituliert eben, und wahrscheinlich wird die Innere Stadt heute Abend oder morgen übergeben. Dadurch sind einige noch unbesiegte Vorstädte dann ebenfalls bezwungen oder werden’s wenigstens leicht. Ein Teil des Heeres – d.h. des städtischen Heeres – will die Waffen nicht ablegen, besonders sind die übergetretenen Soldaten in wahrer Raserei. Es kann demnach noch sehr schlimme Szenen im Inneren geben. – Sobald der Verkehr wieder beginnt, reise ich ab und komme nach Leipzig. Rede mit meinen Freunden, ob sie es für zweckmäßig halten, dass ich dort einen öffentlichen Bericht gebe. Meinen sie das, so sollen sie Plakate drucken lassen des Inhalts: Weiterlesen
1 Blum war am 28. Oktober 1848 als Kompaniechef der Elitekorps mit seiner Kompanie zur Verteidigung der Nußdorfer Linie eingesetzt.
Heute wird R.B. von Wien hier eintreffen etc., also ohne Datum, damit man sie, wenn ich mit dem ersten Zug komme, noch anschlagen kann. Friese wird Dir am besten darin raten. Den Inhalt dieses Briefes schreibe kurz an C. Vogt, Mitglied der konstitutionellen Nationalversammlung in Frankfurt.
Ich kann nicht mehr schreiben, mein Herz ist zerrissen von Zorn und Wut und Schmerz. Lebe wohl! Auf baldiges Wiedersehen! Gruß und Kuss! Robert
6. November 1848
Meine liebe Jenny!
Als ich Dir meine letzten Zeilen schrieb, deren Kürze die Umstände geboten, glaubte ich denselben auf dem Fuße zu folgen und wenigstens kurze Zeit in meinem Hause zu verleben. Das ist anders geworden, und ich werde unfreiwillig hier zurückgehalten, bin verhaftet. Denke Dir indes nichts Schreckliches, ich bin in Gesellschaft Fröbels, und wir werden sehr gut behandelt. Allein die große Menge der Verhafteten kann die Entscheidung wohl etwas hinausschieben. Sei also ruhig, und wenn Du das bist, wirst Du zu meiner Ruhe wesentlich beitragen. Ich denke Dich stark und gefasst und bin’s deshalb selbst. (…) Leb recht wohl, bleibe gesund und heiter, grüße alle Freunde und empfange für Dich und unsere lieben Kinder von Herzen Gruß und Kuss von Deinem Robert.
9. November 1848
„Mein teures, gutes, liebes Weib, lebe wohl, wohl für die Zeit, die man ewig nennt, die es aber nicht sein wird. Erziehe unsere – jetzt nur Deine Kinder zu edlen Menschen, dann werden sie ihrem Vater nimmer Schande machen. Unser kleines Vermögen verkaufe mit Hilfe unserer Freunde. Gott und gute Menschen werden Euch ja helfen. Alles, was ich empfinde, rinnt in Tränen dahin, daher nochmals: leb wohl, teures Weib! Betrachte unsere Kinder als teures Vermächtnis, mit dem Du wuchern musst, und ehre so Deinen treuen Gatten. Leb wohl, leb wohl! Tausend, tausend, die letzten Küsse von Deinem Robert.
Morgens 5 Uhr, um 6 Uhr habe ich vollendet. Die Ringe habe ich vergessen; ich drücke Dir den letzten Kuss auf den Trauring. Mein Siegelring ist für Hans, die Uhr für Richard, der Diamantknopf für Ida, die Kette für Alfred als Andenken. Alle sonstigen Andenken verteile Du nach Deinem Ermessen. Man kommt! Lebe wohl, wohl!
Volksthümliches Handbuch der Staatswissenschaften und Politik. Ein Staatslexikon für das Volk (2 Bände). Verlagsbuchhandlung Blum & Co., 1848/1851.
Vorwärts: Volks-Taschenbuch für das Jahr 1843. Herausgegeben von Robert Blum und Friedrich Steger, Leipzig 1843, Verlag von Robert August Friese.
Die Fortschrittsmänner der Gegenwart. Eine Weihnachtsgabe für Deutschlands freisinnige Männer und Frauen. Herausgegeben von Robert Blum. Leipzig, 1847. Verlag von Robert Blum & Co.
Robert Blum: Ein Zeugnis seines Lebens. Nach zeitgenössischen Dokumenten. Bearbeitet von Dr. Heinz Füssler. Herausgegeben vom Städtischen Museum – Zwickau (Sachsen), 1948.
Selbstbiographie von Robert Blum und dessen Ermordung in Wien am 9. Novbr. 1848: Herausgegeben von einem seiner Freunde. Leipzig und Meißen, Verlag von F.W. Goedsche 1848.
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt (Main). Herausgegeben von Franz Wigard. Frankfurt (Main) 1848f.
Briefe und Dokumente, Reclam Leipzig 1981.
Arthur Frey: Zur Erinnerung an einen Todten. Robert Blum als Mensch, Schriftsteller und Politiker. Mannheim, J.P. Grohe 1849.
Eduard Sparfeld: Das Buch von Robert Blum. Ein Denkmal seines Lebens und Wirkens, Leipzig 1849
Hans Blum: Robert Blum. Ein Zeit- u. Charakterbild für das deutsche Volk. Leipzig 1878.
Ralf Zerback: Robert Blum. Eine Biographie, Leipzig 2007.
Peter Reichel: Robert Blum. Ein deutscher Revolutionär 1807-1848, Göttingen 2007.
ROBERT BLUM

Abb.: Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig (XVb/58)
Am frühen Morgen des 9. November 1848 erfährt Robert Blum, dass das gegen ihn verhängte Todesurteil vollstreckt wird. Auf den Beistand eines Priesters verzichtet er und schreibt stattdessen noch schnell einige Briefe: „Es ist 5 Uhr und um 6 werde ich erschossen. Ich sterbe als Mann – es muss sein.“
Ein tragischer und folgenschwerer Verlust für die deutsche Demokratiebewegung. Tragisch deshalb, weil der mitreißende Redner und allseits geschätzte Politiker stets gegen jede Gewalt eingetreten war und sich nun, während er als führender Abgeordneter der deutschen Nationalversammlung eine Solidaritätsadresse an die Wiener Aufständischen überbringen wollte, von der Atmosphäre hatte überwältigen lassen und sich an den Kämpfen beteiligte, nach deren Niederschlagung er, trotz Immunität, verhaftet wurde; folgenschwer, weil das gerade erkämpfte Parlament in Deutschland seinen vielleicht bedeutendsten Vertreter verlor. Und genau das war das Kalkül des kaiserlichen Militärs. Überall in Europa stemmten sich die Adelshäuser gegen den demokratischen Wandel.
Mit der Hinrichtung von Robert Blum wollte man ein Exempel statuieren. All das, wofür er stand – politische Mitbestimmung aller Bürger, parlamentarische Verfassung und Rechtsstaatlichkeit, sozialer Ausgleich und freier Zugang zur Bildung –, sollte geschwächt werden. Und wurde geschwächt. Doch seine Ideen, davon war Blum überzeugt, würden sich auf Dauer nicht aufhalten lassen. Er sollte Recht behalten, wenn auch mit großer Verzögerung. Genau 70 Jahre nach seinem Todestag, am 9. November 1918, wurde von Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht die erste deutsche Republik ausgerufen.
Am 10. November 1807 wird Robert Blum in Köln geboren. Der Vater, Engelbert, arbeitet in einer Stecknadelfabrik, die materiellen Verhältnisse sind äußerst bescheiden.
Als im Juni der Vater stirbt, verschlechtert sich die Lage dramatisch, die Armut wird drückend. Trotz offenkundiger Begabungen muss Robert die Schule verlassen, um die Familie, er hat zwei jüngere Geschwister, zu unterstützen.
Nach Gelegenheitsarbeiten, einer Ausbildung zum „Gelbgießer“ und den darauffolgenden Wanderjahren, die Walz, in denen er sich autodidaktisch fortbildet, kommt Blum nach Berlin und wird dort Gasthörer an der Universität, wo er auf ihn prägende Denker wie Friedrich Schleiermacher, Georg Friedrich Wilhelm Hegel oder Leopold von Ranke trifft.
1832 folgt Blum dem bisherigen Kölner Theaterdirektor Ringelhardt nach Leipzig und wird Theatersekretär, ein Glücksfall, weil ihm die Stücke und die Theaterbibliothek reiche Möglichkeiten zur weiteren Selbstbildung geben. Er beginnt zu publizieren.
Blum schreibt nun regelmäßig für die „Sächsischen Vaterlands-Blätter“, ein Sprachrohr der linken Opposition in Sachsen. Meinungs- und Pressefreiheit, soziale Gerechtigkeit und eine nationale und demokratische Einheit sind seine bevorzugten Themen.
Für das von Blum von nun an jährlich herausgegebene „Vorwärts! Volks-Taschenbuch“ schreibt er selbst zahlreiche Artikel. Sowohl die Bücher als auch die „Vaterlands-Blätter“ sind ständig von der Zensur bedroht; die Zeitung wird 1845 verboten.
Als im August der sächsische Prinz Johann das politisch unruhige Leipzig besucht, kommt es zu Demonstrationen, die vom königlichen Militär gewaltsam beendet werden. Tags darauf versammeln sich Tausende Demonstranten und fordern Vergeltung. Robert Blum tritt auf die Tribüne und mahnt zur Besonnenheit. Mit Erfolg. Im gleichen Jahr wird er mit der höchsten Stimmzahl aller Bewerber zum Leipziger Stadtverordneten gewählt.
Im Mai 1848 schicken ihn die Leipziger dann auch als ihren gewählten Abgeordneten in die Nationalversammlung nach Frankfurt. Dort wird Blum zum Sprecher der demokratischen Linken.
Im Oktober 1848 kommt es in Wien zu einem revolutionären Aufstand. Als Leiter einer Delegation der Linken aus der Nationalversammlung reist Blum dorthin, lässt sich von der Atmosphäre mitreißen und greift selbst zur Waffe. Der Aufstand wird niedergeschlagen, er selbst verhaftet und am 9. November trotz seiner Immunität als Abgeordneter standrechtlich erschossen.
Die Revolution ist beendet, die Nationalversammlung löst sich auf. Die Verfassung, an der Blum mitgearbeitet hatte, bleibt für lange Zeit nur ein Versprechen.
Gabriele Gillen
Robert Blum: Kein Mann zum Verlieben! „Denkt euch eine platte, sattelförmige Nase, zwei kleine graue, tiefliegende Augen, eine flache holprige Stirn, einen Mund, der sich unter der Nase in sich selbst verkriecht und einen struppigen, urwalddichten rotblonden Bart, und ihr habt ungefähr einen Umriss des Blumschen Kopfes. Und dieser Kopf scheint gar nicht, wie bei anderen Sterblichen, an seinem Hals zu sitzen, sondern ist unmittelbar zwischen die breiten Schultern gequetscht“, so war es 1848 in der von Ludwig Kalisch gegründeten Sonntagszeitung „Der Demokrat“ zu lesen.1 Das ist nicht sonderlich schmeichelhaft, aber es ist auch nicht hämisch gemeint: „Übersichten über gewisse Entwicklungsperioden der Zeit knüpfen sich am bequemsten an Personen an. In der Persönlichkeit ist ein Bleibendes, während die Ereignisse vergehen. (...) Männer, in denen der Geist der Zeit Fleisch geworden ist.“ Eine Formulierung, die gut zu dem politischen Dschungelkämpfer Robert Blum passt. Tatsächlich verkörpert er unsere demokratische Gründerzeit; die revolutionären Träume von einer Republik, in der die Bürger- und Menschenrechte für jeden und jede gelten; von einem für alle verlässlichen Rechtsstaat; von einem Europa, in dem freie Völker in Frieden zusammenleben. Denn: „Was wäre auch die Freiheit, wenn sie nicht jedem Menschen und jeder Meinung vergönnt sei?“2 Robert Blum: Ein Mann zum Verlieben! Weiterlesen
Wer sich mit seinem Leben, seinen Kämpfen, mit seinen Texten, Reden und Briefen beschäftigt, entdeckt einen wilden, abenteuerlustigen Geist; eine immer wache Beobachtungsgabe; die funkelnde Freude an der Sprache und am Denken; den Mut für Aufbruch und Wandel; den Mut, im stürmischen Gegenwind seinen Überzeugungen treu zu bleiben. Und einen heute kaum noch zu erlebenden fröhlichen Glauben an die Zukunft. „Die Zeit, in der wir leben, ist eine der schönsten und größten, die es je gegeben. (...) Alles will mit Kraft vorwärts“, schrieb Blum 1840.3 Und verkörpert mit diesem Glauben, mit dieser Hoffnung auch den Geist der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Überall brach das Neue herein. Mit den Ideen der französischen Revolution – „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ – hatte in Europa eine neue politische Zeitrechnung begonnen; die Selbstverständlichkeit, mit der sich Kaiser und Könige über Jahrhunderte als gottgewollte Herrscher dargestellt hatten, wurde allerorts hinterfragt; die miteinander vernetzten und verschwägerten europäischen Königshäuser mussten Antworten finden auf den wachsenden Nationalismus, also auf die Forderung nach souveränen Staaten; die von England ausgehende Industrielle Revolution mit ihren neuen Herstellungsmethoden, Transportmitteln und technischen Errungenschaften wälzte die Wirtschaft um und schuf über den Besitz oder Nichtbesitz von Produktionsmitteln eine neue Klassengesellschaft, auch mit der Möglichkeit von Auf- und Abstieg; neben der Innerlichkeit und der Naturschwärmerei waren das Individuum und die Freiheit zentrale Begriffe der Romantik, der künstlerischen und intellektuellen Bewegung jener Zeit, Malerei oder Theater lösten sich aus ihren Abhängigkeiten von den Fürstenhäusern und suchten nach Autonomie; die Erfindung der Schnellpresse ermöglichte das Drucken und Verbreiten zahlreicher politischer Schriften und das Überlisten der überall herrschenden Zensur: kaum war eine Zeitung, war eine Buchreihe verboten, erschien unter einem anderen Namen eine neue Publikation derselben Herausgeber.
Aufbruch und Wandel waren die Stichworte der Zeit. Während der Adel auf die Rückkehr der guten alten Vergangenheit hoffte, wurden die Umbrüche in den bürgerlichen Kreisen als Chance für die Gestaltung einer neuen Gesellschaft gesehen. Damit einher gingen Forderungen nach einer breiteren Bildung, nach einer Förderung des Einzelnen. Hinter dieser Idee steckte auch die Vorstellung, durch mehr Bildung mehr Leistung und durch mehr Leistung mehr Besitz oder Reichtum zu erreichen – zur Abgrenzung nach unten von den armen Industrie- oder Landarbeitern, aber auch als Kampfansage an das Geburtsvorrecht des Adels, dem seine Privilegien selbst dann garantiert waren, wenn er – wie es der Schriftsteller Lorenz von Westenrieder formulierte – an „tierischer Unwissenheit und Dummheit“ litt.4 Und Robert Blum wird 1848 in dem von ihm herausgegebenen „Volksthümlichen Handbuch der Staatswissenschaften und Politik“ über Bildung schreiben: „Wie die Sonne des Himmels für jeden da ist, der hinaustreten und sich ihrer erfreuen will, so muss das Licht des Geistes, welches die Bildung fördert und ausbreitet, jedem zugänglich sein.“
Davon konnte Robert Blum selbst, geboren 1807 im damals zum Kaiserreich Frankreich gehörenden Köln, nur träumen. Zwar hatte ihm der bildungsinteressierte Vater vor seinem frühen Tod noch Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht, doch Not und Armut ließen nur einen kurzen Schulbesuch zu. (Kinder-)Arbeit statt Bildung. Ein Leben lang, so schreibt der Blum-Biograph Ralf Zerback, habe Robert Blum darunter gelitten, dass er nur eine kurze Zeit zur Schule gehen konnte.5 Doch sein Bildungshunger, gepaart mit einer im frühen Überlebenskampf erworbenen Zähigkeit, suchte sich andere Wege, Wissen zu erwerben. Auf den jahrelangen Wanderjahren als Gelbgießergeselle und später als Angestellter der Kölner „Gesellschaft zur Beleuchtung der Städte“, die Straßen und Parks illuminierte, reiste er zu Fuß oder später mit der Kutsche in fast alle Fürstentümer und freien Städte Deutschlands. Er verfasste immer lebendiger werdenden Reiseaufzeichnungen, schärfte seinen Blick für Kultur, Architektur und soziale Zustände und suchte unterwegs alle erreichbaren Bibliotheken auf, außerdem Theater und Museen. Er las in jeder freien Minute; Tag für Tag, Nacht für Nacht erweiterte er seinen Wortschatz und seine Kenntnisse der belletristischen, philosophischen oder naturwissenschaftlichen Literatur. Im August 1830 kehrte er zurück nach Köln, wo er am Stadttheater eine Stelle als Theaterdiener fand. Das war zwar die unterste Stufe der Hierarchie, aber Intendant Friedrich Sebald Ringelhardt erlaubte ihm die Nutzung der Theaterbibliothek. Blum studierte, so weit vorhanden, die gesamte dramatische Literatur. Und entdeckte Friedrich Schiller, der ihn nachhaltig begeisterte und aus dessen Werken er zu lernen suchte, wie eine politische Botschaft in die Herzen und Köpfe der Menschen zu pflanzen sei.
1813 war die französische Armee in der blutigen Völkerschlacht bei Leipzig, der entscheidenden Schlacht der Befreiungskriege, besiegt worden, Napoleon musste sich aus Deutschland zurückziehen. 1815 beschloss der Wiener Kongress im Rahmen der territorialen Neuordnung, dass das Rheinland von nun an zu Preußen gehöre und damit zum neu geschaffenen Deutschen Bund. Ziel des Adels war die Restauration, die Wiederherstellung der früheren Verhältnisse. Doch die revolutionären Hoffnungen lebten weiter und die Pariser Julirevolution von 1830 bedeutete für die Generation Blums einen neuen politischen Aufbruch. Der Pariser Funke sprang über: in Polen, in Italien, in London. Überall gingen die Menschen gegen die alten Mächte auf die Straße, demonstrierten für ein neues Wahlrecht, für Grundrechte. Im Deutschen Bund wurden in Hannover, Kurhessen, Braunschweig und in Sachsen moderne Verfassungen erzwungen. Es erschienen zahllose revolutionäre Schriften. In Wirtshäusern wurde es üblich, Zeitungen vorzulesen, Handwerker und Lohnarbeiter nahmen an politischen Gesprächen und Debatten teil. In Rheinhessen, der Pfalz und in der Rheinprovinz sangen ländliche und städtische Unterschichten Freiheitslieder, pflanzten Freiheitsbäume und organisierten politisierte Katzenmusiken gegen Vertreter der staatlichen Behörden. Ein Höhepunkt der Bewegung ist im Mai 1832 das Hambacher Fest, eine riesige Demonstration für nationale Einheit, Freiheit und Volkssouveränität in der zum bayrischen Königreich gehörenden Rheinpfalz. Umbruch liegt in der Luft. Unter dem Eindruck der Pariser Julirevolution dichtet der 22jährige Robert Blum: „Ringet kühn für Recht und Freiheit. Jauchzet: Hoch die freie Welt.“6
Zur Spielzeit 1831/1832 wechselt Ringelhardt ans Theater in Leipzig. Blum folgt ihm 1832. Mit seinem Umzug in die sächsische Buch- und Kulturmetropole Leipzig, mitten hinein in den politischen Gärungsprozess des Vormärz, wird Robert Blum zu einem unermüdlichen politischen Aktivisten für Freiheit und Recht. Eine neue Welt tut sich für ihn auf, erst hier begreift er das Theater als einen der wenigen öffentlichen Räume, als Bühne des Volkes, die Verbindung von Sprache und Politik.
Die Arbeit im Theater inspiriert Blum, seine vielfältigen Talente auszuprobieren und zu entwickeln. Er ist Theatersekretär, Bibliothekar und Kassierer. Er schreibt Dramen, Gedichte und außerdem erste Feuilletontexte für verschiedene populäre Zeitungen und Zeitschriften. Gemeinsam mit dem Schriftsteller Carl Herloßsohn und dem Humoristen Hermann Marggraff veröffentlicht er ein „Allgemeines Theater-Lexikon“, eine „Encyklopädie Alles Wissenswerthen für Bühnenkünstler, Dilettanten und Theaterfreunde“, in der er ebenso über wichtige Theater in der Welt wie über das Haar als „schönste und natürlichste Zierde“ des Kopfes schreibt und eine kleine Kulturgeschichte der Haartracht liefert. Er bewirkt die Gründung des Leipziger Schillervereins, bei dessen wiederkehrenden Schiller-Feiern er als Hauptredner regelmäßig Triumphe feiert. Zusammen mit dem Geschichtsprofessor und Literaten Friedrich Steger gibt er zur politischen Bildung der unteren Klassen den „Verfassungsfreund. Volksschriften über staatsbürgerliche Angelegenheiten" und außerdem eine Publikation mit dem Titel „Vorwärts!“ heraus, ein jährliches Volkstaschenbuch mit Essays oder biografischen Porträts. Er arbeitet als Redakteur bei den „Sächsischen Vaterlands-Blättern"; er gründet eine Buchhandlung, in der u.a. das „Staatslexikon für das deutsche Volk" erscheint, für das Blum zahlreiche Artikel verfasst. Als Adressat hat Blum vor allem das einfache Volk vor Augen, dem er entstammt, das er kennt und dem er über den Weg der Bildung zur Emanzipation und zur Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben verhelfen will. Er beschreibt Hintergründe, erklärt Zusammenhänge und Begriffe. Er klärt auf. Kein Thema, kein politisches Stichwort, zu dem er nichts zu sagen, über das er noch nicht nachgedacht hätte: Freiheit oder Gleichheit, Gerechtigkeit oder Rechtsstaat, Militär oder Kirche, Bildung oder – zum Beispiel – politische Ideen: „Auch jetzt verlacht man noch die Ideen einer gerechteren Verteilung der Lebensgüter, eines allgemeinen Wohlstandes, einer Aufhebung der Armut und Verarmung. Allein auch sie werden unaufhaltsam der allgemeinen Anerkennung, dem Durchbruch, der Herrschaft entgegen reifen.“ Jeder von Blums Texten endet optimistisch, mit einem geradezu kindlichen Glauben daran, dass die bessere Zukunft nur noch wenige vernünftige Schritte entfernt ist. Ein Glaube, der unserer Gegenwart längst abhandengekommen ist.
Die Tätigkeit im Theater sichert auch den Lebensunterhalt der größer werdenden Familie Blums. Doch das Politische und die politische Publizistik werden immer mehr zum eigentlichen Lebensinhalt von Robert Blum. Blum ist ein politischer Visionär mit dem Instinkt eines Populisten, den er im Kölner Armen-Ghetto, auf seinen Reisen, in Versammlungen entwickelt hat. Er spürt, was die Stunde geschlagen hat, er wittert die Revolution. Und bereitet sich vor. Blum knüpft Kontakte, vorerst im Verborgenen, um den vormärzlichen Überwachungsstaat nicht auf den Plan zu rufen. Die Karlsbader Beschlüsse erlauben es nicht, offen gegen die antidemokratischen Zustände im Land vorzugehen: Überwachung, Denunziation, Pressezensur und Willkürjustiz bedrohen die Opposition. Auch Blum wird in Sachsen überwacht. Er gründet zahlreiche Vereine, mit denen politische Diskussionen und Veranstaltungen getarnt werden können. Neben dem Schillerverein zum Beispiel den sogenannten „Redeübungsverein“ oder die „Kegelgesellschaft“. Im März 1848 folgt der „Leipziger Vaterlandsverein“.
Robert Blum ist überall präsent. Seine Aktivitäten in Leipzig verblüffen durch ihre Vielfalt und ihre Entschlossenheit. Die politischen Botschaften müssen unters Volk gebracht werden, um ihre Wirkung zu entfalten. Das Netzwerk, das Blum knüpft, reicht schon bald weit über Sachsen hinaus. Robert Blum wird unter den führenden Liberalen des Deutschen Bundes zu einer maßgeblichen Gestalt. Im September 1844 muss Blum wegen angeblicher Verunglimpfung der königlich sächsischen Justizbehörden in den „Vaterlands-Blättern“ für einige Woche ins Gefängnis. Seine Schwester Margarete drängt ihn, sich politisch zurückzuziehen. Er könne sowieso nichts ändern. Blum antwortet ihr geradezu empört: „Es hätte nie ein Christentum und eine Reformation und keine Staatsrevolution und überhaupt nichts Großes und Gutes gegeben, wenn jeder stets gedacht hätte: ,Du änderst doch nichts!’ Glaubst Du etwa, es sei ein Spiel, dieser Kampf gegen die Übergriffe und unrechte Stellung der Staatsgewalten, aus dem man sich zurückzieht, wenn es keinen Spaß mehr macht? Oder glaubst Du, man beginne diesen Kampf leichtfertig und leichtsinnig, ohne das Bewusstsein, dass die Staatsgewalten die furchtbare Waffe eines Gesetzes, welches sie meist allein und für ihre Zwecke gemacht haben, gegen uns schwingen und wir fast unbewehrt sind? Allerdings gibt es der fischblutigen Amphibien sehr viele, die recht sehr freisinnig sind, solange es Volkstümlichkeit und Beifall einbringt, die aber sehr klug sind und sagen: ,Ich ändere doch nichts!’, sobald ein unfreundlicher Wind geht. Willst Du mir raten, mich mit diesem Lumpengesindel in eine Reihe zu stellen?“7
Für die Befreiung der Menschen aus Unmündigkeit und systematischer Unterdrückung geht Blum keinem Konflikt aus dem Weg, auch nicht mit der katholischen Kirche. Nach seiner Kommunion hatte Robert Blum in der Kölner Kirche Groß Sankt Martin, die direkt hinter seinem Elternhaus stand, als Messdiener begonnen. Schon bald geriet der hochbegabte Junge in eine tiefe geistige Krise. Er vermochte nicht an die Transsubstantionslehre zu glauben, an die theologische Behauptung, dass sich bei der Abendmahlsfeier Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelten. Und offenbarte einem Kaplan während der Beichte seine Zweifel. „Statt aber die erwartete Beruhigung zu empfangen, musste er sehen, wie der Priester zurückschreckte, als ob ihm eine Schlange entgegenzische, und die Absolution kurzweg verweigerte.“8 Robert wurde vor ein „geistliches Gericht“, was ihm den Bruch des Beichtgeheimnisses offenbarte. „Diese (...) Verletzung des Beichtgeheimnisses gab dem eingeschüchterten Knaben den Mut wieder, und er erklärte nun kurz und bündig, halte man dieses Sakrament nicht heilig, so vernichte man mit dem Glauben an diesen Lehrsatz zugleich den an alle anderen.“9 Der Pfarrer geriet so sehr in Wut, dass er sich auf Robert stürzte. Der konnte den Schlägen entfliehen und wurde als Messdiener gefeuert, womit seine Ablehnung der Kirche ihren Anfang nahm. Später sollte Robert Blum für eine strikte Trennung von Kirche und Staat, für eine Abwendung von Rom und dem Papst und für das Recht auf Glaubensfreiheit kämpfen. In den „Sächsischen Vaterlands-Blättern“ rief er offen zum Austritt aus der katholischen Kirche auf und sprach sich gegen das katholische Sakrament der Beichte sowie gegen den Pflichtzölibat für Priester aus. „Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit, d. h. das Bewusstsein, weder etwas tun zu müssen, was das sittliche Gefühl beleidigt, noch etwas bekennen zu müssen, was man weder weiß noch glaubt, will die Welt und bedarf die Menschheit, wenn sie frei und glücklich werden will.“10
Im Laufe der Jahre in Leipzig findet Robert Blum zu seiner politischen Position. Die Liberalen spalten sich: Auf der einen Seite die Anhänger einer konstitutionellen Monarchie, auf der anderen die Anhänger einer Republik, einer parlamentarischen Demokratie, die demokratischen Linken, zu denen Blum gehört. Gewaltsame Umsturzpläne lehnt Blum ab. Schiller, das Vorbild Robert Blums, vertrat die Ansicht, dass nur der frei sein könne, der sich auch der Freiheit der anderen zuneige, und dies nicht aus taktischen Gründen oder aus Angst vor Strafe. Wie Schiller oder Kant glaubt Blum, dass der Frieden mit der Freiheit der anderen zum Balanceakt der Freiheit gehört, und träumt von einem idealen Staat mit freiheitsfähigen Bürgern, die mit Vernunft das Gleichgewicht zwischen eigener und fremder Freiheit selbst herstellen. Doch Blum, der das Elend der unteren Schichten selbst erfahren hat, weiß auch, dass Menschen unter elenden Lebensbedingungen keine philosophischen Erörterungen wollen, sondern konkrete gesellschaftliche Veränderungen. Um diese aber aus eigener Kraft zu erreichen und zu verteidigen, so Blums tiefe Überzeugung, braucht es Bildung. Eines seiner Lebensthemen. Ende März 1848 wird Blum als Delegierter ins Vorparlament gesandt und zum Vizepräsidenten gewählt. Von den Leipzigern zum Abgeordneten bestimmt zieht Blum Mitte Mai 1848 in die Nationalversammlung ein und wird zum Sprecher der demokratischen Linken, die er schnell als erste Fraktion organisiert. Treffpunkt „Deutscher Hof“. Bald gilt er als einer der mitreißendsten Redner der Nationalversammlung, gerät aber auch immer mehr zwischen die Fronten. Der äußersten Linken, der Fraktion „Donnersberg“, die sich schon Ende Mai 1848 vom „Deutschen Hof“ abspaltet, ist er zu gemäßigt, den Fraktionen der Liberalen und Rechten zu radikal. Die einen wollen die Revolution in Kämpfen auf der Straße retten, die anderen wollen mit oder gar ohne ein demokratisch gewähltes Parlament nicht auf einen König verzichten. Je länger er in der Nationalversammlung agiert, desto unerreichbarer scheinen Blum seine Ziele. Der Traum von einer demokratisch legitimierten Republik findet in der Nationalversammlung keine Mehrheit, stattdessen wird eine konstitutionelle Monarchie beschlossen.
Doch im Oktober 1848 gibt es aufregende Nachrichten von revolutionären Aufständen in Wien. Blum macht sich auf den Weg nach Wien, mit einer Solidaritätsnote seiner Fraktion in der Tasche. Ungeduldig, verzweifelt ob der verfahrenen Situation in der Nationalversammlung und sehnsüchtig nach dem Vorwärts lässt sich Blum von der revolutionären Stimmung auf der Straße oder in der Universität, von der Entschlossenheit der Aufständischen, von der Dynamik der Ereignisse mitreißen. Und übernimmt sogar das Kommando über eine kämpfende Einheit. Der Mann des Ausgleichs, der geistige Vater der parlamentarischen Demokratie, der glühende Anhänger der Vernunft kämpft plötzlich mit der Waffe in der Hand für seine Ideale. Die Revolution muss siegen! Sie siegt nicht. Der Aufstand in Wien wird niedergeschlagen, Robert Blum wird verhaftet, von einem Standgericht ohne Verteidigung zum Tode verurteilt und am 9. November 1848 außerhalb von Wien von einem Exekutionskommando ermordet. Ein politisch motiviertes Justizverbrechen – auch Blums Immunität als Abgeordneter wurde missachtet. Felix Fürst zu Schwarzenberg, der österreichische Regierungschef, und Fürst Windisch-Graetz, Oberkommandierender der kaiserlichen Truppen, nutzten die Gelegenheit, an einem führenden Repräsentanten der Paulskirche ein Exempel zu statuieren, um ihre Verachtung für die Nationalversammlung und den Kampf um Freiheit und Recht zu demonstrieren. Und tatsächlich spiegelt Blums Exekution die realpolitische Machtlosigkeit der Paulskirchenversammlung wider.
Aufbruch und Wandel: Stichworte der Zeit, Merkmale von Robert Blums Leben. Der Weg aus Armut und Kinderarbeit zu einem autodidaktischen Großmeister in Schrift und Sprache. Der Weg vom Gelbgießergesellen und Laternenverkäufer in Köln zum Theatersekretär, zum Schriftsteller, Journalisten und Publizisten, zum Redner und Politiker in Leipzig. Der Weg aus den dunklen Schatten der Pfarrkirche hin zur hellen Erkenntnis über katholischen Machtmissbrauch und päpstliche Willkür. Der Weg aus der untersten sozialen Schicht hinein in die Paulskirche, hinein in die Nationalversammlung: Und auch der Weg vom Prediger der Gewaltlosigkeit zum verzweifelten letzten Kampf auf den Barrikaden von Wien. „Alles will mit Kraft vorwärts.“
Robert Blum ist eine bedeutende Gestalt der deutschen Demokratie- und Freiheitsgeschichte; Vordenker und Wegbereiter unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Seine Publikationen und Reden sind durchdrungen von dem Bekenntnis zu Frieden, Freiheit, Demokratie und Recht. Und seine Forderungen nach einer parlamentarischen Verfassung, nach politischer Mitbestimmung der Bürger, nach einem für alle geltenden Rechtsstaat, nach sozialer Sicherheit und dem freien Zugang zur Bildung nehmen die Grundlagen unserer heutigen Gesellschaft, unserer Demokratie vorweg. Aber Robert Blum wäre sicher auch ein kluger, leidenschaftlicher, unerschrockener Kritiker ihrer zahlreichen Beschädigungen und wachsenden sozialen Verwerfungen. Wir hätten Robert Blum dringend nötig. Seinen Einsatz für Bildung und Aufklärung, seine scharfen Analysen, seinen Mut zum Widerspruch – und seinen Einsatz für eine gerechte Demokratie.
„Eine ruhige Prüfung der gewichtigen Fragen, die auf die Gestaltung unseres öffentlichen Lebens von entscheidendem Einfluss sind, tut daher vor allem Not. Keine Leidenschaft, kein Irrtum, am wenigsten absichtliche Lüge, dürfen sich in die Erörterung der Formen und Einrichtungen, die für das Staatsleben die passendsten sind, mischen, sollen wir anders unsere Entscheidung richtig abgeben. Zu dieser Entscheidung sind aber alle berufen und berechtigt, Arme wie Reiche, Mächtige wie Schwache, Hohe wie Niedere, denn das Vaterland umschlingt alle Staatsbürger mit gleichem Bande, und was ihm widerfährt, Gutes oder Böses, das hat auch jeder Einzelne mitzuempfinden.“11
Robert Blum wurde am 9. November 1848 für seine Ideale hingerichtet. An einem Datum, das deutsche Geschichte schrieben sollte. Genau 70 Jahre später, am 9. November 1918, wurde von Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht die erste deutsche Republik ausgerufen.
1 N. N.: Öffentliche Charaktere I: Robert Blum. In: Die Grenzboten. Jg. 7, 1848, II. Semester, III. Band, S. 366-386.
2 Blum zitiert nach Arthur Frey: Zur Erinnerung an einen Todten. Robert Blum als Mensch, Schriftsteller und Politiker. Mannheim, J.P. Grohe 1849, S. 152.
3 Zitiert nach: Hans Blum: Robert Blum. Ein Zeit- und Charakterbild für das deutsche Volk. Leipzig, Verlag von Ernst Keil, 1878, S. 152.
4 Zitiert nach August Kluckhohn: Aus dem handschriftlichen Nachlasse L. Westenrieders, in: Abhandlungen der Historischen Classe der Kgl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften (17/2), München 1882, S. 1-111, hier 46.
5 Ralf Zerback: Robert Blum. Eine Biografie, Lehmstedt Verlag, Leipzig, 2007, S. 21.
6 Robert Blum Nachlass, Staatsbibliothek zu Berlin, Kasten 3, Nr. 1, S. 48.
7 Robert Blum. Briefe und Dokumente, herausgegeben von Siegfried Schmidt, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1981, Nr. 16, S. 30.
8 Selbstbiographie von Robert Blum und dessen Ermordung in Wien am 9. Novbr. 1848: Herausgegeben von einem seiner Freunde. Leipzig und Meißen, Verlag von F.W. Goedsche 1848, S. 6.
9 Ebd.
10 Robert Blum: Volksthümliches Handbuch der Staatswissenschaften und Politik. Ein Staatslexikon für das Volk (2 Bände). Verlagsbuchhandlung Blum & Co., 1848/1851, Seite 444.
11 Zitiert nach: Hans Blum: Robert Blum. Ein Zeit- und Charakterbild für das deutsche Volk. Leipzig, Verlag von Ernst Keil, 1878, S. 153.
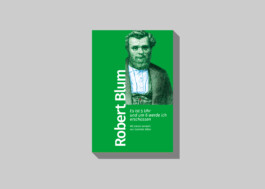
Robert Blum
Es ist 5 Uhr und um 6 werde ich erschossen
Erschienen am 09.02.2023
Taschenbuch mit Klappen, 192 Seiten
€ (D) 14,– / € (A) 14,40
ISBN 978-3-462-50003-5
Die Masse der Gedanken, welche die stets wachsende Bildung erzeugt und reift, geben in ihrer Gesamtheit eine Art Bild, welches in immer weiteren Kreisen betrachtet, geliebt, ersehnt wird, ehe das Verständnis allgemein ist und diese Allgemeinheit den Eintritt der Ideen in das Leben notwendig macht. Man kann falsche, verderbliche, unhaltbare Gedanken in die Zeit schleudern und ihnen einen Anhang werben – sie werden deshalb nicht zu Ideen, sondern verhüllen dieselben nur auf Augenblicke, wie die Schale ihre Frucht, die zersprengt wird, sobald die Reife sich entwickelt hat; man kann Gedanken ächten, verfolgen, unterdrücken, wie dies die geistesmörderische Zensur in Deutschland 30 Jahre getan – man kann aber deshalb die Ideen nicht zerstören, die aus ihnen hervorgingen. Werfen wir statt aller Ausführung einen Blick auf unsere Zeit, so wird uns die Entwicklung der Gedanken zu Ideen, der Ideen zur Tat bald klar werden. Die Masse der Gedanken, welche Deutschlands große Geister am Ende des vorigen Jahrhunderts in die versumpften Zustände ihres Volkes schleuderten, schienen gar keinen Erfolg zu haben. Das Volk sank tiefer und tiefer, wurde völlig dienstbar fremdländischer Gewaltherrschaft, und die Leiter des Volkes, seine „Beglücker und Beherrscher“, vollendeten seine Schande und sein Unglück, indem sie (…) ihr Volk der Knechtung überlieferten durch Feigheit und Verrat. Hat dieses Elend die Ideen aufgehalten? Nein, unter dem eifernsten Druck sind sie gewachsen, bis sie stark genug waren, alle Gewalt zu zersprengen. Ein anderes Beispiel: An die Erhebung des Befreiungskrieges schlossen sich die Ideen von der Freiheit und Einheit des Vaterlandes an. Sie wurden niedergehalten durch 30jährige Geistesknechtschaft, durch das schmachvolle Mittel der Zensur, durch Bundesbeschlüsse, ministerielle Wiener Verschwörungen, Gewalt, Bevormundung und Polizei. Hat es geholfen? Unter dem ersten Eindruck der großartigen französischen Staatsumwälzung brachen die Ideen gewaltsam hervor und gelangten zur Herrschaft. Welche schmachvolle Rolle spielten dabei die deutschen Regierungen! Wie hatten sie hohngelächelt, wenn man ihnen diesen Durchbruch vorher verkündete! Wie pochten sie auf ihre Bajonette und auf ihre Polizei! Wie spotteten sie der „Ideologen, Utopisten, Schreier, Böswilligen“ usw., welche unermüdlich forderten, was man jetzt sogleich gewähren musste! Wie übermütig wiesen sie auf ihre Unfehlbarkeit und Allmacht hin, der Knechtung noch den Hohn hinzufügend! Und das alles ist zerstoben und zugrunde gegangen vor einem Hauch der Freiheit; die Pfuscher und Bönhasen1 in der Politik, die sich Minister und Staatsmänner nannten, sind beseitigt, nur die Schande ihrer hochverräterischen Unterdrückungsversuche und die Lächerlichkeit ihres Gebarens ist übriggeblieben als trauriges Denkmal ihres Daseins. So allmächtig sind die politischen Ideen, die kein Druck, keine Gewalt, kein Verrat zerstören kann, die immer weitere Kreise durchdringen, immer mehr Herzen entflammen, immer mehr Anhänger gewinnen, bis sie friedlich oder gewaltsam ins Leben treten und die Welt beherrschen. Es kann sie Niemand machen, es kann sie Niemand ausrotten, sie wachsen, wie die Pflanze bis zur Reife. Auch jetzt verlacht man noch die Ideen einer gerechteren Verteilung der Lebensgüter, eines allgemeinen Wohlstandes, einer Aufhebung der Armut und Verarmung. Allein auch sie werden unaufhaltsam der allgemeinen Anerkennung, dem Durchbruch, der Herrschaft entgegen reifen. Hoffentlich ist die Zeit für immer vorbei, wo man Ideen mit Polizei verfolgt (…).
1 Ein Bönhase (auch: Böhnhase) war in Norddeutschland ein unzünftiger, also keiner Zunft angehöriger Handwerker. Auch Nichtwissende oder „Dummköpfe“ wurde als Bönhase betrachtet.
Der gewaltige Notruf, welcher aus dem sächsischen Erzgebirge schon beim Beginne des Winters erscholl, und trotz des Aufgebots aller Kräfte und Mittel der lebhaft angeregten Wohltätigkeit sich kaum verminderte, hat die Blicke nicht nur in Sachsen, sondern fast in ganz Deutschland auf jenen Landstrich gelenkt, welcher durch den gänzlichen Verfall der nährenden Industriezweige dem Verderben preisgegeben scheint.
Ist auch das Erzgebirge im Allgemeinen ein armer Landstrich, in dem der widerstrebende Boden und die Rauheit des Klimas gleichmäßig auf eine sehr geringe Fruchtbarkeit desselben wirken, der Bergbau schon lange seinen Arbeitern nur das kümmerlichste Dasein gewährt, die Kattunweberei und Strumpfwirkerei eben im letzten Stadium des verzweifelten Kampfes liegen, welchen nach dem Gang fabrikmäßiger Industrieentwicklung die Hausindustrie überall mit der Fabrikation in geschlossenen Fabriketablissements kämpft, dem sie überall erliegen muss; die Fabrikation von Holz- und Spielwaren sich teils überlebt hat, teils gegen die mächtigere Konkurrenz zurückgeblieben ist; die Leinwandindustrie unter der allgemeinen Verkümmerung schmachtet, der sie in ganz Deutschland preisgegeben ist, und die Band- und Posamentierwarenfabrikation1, trotzdem dass sie als der blühendste Erwerbszweig betrachtet werden kann, es nicht vermag, die allgemeine Geschäftskalamität auszugleichen, so ist es doch vorzugsweise die raueste Gegend des Erzgebirges, deren Bevölkerung sich mit dem einst so einträglichen Spitzenklöppeln beschäftigt, welche dem größten Mangel und Elend erliegt. – Die Schilderungen dieser allgemeinen Not sollen indessen hier nicht um eine vermehrt, vielmehr in einem kleinen Bildchen das Leben des Erzgebirges geschildert werden. Die vielgenannten Dörfer Rittersgrün und Großpöhla, ersteres mit gegen 3000, letzteres mit etwa 1600 Einwohnern, die sich fast sämtlich mit Klöppeln ernähren, mögen den Anhaltspunkt dazu bieten. In diesen, also ziemlich großen Dörfern gibt es selbst für die Männer außer dem Klöppeln wenig Verdienst; wenige nur nähren sich als Hochöfner auf dem benachbarten Hammerwerk und verdienen daselbst bei einer schweren Arbeit wöchentlich 1 Taler, wofür sie abwechselnd Tag und Nacht arbeiten müssen, denn diese Werke stehen von Montagfrüh bis Sonnabendabend niemals still. Noch weniger verdienen die Waldarbeiter, die zudem noch von der Witterung abhängen und im Winter gänzlich feiern müssen. Weiterlesen
Daher ist nichts natürlicher, als dass auch die Männer zum Klöppeln greifen und Knaben wie Mädchen die Klöppelschule (in Rittersgrün) besuchen, Männer wie Frauen am Klöppelkissen sitzen.
Mit dieser Arbeit nun vermögen ein Paar geschickte Hände bei dem anhaltendsten Fleiße in guten Zeiten 4-5 Reichsgroschen täglich zu verdienen; dazu gehört aber nicht allein die höchste Ausbildung im Fache, also der Besuch der Klöppelschule von frühester Kindheit an, sondern auch die sauberste und geschmeidigste, von keiner rauen Arbeit „verdorbene Hand“. Deshalb verrichten auch die Männer, deren Hände zur feineren – und lohnenderen – Arbeit fast stets zu ungeschickt sind, besonders im Winter die häuslichen Arbeiten wie Heizen, Kehren, Kochen usw. und überlassen die Erwerbsarbeiten der Frau und den Kindern.
Die Wohnungen geben den Hütten der Proletarier, wie sie uns aus London, Manchester und anderen großen Städten geschildert werden, wenig nach an Armut und Elendigkeit. Schon das äußere Ansehen der Häuser verrät das Elend, welches drinnen wohnt: Die meisten haben nur ein Erdgeschoß und darauf ein großes Schindeldach. Die allgemeine Verarmung hat auch die Besitzer dieser Hütten nicht geschont, und ein Haus, welches noch ein Stockwerk über dem Erdgeschosse hat, ist fast ebenso selten als eines, welches nicht äußerlich und innerlich die Spuren des Verfalls und versäumter Ausbesserung an sich trägt. An den kleinen Fenstern sind oft zwei Drittel der Scheiben zerbrochen und mit Papier verklebt, wodurch das Tageslicht verkümmert wird, welches zu der feinen Arbeit so nötig ist; durch das lückenhafte Dach bricht Regen, Schnee und Sturm herein, und oft ist der Schläfer, der unter demselben auf elendem Strohlager liegt, genötigt, drei bis vier Mal nächtlich seine Stelle zu wechseln, um den direktesten Störungen des schlechten Wetters zu entfliehen. Die Stuben sind niedrig, eng, mitunter ungedielt und meist schwarz und rußig, doch müssen sie oft für 3-4 Familien Unterkunft und Obdach gewähren. Das Klöppeln erheischt die höchste Geschmeidigkeit der Hände, und die Stuben müssen daher im Winter stets warm sein, da die geringste Steifheit der Finger die Arbeit stört; ja, man trifft häufig in den engen Räumen die Temperatur eines Dampfbades. Holz wurde bisher ungestört aus dem Walde geholt; der Boden trägt vielfach nichts anderes, und die Not hatte den Begriff des Holzdiebstahls aus der Sprache und aus dem Gewissen verbannt. Auch das ist in neuester Zeit anders geworden; die Wälder sind durch das in den Niederungen wachsende Bedürfnis mehr gelichtet worden, besonders der Eisenbahnbau hat direkt und indirekt unermessliche Holzmassen verbraucht. Der Besitzende hat sich bereichert, der Arme ist – wie immer – nicht nur leer ausgegangen, sondern das vergessene Gesetz, welches nur vom Besitzenden und für denselben gemacht ist, hat sich wieder gegen ihn gekehrt und bestraft den Holzdiebstahl.
Die Kleidung des Erzgebirges hat nichts Eigentümliches, wenn auch die Nachäfferei fremder Moden sie nicht zu dem Quodlibet gemacht hat, welches unsere Städte darbieten. Die Männer tragen gelbe Lederhosen, die bis ans Knie gehen, lange wollene Strümpfe und Schuhe oder hohe, bis an die Knie gehende Stiefel, sogenannte Schlappstiefel; doch ist das letztere Kleidungsstück seiner Kostbarkeit wegen selten; im Sommer betrachtet man überhaupt die Fußbekleidung als etwas Überflüssiges. Den Oberkörper bedeckt eine lange, bis auf die Hüfte reichende Jacke, Wams genannt, welche jedoch weniger Bekleidung des Mannes, als der ganzen Familie ist. Denn das Wams vertritt die Stelle des gemeinschaftlichen Mantels und während dasselbe im Sommer überhaupt in Ruhestand versetzt ist, dient es im Winter jedem, der die Hütte verlässt, als wärmende Hülle; sobald das Kind nicht mehr unter der Last erliegt und so groß ist, dass es nicht mehr darüber fällt, hat es auch ein Anrecht auf des Vaters Wams. Wo noch so viel Wohlstand herrscht, da besitzt der Mann auch einen langen blauen Tuchrock und kurze Tuchhosen, die aber fast nur dem Kirchenbesuch bestimmt sind, und die vereint mit einem großen runden schwarzen Filzhut den Staat ausmachen.
Die Frauen tragen ziemlich kurze, buntgestreifte, wollene Röcke, eine Art Oberhemdchen von weißem Baumwollzeug mit kurzen bauschigen Ärmeln und ein buntes Kattunhalstuch. Strümpfe und Pantoffeln brauchen sie nur im Winter. Die Frauen lieben das Bunte, und wenn sie Sonntagsstaat besitzen, so besteht er in einem bunten Kattunkleide und einer Haube mit bunten Bändern; nur wenige junge Mädchen tragen gescheiteltes Haar ohne Kopfbedeckung; es wird ihnen dies aber als Eitelkeit, als Vornehmtuerei ausgelegt. Aus besseren Zeiten hat sich die Sitte erhalten, zur Kommunion nur im schwarzen Anzuge zu gehen und dazu, wo irgend möglich, ein seidenes Kleid zu besitzen. Das ist jedoch längst vorüber und nur wenige schwarze Kleider haben sich in den einzelnen Dörfern erhalten; diese aber sind gewissermaßen Gemeingut geworden, werden für den ausgesprochenen Zweck geborgt und gehen aus grauer Vorzeit auf Kind und Kindeskinder über.
Der Hang der Frauen zu Putz, bunter Kleidung und etwas Flitterstaat gibt dieselben einer großen Plage preis, dem Hausierhandel. Eine Schar Hausierer, Männer und Weiber, werden zur wahren Landplage für die armen Dorfbewohner; sie vermehren sich in neuester Zeit wie die Heuschrecken und haben viel zu der Not auf den Dörfern mit beigetragen, während in den Städten, wo dieser Handel teils verboten, teils nicht ergiebig ist, man wenig davon weiß. (…)
Die Nahrung der Erzgebirger besteht fast einzig und allein aus Kartoffeln, dort Erdäpfel genannt, in deren Bereitung sie eine wahre Virtuosität entwickeln und hundert Dinge in der Pfanne und im Topf bereiten, um Abwechslung in die Speisen zu bringen. Traurige Selbsttäuschung! Es fehlt eben an dem, was Abwechslung gibt, an der Zutat, der Würze, der Beimischung; der Arme ist froh, wenn er nur Salz und das dürftigste Schmalz hat, und damit kann er nur die Form seiner Speise ändern. Eine große Rolle spielen die sogenannten Röhrenkuchen, kleine runde Kuchen oder Klöße, die in der Ofenröhre gebacken werden. Die Kartoffeln werden dazu gekocht, dann geschält und zu Brei geknetet, mit Salz und Schmalz gemischt und mit der Hand geformt. Diese Röhrenkuchen müssen besonders die Stelle der Semmel und Franzbrote beim Frühstück vertreten. Kann und will man sich eine besondere Güte tun, so gießt man Sirup auf diese Kuchen, oder einen braunen Rübensaft, den man ebenfalls Sirup zu nennen beliebt. Sogenannter Kaffee ist das einzige Getränk der Armen und wiederholt sich täglich drei Mal, morgens, mittags und abends; dieser Kaffee besteht aus einem langen Gebräu von Zichorie und kleingeschnittenen gebrannten Rüben oder Wurzeln; er wird in großen irdenen Töpfen aufgetragen, und Einzelne verzehren eine unglaubliche Menge dieses Getränkes. Fleisch ist eine große Seltenheit, Brot ist ebenfalls ein Leckerbissen, und höchstens kommen einige Surrogate von Hafer vor, Butter kennt man fast gar nicht.
Dies ist das gewöhnliche Leben im Erzgebirge; von Spiel und Tanz, Volksfesten und Wohlleben, Erholung und Freude ist dabei nirgend die Rede, wenn es auch nicht an einzelnen Erscheinungen dieser Art fehlt. Das einzige Vergnügen besteht in dem gemeinschaftlichen Klöppeln an den langen Winterabenden, wobei man sich mit Erzählungen unterhält. Dieses gemeinschaftliche Klöppeln nennt man, „zu Rocken gehen“, eine Bezeichnung, die augenscheinlich auf eine Zeit hindeutet, wo die Industrie jene seitdem unendlich vermehrte Bevölkerung noch nicht heimgesucht hatte mit ihrem Segen und ihrem Fluche. Auch liegt diesen Zusammenkünften nicht bloß der angeborene Trieb der Geselligkeit, sondern die Sparsamkeit zu Grunde, indem man das Licht der kleinen, mit schlechtem rauchendem Öl gespeisten Lampe so nutzbar als möglich zu machen sucht. Zu dem Zwecke werden so viel sogenannte Schusterkugeln um das Licht gestellt, als die Gesetze der Refraktion2 und die Erweiterung des Kreises gestatten, und jeder Schein fällt auf ein Klöppelkissen und ein Paar fleißige Hände.
In dieser einförmigen Dürftigkeit und dürftigen Einförmigkeit leben Menschen, denen die Natur den Rechtsbrief auf die Güter und Genüsse der schönen Erde so gut ausgestellt hat wie irgendeinem; so leben sie in einer Zeit, wo man fortwährend vom steigenden Wohlstande des Landes posaunt und sich anstellt, als ob das Menschenglück wie Pilze aus dem Boden schieße; so leben sie in einer Zeit, wo man das Christentum neu erfunden zu haben meint, welches doch gleiche Liebe, gleiche Pflichten und gleiche Rechte lehrt, und wo man vor lauter Christlichkeit den Kopf so rein verloren hat, dass für das Menschliche der Begriff und das Gefühl abhandengekommen ist; so leben sie in einer Zeit, wo man die Versuche zur Hebung dieser Übelstände nicht selten als Narrheit oder als Hochverrat verdächtigt und verfolgt: Oh, wir sind weit, sehr weit gekommen!
Doch nein, so leben jene Menschen nicht; so lebten sie, als sie noch „glücklich“ waren, als sie Arbeit und Verdienst hatten und ihre „Genüsse“ billig waren. Das ist eine schöne Vergangenheit, die wahrscheinlich nur noch in ihren Winterabenderzählungen lebt, wie ehedem schon der gewöhnlichste einfachste Lebensgenuss für sie in das Gebiet der Märchenwelt gehörte. Die Gegenwart hat alles geändert, alles verschlimmert. Denn der Absatz der Erzeugnisse ihrer Hand hat fast ganz aufgehört und ist von den Spitzen und Blonden, die um ein Viertel des Preises auf Maschinen gefertigt werden, vom Markte gedrängt. Das Klöppelwesen ist so herabgekommen, dass die geschicktesten und fleißigsten Arbeiter kaum 1 bis 2 Neugroschen täglich verdienen können und auch bei diesem Lohne noch oft feiern3 müssen. Aus den Wohnungen sind die Bettstellen und die Betten mit den blau gestreiften Überzügen geschwunden und ein Haufen Stroh ist an ihre Stelle getreten, auf dem die ganze Familie ihre Ruhe sucht, wenn die Qualen des Hungers ihr solche gönnen. Fenster und Dächer sind elender geworden, aber das Holz fehlt, und an seine Stelle ist höchstens grünes Reisig getreten, welches mit Gefahr des Freiheitsverlustes zusammengetragen wurde und mühsam auf dem Ofen getrocknet werden muss; seine Ausdünstung verdirbt die Luft, sein Rauch macht die elende Wohnung vollends zur schwarzen Höhle und verdirbt den Armen die Augen. Die Kleidung ist zerrissen und in vielen Haushaltungen laufen die Kinder nackend umher, wie sie aus der Hand der Natur kommen. Aber die Natur hat sich wahrscheinlich auf die Bruderliebe und Barmherzigkeit der „christlichen“ Bevölkerung und des „christlichen Staates“ verlassen und ihnen keine Wolle wachsen lassen. Das väterliche Wams hält kaum noch zusammen, aber es hat eine neue wichtige Bestimmung erhalten: Es muss der ganzen Familie als einzige schirmende Decke dienen in den langen Winternächten. Die Kartoffel, das einzige Nahrungsmittel der Armen, ist seit zwei Jahren nicht geraten; sonst erzeugte der Arme sich dieselbe, indem er ein Stückchen Feld für einen geringen Preis oder für Dünger pachtete. Nachdem die Mutter Erde sogar ihn zwei Mal getäuscht und ihm für die gesunde Aussaat nur eine kranke unbrauchbare Ernte gegeben, ist er völlig erschöpft und vermag nicht mehr, Pacht und Aussaat zu erschwingen. Kartoffeln kaufen aber? Der Scheffel, der sonst 16-20 Reichsgroschen kostete, kostet jetzt drei Taler.
Ist es darum ein Wunder, wenn ganze Familien wochenlang keine andere Speise haben als einen Kleister von schwarzem Mehl, von zweifelhaften Bestandteilen und heißem Wasser bereitet, dem sogar die Würze des Salzes fehlt; dass andere einen Teil des Winters nur Suppe von Kartoffelschalen genossen haben, die sie zum Futter für eine Ziege aufgehoben hatten, die aber längst der Not zum Opfer fiel; dass das Fleisch krepierter Pferde und anderer Tiere beim Schinder gesucht und als Leckerbissen verzehrt wird? Dass die hungernden Eltern den herzzerreißenden Schrei ihrer Kinder nach Brot mit Prügeln beantworten müssen, um nicht völlig zur Verzweiflung getrieben zu werden; dass ganze Familien ihre Blöße nicht zu bedecken vermögen, obgleich sorgfältige Beamte dem reisenden Minister eine mühsam herausgeputzte Klöppelschule zeigten; dass die Mutter ihre Säuglinge mit Blut stillen, weil der ausgehungerte Körper der Brust keine Milch mehr gab, und mit Blut fortstillen musste, weil sie dem Säuglinge weder Milch noch Semmel zu kaufen vermochte; dass die bleichen matten Gerippe, die man Menschen nennt, auf der Straße hinstürzen vor Hunger und dem Schicksal überlassen bleiben, ob sie sich wieder von selbst erholen oder nicht, da es niemand vermag, ihnen eine Labung zu reichen; dass Sterbende, die langsam verelendet sind und die der Tod bald zu erlösen verspricht, keinen anderen Gedanken und keinen anderen Wunsch haben, als sich nur noch einmal satt essen zu können auf dieser Erde, aber scheiden ohne Erfüllung dieses Wunsches; dass solche Wünsche die letzten Worte sind, welche die halbbekleidete Frau, der arbeitslose und arbeitsunfähige Mann, die nackenden Kinder am Sterbebette vernehmen, wo, abgesehen davon, was ihr menschliches Herz empfindet, sich zu den Qualen des Hungers noch das verzweifelnde Bewusstsein gesellt, dass hier ihr einziger Ernährer stirbt, nachdem er sich zu Tode gearbeitet und gehungert hat.
Das alles sind keine Fantasiegebilde, keine Übertreibungen; es sind Tatsachen, wie sie in Rittersgrün, Großpöhla, Wiesenthal und anderen Orten vorgekommen sind; Tatsachen, vor denen selbst die Beschönigungs-, Bemäntelungs- und Umnebelungsmanie verstummte, die gewöhnlich sofort laut wird, wenn irgendeine Erscheinung auftaucht, die ernstliche Zweifel darüber hervorruft, ob denn wirklich unser dermaliger Staat der „beste Staat“ sei. Allerdings kann der Staat in seiner dermaligen Organisation sowohl, als noch mehr auf seiner dermaligen Grundlage dieses Elend nicht aufheben; allein wenigstens sollte er alle seine Kräfte anstrengen, zu mildern und vorzubeugen, wo er immer kann. Das Allermindeste, was man von ihm verlangen kann, wäre doch, die völlig Hilflosen nicht noch zu belasten. Allein diese grässliche Armut ist mit indirekten Steuern wirklich überlastet und muss von jedem kargen Bissen Abgaben bezahlen; Butter, Fleisch und Kartoffeln, die im nahen Böhmen weit billiger sind als im sächsischen Erzgebirge, müssen hoch versteuert werden – Wildbret, Fische und ähnliche Leckerbissen für die Reichen gehen steuerfrei ein; ebenso lag bis vor kurzem auf den trocknen Gemüsen eine hohe Abgabe, obgleich dieselben beim völligen Missraten der Kartoffeln unentbehrlich waren. Und während man diese ungerechteste und verkehrteste aller Steuern bestehen lässt und nicht imstande ist, den völlig entleerten Lebensmittelmarkt zu füllen, verweigert man ein so wichtiges und billiges Nahrungsmittel, wie den Reis, durch Aufhebung des Eingangszolles auf den Markt zu bringen; ja, während die meisten Industriezweige so gesunken sind, dass sie kaum ihre fleißigen Hände noch nähren und dem Arbeiter die härtesten Entbehrungen auferlegen, nimmt man durch die völlig unrationelle Garnzoll-Erhöhung den darbenden Webern und Wirkern den schmalen Bissen zum Munde weg, um einige reiche Spinnereibesitzer, die meist durch eigene Schuld und falsche Veranstaltungen nicht vorwärts können, damit zu begünstigen. Es ist eine sehr verkehrte Welt! (...)
Die wenigen Männer, welche wie der Abgeordnete Schaffrath4 die Forderung der Verarmungsfrage von einem höheren, zeitgemäßen Standpunkt auffassten und behandelten, erhoben ihre Stimme vergebens; sie klang wie eine Stimme in der Wüste, unverstanden und ohne Widerhall in empfänglichen Herzen.
Was dem Erzgebirge fehlt, ist: Aufhebung des modernen Helotentums, Gewährung von Rechten im Staate und Arbeit. Die erstere kann, muss der Staat geben, die letztere schafft gewiss die Gesellschaft selbst besser. Solche Versuche misslingen in den Händen des Staates: Hat derselbe doch vor wenigen Jahren erst große Summen, angeblich 54.000 Taler, dazu verwendet. Allein was geschah? Man kaufte mit dem Gelde den reichen Kaufleuten ihre Ladenhüter ab und den Armen kam nichts davon zugute. Viel wirksamer ist in dieser Beziehung das Bestreben des Kaufmanns Karl Heicke in Leipzig, der sich den Scherznamen „Vater des hungernden Erzgebirges“ wirklich verdient hat, der einen Verein zustande brachte, welcher bereits die Mittel aufbot, mehrere hundert Arbeiter zu beschäftigen, und zwar zu dem in guten Zeiten üblichen Lohne; der aber sich die Mühe und Kosten nicht verdrießen lässt, selbst zu sehen und selbst zu handeln, so dass die Hilfe den Armen direkt zufließt, nicht unberufenen Mittlern, die in der guten Zeit von dem Fleiße der Armen so viel bei Seite gebracht, dass sie das jetzige Elend ruhig ansehen können.
1 Posamente (aus dem französischen passement, Borte, Besatz): Sammelbezeichnung für schmückende Geflechte, wie Zierbänder, Kordeln, Litzen, Quasten oder Spitzen aller Art.
2 Refraktion: Lichtbrechung.
3 Feier, feiern (mittelhochdeutsch vire, Festtag): Tage, an denen nicht gearbeitet wird.
4 Wilhelm Schaffrath, Jurist, linksliberaler Politiker und zu jener Zeit Abgeordneter im Sächsischen Landtag.
Die Frauen sind die Trägerinnen der jedesmaligen Volkssittlichkeit. (...) Ändert sich die Sittlichkeit? Ganz gewiss! Denn welches Prinzip ist bis jetzt ewig bleibend gewesen? Welches konnte aber auch ewig bleibend sein, da jedes schließlich seine Schranke und Endlichkeit herauskehren muss. Es gibt kein perpetuum immobile, wohl aber ein perpetuum mobile, nämlich den Geist: Es liegt im Wesen der Geschichte oder, wie ein öffentliches Blatt sich neulich richtiger ausdrückte, der menschlichen Natur, in steter Bewegung zu sein, sich im ewigen Wechsel ewig zu verjüngen und so immer vollkommenere Entwicklungsphasen hervorzutreiben, eine Ansicht, die übrigens auch in den biblischen Worten liegt: Es muss Ärgernis kommen. Weiterlesen
Und worin besteht nun die heutige Volkssittlichkeit? Offenbar in der Teilnahme aller Einwohner des Staats am Staat; dies ist die summa fidel, das Ideal des Strebens. Es ist also nicht bloß auf die Frage, ob es ein Recht sei, am Staat teilzunehmen, zu erwidern, es sei eine Pflicht, wie es neulich ein öffentliches Blatt tat, nein, es ist ausdrücklich zu sagen, dass es unsittlich sei, dies zu unterlassen. Es ist nicht mehr das Höchste für den Menschen, seiner Familie Wohl zu wollen und zu sorgen, dass seine Haussöhne und Töchter ein gutes Auskommen erhalten, eine gute Karriere machen, respektive glücklich (was man so nennt) verheiratet werden; diese Art und Weise, für den Menschen nur als Einzelnen zu sorgen, heißt vielmehr mit Recht philisterhaft. Die Teilnahme an der Gemeinde, am Staat und an den Staaten oder der Menschheit, das erst macht heutzutage den Menschen zum Menschen. Wenn alle Menschen hierzu berufen sind, in welcher besonderen Weise werden dann die Frauen ihre Teilnahme zu äußern haben? – Indem wir die Frage so stellen, sprechen wir damit von vorneherein uns gegen die frühere Ansicht der gänzlichen Ausschließung der weiblichen Welt von der Teilnahme am Staatsleben aus. Es wäre dies in der Tat gegen die Bestimmungen der Gegenwart, gegen den wahrhaften Zeitgeist, und wenn wir nicht mit ihm in Widerspruch treten wollen, so müssen wir von diesem Satz durchgängig ausgehen. Gegen die gänzliche Ausschließung der weiblichen Welt vom Staat, gegen ihre philisterhafte Einpferchung in den engen Kreis eines Hauswesens, hat offenbar das Extrem der Emanzipation der Frauen ein berechtigtes Moment in sich. Ja es ist wahr, jene Teilnahmslosigkeit ist etwas Trübseliges, es sträubt sich das Gefühl dagegen, dass das Weib, welches in einem als die Krone der Schöpfung angepriesen wird, doch von der höchsten Weise menschlicher Tätigkeitsäußerung gänzlich ausgeschlossen bleiben soll.
Dennoch aber sagt uns wiederum das Gefühl, dass die Emanzipation der Frauen eben auch unwahr ist, und es fragt sich somit, aus welchem Grunde, damit wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Das Wesen des Weibes, nur noch für faselnde Poeten ein Geheimnis, besteht ganz allgemein ausgedrückt im Beharren. Was der Schlaf am Individuum ist, diese nicht passive, aber in sich geschlossene Erquickung und Erholung des Körpers, das ist das Weib für die Menschheit. Wenn daher Rousseau bemerkt, es sei das Laufen das einzig Ungraziöse an ihr, so liegt eben darin, dass das zu bewegte Auftreten ihr nicht ziemt. Dasselbe gilt in der geistigen Sphäre: Es schickt sich für sie eine energische, aber keine eingreifende, eine mutvolle, aber nur innig ausdauernde und ausharrende, mit einem Wort keine männliche Teilnahme am öffentlichen Wesen. Die Emanzipation der Frauen aber verlangt eine solche und darin liegt ihre Verkehrtheit. Das Weib ist wohl geschaffen, dem heimkehrenden Sieger den Kranz aufzusetzen (…), aber weder teilnahmslos gegen ihn zu bleiben und ihn gar zu fliehen noch selbst in die Schlacht zu ziehen und in ihre zarte Hand das raue Eisen zu nehmen. Und nicht bloß im wirklichen Kampf kann sie diese Art der Teilnahme bewähren, auch im unblutigen, aber zur Verhinderung der Fäulnis des Staates unumgänglich notwendigen Parteikampf während des Friedens kann so ihre Mitwirkung sich offenbaren. So ziemt es sich nicht für sie, von der neusten Mode oder dem letzten Ball zu sprechen, wenn es an der Zeit ist, den süßen Namen Vaterland im Munde zu führen; es ziemt sich nicht für sie, davon zu reden, wie schlecht sich Herr und Madame X. in ihrer Ehe vertragen, wenn es sich fragt, ob im Staat noch nicht zur Anerkennung gekommene unverjährbare Menschenrechte ferner unterdrückt bleiben sollen, es ziemt sich überhaupt nicht für sie, teilnahmslos sich wegzuwenden, sobald nur ein Anflug von Politik in das Gespräch hineingemischt wird. (...)
Wir wiederholen unseren Anfang: Die Frauen sind die Trägerinnen der jedesmaligen Volkssittlichkeit, haben sie den Geist der Zeit noch nicht in sich aufgenommen, so ist derselbe noch nicht in das Fleisch und Blut des Volks aus der Theorie übergegangen, so ist er noch nicht Gesinnung geworden, so bildet er noch nicht die öffentliche Meinung, so dringt die Freiheit der Zeit noch nicht zur allgemeinen Anerkennung durch. Noch schlimmer aber: Das heranwachsende Geschlecht nimmt sie nicht mit der Muttermilch auf und begeistert sie nicht für ihre Einführung in das Leben. Das gilt namentlich von Deutschland; tragen nicht erst unsere Frauen „ein Schwert in Myrten“, klingen Frau und frei ferner noch einander fremd, so ist auf die Lösung der Fragen, in welchen wir nun schon so weit hinter anderen Ländern zurückgeblieben sind, nicht zu rechnen, eher aber darauf, dass unsere tiefsinnige, geistreiche Nation zu den „Parias unter den Völkern“ übergehe.
Allen Patrioten mögen daher die hier ausgesprochenen Ansichten ans Herz gelegt sein; sie werden leider bei flüchtigem Einblick in das Leben finden, wie traurig, wie wahrhaft kläglich und verwahrlost in dieser Beziehung unser Vaterland dasteht. Mögen daher diese Zeilen Anklang finden, und die Erziehung der weiblichen Jugend nicht wie bisher fern gehalten werden von dem Namen, bei dem die Herzen höherschlagen; möge ihr vor allem durch die Kenntnis seiner gedankenmäßig erfassten gewordenen Geschichte Teilnahme für dessen werdende Zukunft eingepflanzt werden. Denn das gehört heutzutage wahrhaftig weit mehr zur Bildung und Gesittung als das Wissen einiger faden französischen und englischen Konversationsphrasen. (…)
Diese Versammlung, meine Herren, erscheint mir oft wie der Prometheus, seine Riesenkraft war angeschlossen an einem Felsen, und er konnte sie nicht brauchen – die Riesenkraft der Versammlung scheint mir zuweilen angeschlossen zu sein an den Felsen des Zweifels, den sie sich selbst aufbaut. Zu verschiedenen Zeiten ist sie sich dieser ungeheuren Kraft bewusst geworden und der Ausdruck derselben genügte, in den Augen der Nation sie wieder auf den Standpunkt zu stellen, den sie einnimmt, den aber der Zweifel auf der anderen Seite ihr streitig zu machen suchte; so bei dem Beschluss über den Raveauschen Antrag1, dem der Zweifel voranging; so bei dem Zweifel, ob man einen Friedensschluss genehmigen könne und dürfe, während es doch sonst niemanden gibt, der ihn genehmigen kann; so bei der Bewilligung der 6 Millionen für die Marine, und so heute wieder, als Sie mit dem großartigsten Schwunge einen Krieg erklärt2 haben, ohne sich zu fragen, ob Sie ein Heer haben und ob Sie eine Flotte haben und ob Sie Mittel dazu haben; aber Sie haben mit der kühnen Erklärung zur gleichen Zeit den Sieg beschlossen, denn der Sieg lebt in uns, nicht da draußen und nicht in materiellen Dingen! Eine neue große Entscheidung schlägt an Ihr Herz, und Sie sollen noch einmal den Zweifel lösen, ob Sie Ihre Gewalt fühlen und die unumstößliche Majestät, die in Ihren Händen liegt, und ob Sie sie gebrauchen wollen. Weiterlesen
Sie sind hier hierhergekommen, um dieses zerstückelte Deutschland in ein Ganzes zu verwandeln; Sie sind hierhergekommen, um den durchlöcherten Rechtsboden in einen wirklichen, in einen starken zu verwandeln. Sie sind hierhergekommen, bekleidet mit der Allmacht des Vertrauens der Nation, um das „einzig und allein“ zu tun. Genügt es dazu, dass wir Beschlüsse fassen und sagen: Die Nationalversammlung beschließt, dass das oder das geschehe? Durchaus nicht. Sie müssen sich das Organ schaffen, durch welches diese Beschlüsse hinausgetragen werden in das Leben, durch welches sie gesetzliche Geltung erlangen; dieses Organ zu schaffen, ist der Gegenstand unserer Verhandlung. Was wird dieses Organ sein? Bei dem ersten Anblick dessen, was wir bedürfen, eben nur das Organ, welches Ihren Willen verkündet. Man sagt uns, der Vollziehungsausschuss, der von einer sehr kleinen Minderheit vorgeschlagen worden ist, sei eine republikanische Einrichtung, und wir geben das sehr gerne zu. Wir verhehlen gar nicht, wir wollen die Republik für den Gesamtstaat, wir wollen diese Einrichtung, und nicht deshalb, weil wir die Verhältnisse in Deutschland auflösen wollen, sondern weil wir sie schützen wollen, weil wir glauben, dass zwei gleichartige Richtungen nicht miteinander bestehen können, weil wir in der republikanischen Form an der Spitze des Gesamtstaates Sicherheit sehen für die Freiheit jedes einzelnen Staates, seinen eigenen Willen auszuführen und zu erhalten, und weil wir zu gleicher Zeit diese Spitze nicht den Zielpunkt niederen Ehrgeizes sein lassen wollen. Allein, es ist ein arger Irrtum, wenn man dieses Streben nach einer republikanischen Einheit verwechselt mit dem, was in den einzelnen Staaten geschieht oder geschehen soll. Wir bauen den Gesamtstaat aus den einzelnen Teilen, die vorhanden sind, wir erkennen die Tatsache dieses Vorhandenseins ebenso wie die Formen an, und unser Bestreben ist dahin gerichtet, in der großen Gesamtheit einer jeden Einzelheit ihre Freiheit, den Spielraum zu ihrer eigentümlichen Entwicklung, zu gönnen und zu belassen. Schaffen Sie den Vollziehungsausschuss3, so sind es die bestehenden Gewalten, die bestehenden Regierungen, welche vom Vollziehungsausschuss die Beschlüsse der Nationalversammlung empfangen, und diese Beschlüsse ausführen; sie werden in ihrem Wesen und in ihrer Kraft nicht im Mindesten angetastet, sie bleiben vielmehr im Vaterlande völlig auf dem Standpunkt, den sie sich zu erhalten bis jetzt vermocht haben. Wenn die Regierungen das sind, was man so vielfach behauptet, gutwillig in Bezug auf die Ausführung und bereit, Opfer zu bringen zum Gedeihen des Ganzen, so ist diese Einrichtung so einfach, dass es keine einfachere gibt; wenn sie aber nicht gutwillig sind, was von anderer Seite auch vielfach behauptet wird und wofür man sich auf einzelne Erscheinungen stützt, die man vielleicht überschätzt, dann (…) soll er die Bedürfnisse der Zeit stellen über die Regierungen, dann soll er ihnen entgegentreten, dann soll er die Nation nicht den Sonderinteressen aufopfern, sondern vielmehr die Widerstrebenden – geradezu heraus gesagt! – zermalmen.
Wäre ein solcher Fall denkbar, ich hoffe, er ist es nicht, dann wäre es eine sonderbare Einrichtung, dass wir denen die Vollziehungsgewalt oder die provisorische Regierung, die es dann allerdings werden müsste, in die Hand geben, gegen die sie handeln soll und handeln muss. – Man hat den Vollziehungsausschuss auch in anderer Beziehung angegriffen und hat ihn ungenügend genannt, da er nur die Vertretung Deutschlands nach außen, nicht die Verteidigung desselben enthält. Nun, es muss in dieser Beziehung ein arges Missverständnis herrschen, denn die Vertretung eines Landes nach Außen besteht nicht bloß im diplomatischen Verkehr, sie besteht auch in der Entwicklung der ganzen Kraft und Gewalt, die eine Nation hat, da, wo sie notwendig wird. Der Vollziehungsausschuss hat ferner einen großen Vorteil: Er gewährt den Regierungen, was sie bedürfen, den Mittelpunkt, in dem das Staatsleben für den Gesamtstaat in diesem Augenblick zusammenläuft. Er ist ihnen, wenn sie wirklich das Beste der Nation wollen, ihr Aufstreben fördern, nicht im Geringsten gefährlich. Er sichert die Versammlung vor jedem Missbrauch; denn die Versammlung hat es in der Hand, ihn zurückzuziehen, sobald er die Begrenzung überschreitet, die sie ihm zu stecken für gut findet. Er sichert die Regierungen auch durch die Wahl; denn wie die Versammlung zusammengesetzt ist, haben sie nicht zu besorgen, dass eine Meinung aufkomme und an die Spitze gestellt werde, die den Regierungen Besorgnisse erregt. Hat doch ein Mann, der in jenen Kreisen lange Jahre gelebt und gewirkt hat, Ihnen ausdrücklich gesagt, dass er ohne alle Besorgnis das Wohl des Gesamt- wie der einzelnen Staaten in den Händen dieser Versammlung sehe. Der Vollziehungsausschuss sichert aber auch das Volk von möglichen Übergriffen, in dem er als ein Ausfluss der von Ihnen erwählten Versammlung, als ein Ausfluss der Gewalt der Träger seiner Majestät und Souveränität dasteht und das Vertrauen des Volkes aus seinem Ursprung schon für sich in Anspruch nimmt. Das Direktorium4, welches man Ihnen vorgeschlagen hat, sichert in dieser Beziehung niemanden. (…)
Sie wollen ein solches Direktorium schaffen, und ich frage Sie: Dürfen Sie dasselbe schaffen? Haben Sie ein Mandat dazu, mit irgendjemandem in der Welt zu verhandeln? Hat eine einzige Wahlhandlung auch nur einen derartigen Vorbehalt nicht aufkommen, sondern nur gewissermaßen als eine Ansicht aufdämmern lassen? – Nirgends in der Welt. Berufen sind Sie durch die Allmacht des Volkes, und Sie sind nur jenem Mandat treu, solange sie diese Allmacht wahren. Sie dürfen nicht verhandeln; Sie müssen eher Ihr Mandat niederlegen als sich von der Aufgabe entfernen, die uns geworden ist. Sie dürfen am wenigsten in dem Augenblick, wo das Volk seine lang verkümmerten Rechte und seine lang verkümmerte Macht errungen hat, mit denen unterhandeln, die seit 30 Jahren niemals mit uns unterhandelt haben, die selbst unseren Rat niemals hörten, wenn es sich darum handelte, Deutschland als ein Ganzes zu vertreten. Allein, es wird auch der Unterhandlungen nicht bedürfen. Wahrlich, diejenigen leisten den Regierungen einen sehr schlimmen Dienst, die sie darstellen als etwas, was außerhalb uns, d. h. außerhalb des Volkes steht; man sagt uns ja immer: „Die Regierungen sind jetzt volkstümlich, sie sind aus dem Volke hervorgegangen, sie gehören dem Volke an.“
Nun wohlan! Wenn das wahr ist, so vertreten wir sie mit, wir vertreten nicht den einzelnen, nicht den Stand, keine Kaste. Wir vertreten das Volk und die Regierungen, sie gehören zum Volk; mindestens sollen sie zum Volk gehören. Wo das nicht der Fall wäre, dass die Regierungen im Volk aufgingen, nun, dann würde nichts vorliegen als die Wahrung der alten Fürsten- und Dynasteninteressen, und wahrlich, ein Volk von 40 Millionen, es würde nicht unterhandeln können mit 34 Menschen, die ihr Sonderinteresse fördern wollen. So ist in unserem Vorschlage nach meiner Überzeugung gewahrt, was sie wahren wollen; das allseitige Recht, die allseitige tatsächliche Stellung ist anerkannt, wenn Sie sich darauf beschränken, zu erklären, was Sie bedürfen, und wenn Sie warten in Beziehung auf die Ausdehnung der Gewalt, bis Sie sie bedürfen.
Man hat uns vielfach in diesen Tagen darauf hingewiesen, es herrsche die Anarchie, und sie trete hervor an diesem und jenem Orte in Deutschland, und das ist wahr, leider ist es wahr; aber fragen Sie, was ist denn diese Anarchie. Ist sie etwas anderes als die Zuckungen der Ungeduld, die in dem gehemmten Leben sich kundgibt, die Zuckungen der Kraft, die nach außen oder nach innen sich geltend machen will? In einer Weise, wie es die Weltgeschichte noch nie gesehen hat, hat das Volk in Deutschland seine Revolution gemacht; es hat mit wenigen Ausnahmen die Gewaltäußerungen gescheut, weil eine revolutionäre Volksversammlung, eine revolutionäre Nationalvertretung im Vorparlament hier zusammentrat und dem Gesamtausdruck seine Geltung zu verschaffen suchte. Es hat sich gemäßigt, weil aus jener revolutionären Volksvertretung eine zweite, gleichartige, wenn auch in anderer Beziehung auf einem Gesetz beruhende Volksvertretung sich gestaltete; verhehlen wir es nicht: eine auf dem Gesetz der Revolution beruhende Versammlung, die ihm versprach, seine Wünsche zur Geltung zu bringen, seine Bedürfnisse zur Wirklichkeit zu machen. Wollen Sie der Anarchie entgegentreten, Sie können es nur durch den innigen Anschluss an die Revolution und ihren bisherigen Gang. Das Direktorium, das Sie schaffen wollen, ist aber kein Anschluss daran; es ist ein Widerstand, es ist Reaktion, es ist Konterrevolution – und die Kraft erregt die Gegenkraft.
Man wirft mitunter schielende Blicke auf einzelne Parteien und Personen und sagt, dass sie die Anarchie, die Wühlerei und wer weiß was wollen. Diese Partei lässt sich den Vorwurf der Wühlerei gern gefallen; sie hat gewühlt ein Menschenalter lang, mit Hintansetzung von Gut und Blut, mindestens von allen den Gütern, die die Erde gewährt; sie hat den Boden ausgehöhlt, auf dem die Tyrannei stand, bis sie fallen musste, und Sie säßen nicht hier, wenn nicht gewühlt worden wäre. (Stürmischer, anhaltender Beifall in der Versammlung und auf den Galerien.) (...)
Meine Herren! Es gab einen Staat in Deutschland, der auch stark war, der auf dem historischen Rechtsboden stand, auf Ihrem historischen Rechtsboden, der uns hier so oft vorgeführt wird. (…) Es ist nach meiner Ansicht eine Gotteslästerung der Freiheit, wenn man ihr aufbürdet, dass sie krankt an dem Erbe, welches sie von der Despotie unfreiwillig hat mit übernehmen müssen. Es ist eine Gotteslästerung an der Menschlichkeit, wenn man darauf hinweist, dass dieser Staat achtzigtausend seiner hungernden Brüder hat ernähren müssen. Diese achtzigtausend Hungernden kosten nicht so viel, als der gestürzte Thron gekostet hat, und man kann noch eine Null hinzufügen, und sie kosten immer noch nicht so viel. Abgesehen davon, dass in dem Sumpfe, der sich um diesen korrumpierenden Thron ausgebreitet, neben aller Sittlichkeit, Ehre und Tugend auch alle Mittel verschlungen wurden, die nötig waren, um die Hungernden zu ernähren. Auf dem historischen Rechtsboden, auf welchem wir angeblich stehen, hat man in einem ganz ähnlichen Falle die Hungernden lieber der Hungerpest preisgegeben. Dorthin, wo man das Gespenst hervorruft, wird die Freiheit den Kranz des unverwelklichen Dankes niederlegen, wenn sie siegt; und wenn sie unterliegt, wird auch der letzte sehnsüchtige Blick ihres brechenden Auges sich dorthin wenden. Wollen Sie das Himmelsauge brechen sehen und die alte Nacht über unser Volk aufs Neue herausführen, so schaffen Sie Ihre Diktatur. (Stürmisches Bravo.)
1 Antrag des demokratischen Abgeordneten Raveaux vom 19. Mai 1848, dass die Nationalversammlung allen einzelstaatlichen Landtagen übergeordnet sein müsse.
2 Erklärung der Nationalversammlung vom 20. Juni 1848, dass ein Angriff auf die damals zur Habsburgischen Monarchie gehörende Stadt Triest als ein Angriff auf Deutschland betrachtet würde.
3 Die Linke der Frankfurter Nationalversammlung forderte entsprechend einem Antrag von Robert Blum und Wilhelm Adolph v. Trützschler, als provisorische Zentralgewalt einen fünfköpfigen Vollziehungsausschuss einzusetzen, der ausschließlich an die Beschlüsse der Nationalversammlung gebunden sein sollte.
4 Die liberale Mehrheit der Frankfurter Nationalversammlung wollte als provisorische Zentralgewalt ein Direktorium aus drei von den Regierungen der Einzelstaaten vorzuschlagenden Männern einsetzen. Das Dreierdirektorium sollte sich gegenüber der Nationalversammlung nicht rechtfertigen müssen.
Heldenmütige Bewohner Wiens!
Unsere Gesinnungsgenossen in der Nationalversammlung zu Frankfurt haben uns hierher gesandt, Euch die Bewunderung auszusprechen, die sie mit uns und ganz Europa Euch zollen. Da die Verhältnisse nicht gestatten, unsere Aufgabe in anderer Weise zu lösen, zu Euch zu sprechen in der Versammlung des Volkes, so wenden wir uns auf diesem Wege an Euch. Ihr habt mit einem großen Schlage die Ränke einer volks- und freiheitsfeindlichen Partei vernichtet! Habt Euch mit bewundernswerter Aufopferung für das ganze Deutschland wie für die Völker Österreichs erhoben wie ein Mann. Eure Heldentat flößt allen Kämpfern der Freiheit neuen Mut ein, und Eure Erhebung sichert unserem Kampf den Sieg. Euer Beispiel wird uns allen voranleuchten und wir werden Euch nacheifern auf dem glorreichen Pfad, um wert zu sein, Euch Brüder zu nennen.
Wir aber, die wir gesandt sind, Euch den Bruderkuss und die heißen Segenswünsche von vielen Tausenden zu überbringen, wir preisen uns glücklich, in diesem verhängnisvollen Augenblicke in Eurer Mitte zu weilen, und wenn es das Schicksal will, Eure Gefahren zu teilen, mit Euch zu stehen und zu fallen. Heldensöhne Wiens, empfangt den Ausdruck unserer Bewunderung und unseres tiefempfundenen Dankes!
Die Abgesandten der Vereinigten Linken in der deutschen Nationalversammlung zu Frankfurt a. M., Robert Blum, Julius Föbel, Moritz Hartmann, Albert Trampusch
1 In den Morgenstunden des 6. Oktober 1848 begann die „Wiener Oktoberrevolution“. Als die Nachrichten darüber am 12. Oktober in Frankfurt eintrafen, schickte die Nationalversammlung eine Delegation in die Donaumetropole. Gemeinsam mit drei weiteren Abgeordneten machte sich Blum am 13. Oktober auf den Weg und traf am 17. Oktober in Wien ein.
30. Oktober 1848
Liebe Jenny!
Die Schlacht ist verloren, das boshafte Glück hat uns geäfft. Nein, das Glück nicht; der schmachvollste Verrat, den jemals die Weltgeschichte gesehen hat, war derart gesponnen, dass er im Entscheidungsaugenblick und nur und allein an diesem ausbrach. Ich habe am Samstag noch einen sehr heißen Tag1 erlebt, eine Streifkugel hat mich sogar unmittelbar am Herzen getroffen, aber nur den Rock verletzt. Wien kapituliert eben, und wahrscheinlich wird die Innere Stadt heute Abend oder morgen übergeben. Dadurch sind einige noch unbesiegte Vorstädte dann ebenfalls bezwungen oder werden’s wenigstens leicht. Ein Teil des Heeres – d.h. des städtischen Heeres – will die Waffen nicht ablegen, besonders sind die übergetretenen Soldaten in wahrer Raserei. Es kann demnach noch sehr schlimme Szenen im Inneren geben. – Sobald der Verkehr wieder beginnt, reise ich ab und komme nach Leipzig. Rede mit meinen Freunden, ob sie es für zweckmäßig halten, dass ich dort einen öffentlichen Bericht gebe. Meinen sie das, so sollen sie Plakate drucken lassen des Inhalts: Weiterlesen
Heute wird R.B. von Wien hier eintreffen etc., also ohne Datum, damit man sie, wenn ich mit dem ersten Zug komme, noch anschlagen kann. Friese wird Dir am besten darin raten. Den Inhalt dieses Briefes schreibe kurz an C. Vogt, Mitglied der konstitutionellen Nationalversammlung in Frankfurt.
Ich kann nicht mehr schreiben, mein Herz ist zerrissen von Zorn und Wut und Schmerz. Lebe wohl! Auf baldiges Wiedersehen! Gruß und Kuss! Robert
6. November 1848
Meine liebe Jenny!
Als ich Dir meine letzten Zeilen schrieb, deren Kürze die Umstände geboten, glaubte ich denselben auf dem Fuße zu folgen und wenigstens kurze Zeit in meinem Hause zu verleben. Das ist anders geworden, und ich werde unfreiwillig hier zurückgehalten, bin verhaftet. Denke Dir indes nichts Schreckliches, ich bin in Gesellschaft Fröbels, und wir werden sehr gut behandelt. Allein die große Menge der Verhafteten kann die Entscheidung wohl etwas hinausschieben. Sei also ruhig, und wenn Du das bist, wirst Du zu meiner Ruhe wesentlich beitragen. Ich denke Dich stark und gefasst und bin’s deshalb selbst. (…) Leb recht wohl, bleibe gesund und heiter, grüße alle Freunde und empfange für Dich und unsere lieben Kinder von Herzen Gruß und Kuss von Deinem Robert.
9. November 1848
„Mein teures, gutes, liebes Weib, lebe wohl, wohl für die Zeit, die man ewig nennt, die es aber nicht sein wird. Erziehe unsere – jetzt nur Deine Kinder zu edlen Menschen, dann werden sie ihrem Vater nimmer Schande machen. Unser kleines Vermögen verkaufe mit Hilfe unserer Freunde. Gott und gute Menschen werden Euch ja helfen. Alles, was ich empfinde, rinnt in Tränen dahin, daher nochmals: leb wohl, teures Weib! Betrachte unsere Kinder als teures Vermächtnis, mit dem Du wuchern musst, und ehre so Deinen treuen Gatten. Leb wohl, leb wohl! Tausend, tausend, die letzten Küsse von Deinem Robert.
Morgens 5 Uhr, um 6 Uhr habe ich vollendet. Die Ringe habe ich vergessen; ich drücke Dir den letzten Kuss auf den Trauring. Mein Siegelring ist für Hans, die Uhr für Richard, der Diamantknopf für Ida, die Kette für Alfred als Andenken. Alle sonstigen Andenken verteile Du nach Deinem Ermessen. Man kommt! Lebe wohl, wohl!
1 Blum war am 28. Oktober 1848 als Kompaniechef der Elitekorps mit seiner Kompanie zur Verteidigung der Nußdorfer Linie eingesetzt.
Volksthümliches Handbuch der Staatswissenschaften und Politik. Ein Staatslexikon für das Volk (2 Bände). Verlagsbuchhandlung Blum & Co., 1848/1851.
Vorwärts: Volks-Taschenbuch für das Jahr 1843. Herausgegeben von Robert Blum und Friedrich Steger, Leipzig 1843, Verlag von Robert August Friese.
Die Fortschrittsmänner der Gegenwart. Eine Weihnachtsgabe für Deutschlands freisinnige Männer und Frauen. Herausgegeben von Robert Blum. Leipzig, 1847. Verlag von Robert Blum & Co.
Robert Blum: Ein Zeugnis seines Lebens. Nach zeitgenössischen Dokumenten. Bearbeitet von Dr. Heinz Füssler. Herausgegeben vom Städtischen Museum – Zwickau (Sachsen), 1948.
Selbstbiographie von Robert Blum und dessen Ermordung in Wien am 9. Novbr. 1848: Herausgegeben von einem seiner Freunde. Leipzig und Meißen, Verlag von F.W. Goedsche 1848.
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt (Main). Herausgegeben von Franz Wigard. Frankfurt (Main) 1848f.
Briefe und Dokumente, Reclam Leipzig 1981.
Arthur Frey: Zur Erinnerung an einen Todten. Robert Blum als Mensch, Schriftsteller und Politiker. Mannheim, J.P. Grohe 1849.
Eduard Sparfeld: Das Buch von Robert Blum. Ein Denkmal seines Lebens und Wirkens, Leipzig 1849
Hans Blum: Robert Blum. Ein Zeit- u. Charakterbild für das deutsche Volk. Leipzig 1878.
Ralf Zerback: Robert Blum. Eine Biographie, Leipzig 2007.
Peter Reichel: Robert Blum. Ein deutscher Revolutionär 1807-1848, Göttingen 2007.
Wir nutzen Cookies und ähnliche Technologien, um Geräteinformationen zu speichern und auszuwerten. Mit deiner Zustimmung verarbeiten wir Daten wie Surfverhalten oder eindeutige IDs. Ohne Zustimmung können einige Funktionen eingeschränkt sein.